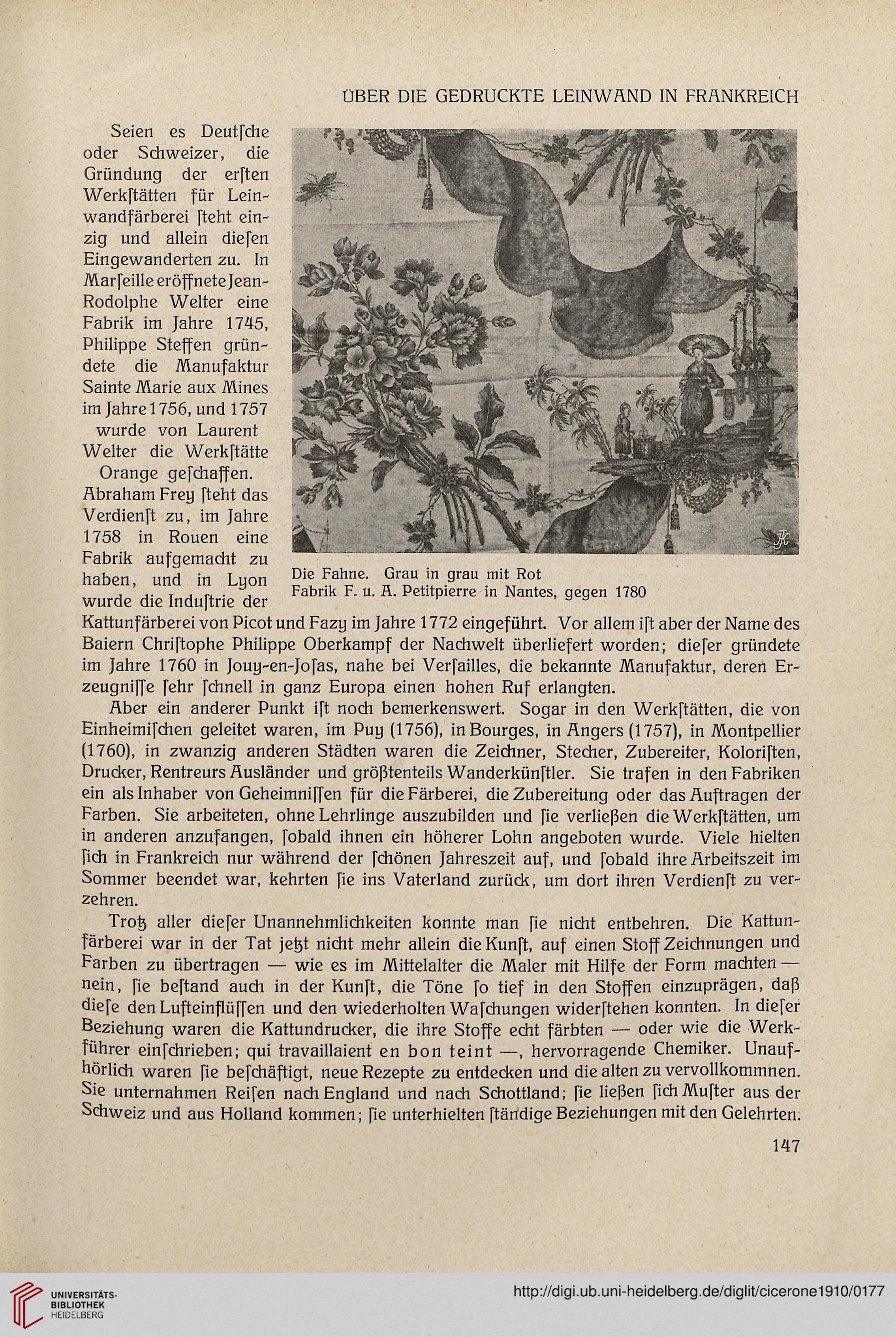Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 2.1910
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.24116#0177
DOI Heft:
5. Heft
DOI Artikel:Clouzot, Henri: Über die gedruckte Leinwand in Frankreich (17. und 18. Jahrhundert)
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24116#0177
ÜBER DIE GEDRUCKTE LEINWAND IN FRANKREICH
Seien es Deutfche
oder Schweizer, die
Gründung der erften
Werkftätten für Lein-
wandfärberei fteht ein-
zig und allein diefen
Eingewanderten zu. In
Marfeille eröffnete Jean-
Rodolphe Weiter eine
Fabrik im Jahre 1745,
Philippe Steffen grün-
dete die Manufaktur
Sainte Marie aux Mines
im Jahrel756, und 1757
wurde von Laurent
Weiter die Werkftätte
Orange gefchaffen.
Abraham Frey fteht das
Verdienft zu, im Jahre
1758 in Rouen eine
Fabrik aufgemacht zu
haben, und in Lyon
wurde die Induftrie der
Kattunfärberei von Picot und Fazy im Jahre 1772 eingeführt. Vor allem ift aber der Name des
Baiern Chriftophe Philippe Oberkampf der Nachwelt überliefert worden; diefer gründete
im Jahre 1760 in Jouy-en-Jofas, nahe bei Verfailles, die bekannte Manufaktur, deren Er-
zeugniffe fehr fchnell in ganz Europa einen hohen Ruf erlangten.
Aber ein anderer Punkt ift nodi bemerkenswert. Sogar in den Werkftätten, die von
Einheimifchen geleitet waren, im Puy (1756), inBourges, in Angers (1757), in Montpellier
(1760), in zwanzig anderen Städten waren die Zeichner, Stecher, Zubereiter, Koloriften,
Drucker, Rentreurs Ausländer und größtenteils Wanderkünftler. Sie trafen in den Fabriken
ein als Inhaber von Geheimniffen für die Färberei, die Zubereitung oder das Aufträgen der
Farben. Sie arbeiteten, ohne Lehrlinge auszubilden und fie verließen die Werkftätten, um
in anderen anzufangen, fobald ihnen ein höherer Lohn angeboten wurde. Viele hielten
fich in Frankreich nur während der fchönen Jahreszeit auf, und fobald ihre Arbeitszeit im
Sommer beendet war, kehrten fie ins Vaterland zurück, um dort ihren Verdienft zu ver-
zehren.
Trotj aller diefer Unannehmlichkeiten konnte man fie nicht entbehren. Die Kattun-
färberei war in der Tat jeßt nicht mehr allein dieKunft, auf einen Stoff Zeichnungen und
Farben zu übertragen — wie es im Mittelalter die Maler mit Hilfe der Form machten —
nein, fie beftand auch in der Kunft, die Töne fo tief in den Stoffen einzuprägen, daß
diefe den Lufteinflüffen und den wiederholten Wafchungen widerftehen konnten. In diefer
Beziehung waren die Kattundrucker, die ihre Stoffe echt färbten — oder wie die Werk-
führer einfehrieben; gui travaillaient en bon teint —, hervorragende Chemiker. Unauf-
hörlich waren fie befchäftigt, neue Rezepte zu entdecken und die alten zu vervollkommnen.
Sie unternahmen Reifen nach England und nach Schottland; fie ließen fichMufter aus der
Schweiz und aus Holland kommen; fie unterhielten ftändige Beziehungen mit den Gelehrten.
147
Seien es Deutfche
oder Schweizer, die
Gründung der erften
Werkftätten für Lein-
wandfärberei fteht ein-
zig und allein diefen
Eingewanderten zu. In
Marfeille eröffnete Jean-
Rodolphe Weiter eine
Fabrik im Jahre 1745,
Philippe Steffen grün-
dete die Manufaktur
Sainte Marie aux Mines
im Jahrel756, und 1757
wurde von Laurent
Weiter die Werkftätte
Orange gefchaffen.
Abraham Frey fteht das
Verdienft zu, im Jahre
1758 in Rouen eine
Fabrik aufgemacht zu
haben, und in Lyon
wurde die Induftrie der
Kattunfärberei von Picot und Fazy im Jahre 1772 eingeführt. Vor allem ift aber der Name des
Baiern Chriftophe Philippe Oberkampf der Nachwelt überliefert worden; diefer gründete
im Jahre 1760 in Jouy-en-Jofas, nahe bei Verfailles, die bekannte Manufaktur, deren Er-
zeugniffe fehr fchnell in ganz Europa einen hohen Ruf erlangten.
Aber ein anderer Punkt ift nodi bemerkenswert. Sogar in den Werkftätten, die von
Einheimifchen geleitet waren, im Puy (1756), inBourges, in Angers (1757), in Montpellier
(1760), in zwanzig anderen Städten waren die Zeichner, Stecher, Zubereiter, Koloriften,
Drucker, Rentreurs Ausländer und größtenteils Wanderkünftler. Sie trafen in den Fabriken
ein als Inhaber von Geheimniffen für die Färberei, die Zubereitung oder das Aufträgen der
Farben. Sie arbeiteten, ohne Lehrlinge auszubilden und fie verließen die Werkftätten, um
in anderen anzufangen, fobald ihnen ein höherer Lohn angeboten wurde. Viele hielten
fich in Frankreich nur während der fchönen Jahreszeit auf, und fobald ihre Arbeitszeit im
Sommer beendet war, kehrten fie ins Vaterland zurück, um dort ihren Verdienft zu ver-
zehren.
Trotj aller diefer Unannehmlichkeiten konnte man fie nicht entbehren. Die Kattun-
färberei war in der Tat jeßt nicht mehr allein dieKunft, auf einen Stoff Zeichnungen und
Farben zu übertragen — wie es im Mittelalter die Maler mit Hilfe der Form machten —
nein, fie beftand auch in der Kunft, die Töne fo tief in den Stoffen einzuprägen, daß
diefe den Lufteinflüffen und den wiederholten Wafchungen widerftehen konnten. In diefer
Beziehung waren die Kattundrucker, die ihre Stoffe echt färbten — oder wie die Werk-
führer einfehrieben; gui travaillaient en bon teint —, hervorragende Chemiker. Unauf-
hörlich waren fie befchäftigt, neue Rezepte zu entdecken und die alten zu vervollkommnen.
Sie unternahmen Reifen nach England und nach Schottland; fie ließen fichMufter aus der
Schweiz und aus Holland kommen; fie unterhielten ftändige Beziehungen mit den Gelehrten.
147