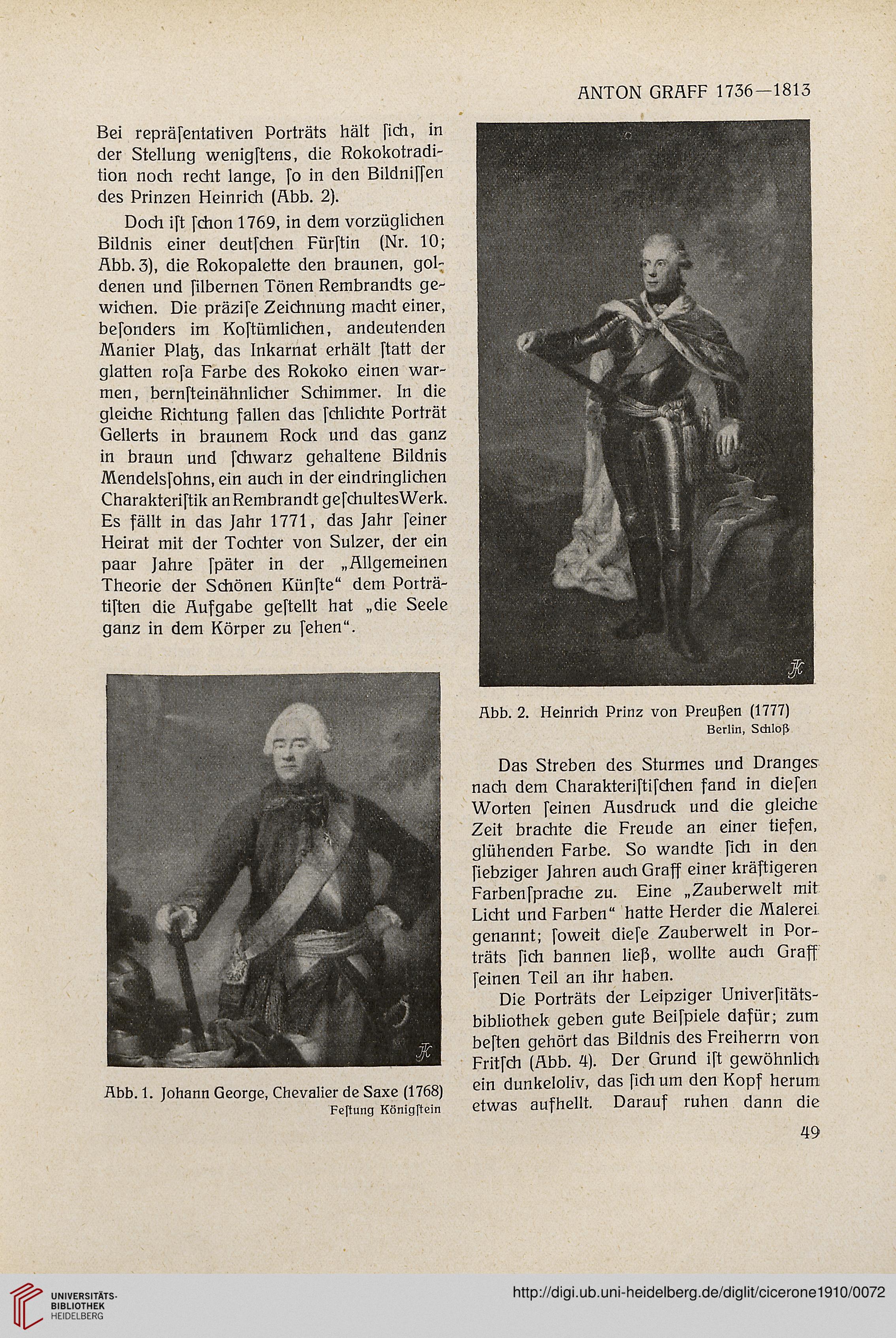Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 2.1910
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.24116#0072
DOI Heft:
2. Heft
DOI Artikel:Landsberger, Franz: Anton Graff 1736-1813: zur Ausstellung bei Eduard Schulte
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24116#0072
ANTON GRAFF 1736—1813
Bei repräfentativen Porträts hält [ich, in
der Stellung wenigftens, die Rokokotradi-
tion noch recht lange, fo in den Bildniffen
des Prinzen Heinrich (Abb. 2).
Doch ift fchon 1769, in dem vorzüglichen
Bildnis einer deutfchen Fürftin (Nr. 10;
Abb. 3), die Rokopalette den braunen, gol-
denen und filbernen Tönen Rembrandts ge-
wichen. Die präzife Zeichnung macht einer,
befonders im Koftümlichen, andeutenden
Manier Platj, das Inkarnat erhält [tatt der
glatten rofa Farbe des Rokoko einen war-
men, bernfteinähnlicher Schimmer. In die
gleiche Richtung fallen das fchlichte Porträt
Gellerts in braunem Rock und das ganz
in braun und fchwarz gehaltene Bildnis
Mendelsfohns, ein auch in der eindringlichen
Charakteriftik anRembrandt gefchultesWerk.
Es fällt in das Jahr 1771, das Jahr feiner
Heirat mit der Tochter von Sulzer, der ein
paar Jahre fpäter in der „Allgemeinen
Theorie der Schönen Künfte“ dem Porträ-
tiften die Aufgabe geftellt hat „die Seele
ganz in dem Körper zu fehen“.
Abb. 1. Johann George, Chevalier de Saxe (1768)
Feftung Königftein
Äbb. 2. Heinrich Prinz von Preußen (1777)
Berlin, Schloß
Das Streben des Sturmes und Dranges
nach dem Charakteriftifchen fand in diefen
Worten feinen Ausdruck und die gleiche
Zeit brachte die Freude an einer tiefen,
glühenden Farbe. So wandte fich in den
fiebziger Jahren auch Graff einer kräftigeren
Farbenfprache zu. Eine „Zauberwelt mit
Licht und Farben“ hatte Herder die Malerei
genannt; foweit diefe Zauberwelt in Por-
träts fich bannen ließ, wollte auch Graff
feinen Teil an ihr haben.
Die Porträts der Leipziger Univerfitäts-
bibliothek geben gute Beifpiele dafür; zum
beften gehört das Bildnis des Freiherrn von
Fritfch (Abb. 4). Der Grund ift gewöhnlich
ein dunkeloliv, das fich um den Kopf herum
etwas aufhellt. Darauf ruhen dann die
49
Bei repräfentativen Porträts hält [ich, in
der Stellung wenigftens, die Rokokotradi-
tion noch recht lange, fo in den Bildniffen
des Prinzen Heinrich (Abb. 2).
Doch ift fchon 1769, in dem vorzüglichen
Bildnis einer deutfchen Fürftin (Nr. 10;
Abb. 3), die Rokopalette den braunen, gol-
denen und filbernen Tönen Rembrandts ge-
wichen. Die präzife Zeichnung macht einer,
befonders im Koftümlichen, andeutenden
Manier Platj, das Inkarnat erhält [tatt der
glatten rofa Farbe des Rokoko einen war-
men, bernfteinähnlicher Schimmer. In die
gleiche Richtung fallen das fchlichte Porträt
Gellerts in braunem Rock und das ganz
in braun und fchwarz gehaltene Bildnis
Mendelsfohns, ein auch in der eindringlichen
Charakteriftik anRembrandt gefchultesWerk.
Es fällt in das Jahr 1771, das Jahr feiner
Heirat mit der Tochter von Sulzer, der ein
paar Jahre fpäter in der „Allgemeinen
Theorie der Schönen Künfte“ dem Porträ-
tiften die Aufgabe geftellt hat „die Seele
ganz in dem Körper zu fehen“.
Abb. 1. Johann George, Chevalier de Saxe (1768)
Feftung Königftein
Äbb. 2. Heinrich Prinz von Preußen (1777)
Berlin, Schloß
Das Streben des Sturmes und Dranges
nach dem Charakteriftifchen fand in diefen
Worten feinen Ausdruck und die gleiche
Zeit brachte die Freude an einer tiefen,
glühenden Farbe. So wandte fich in den
fiebziger Jahren auch Graff einer kräftigeren
Farbenfprache zu. Eine „Zauberwelt mit
Licht und Farben“ hatte Herder die Malerei
genannt; foweit diefe Zauberwelt in Por-
träts fich bannen ließ, wollte auch Graff
feinen Teil an ihr haben.
Die Porträts der Leipziger Univerfitäts-
bibliothek geben gute Beifpiele dafür; zum
beften gehört das Bildnis des Freiherrn von
Fritfch (Abb. 4). Der Grund ift gewöhnlich
ein dunkeloliv, das fich um den Kopf herum
etwas aufhellt. Darauf ruhen dann die
49