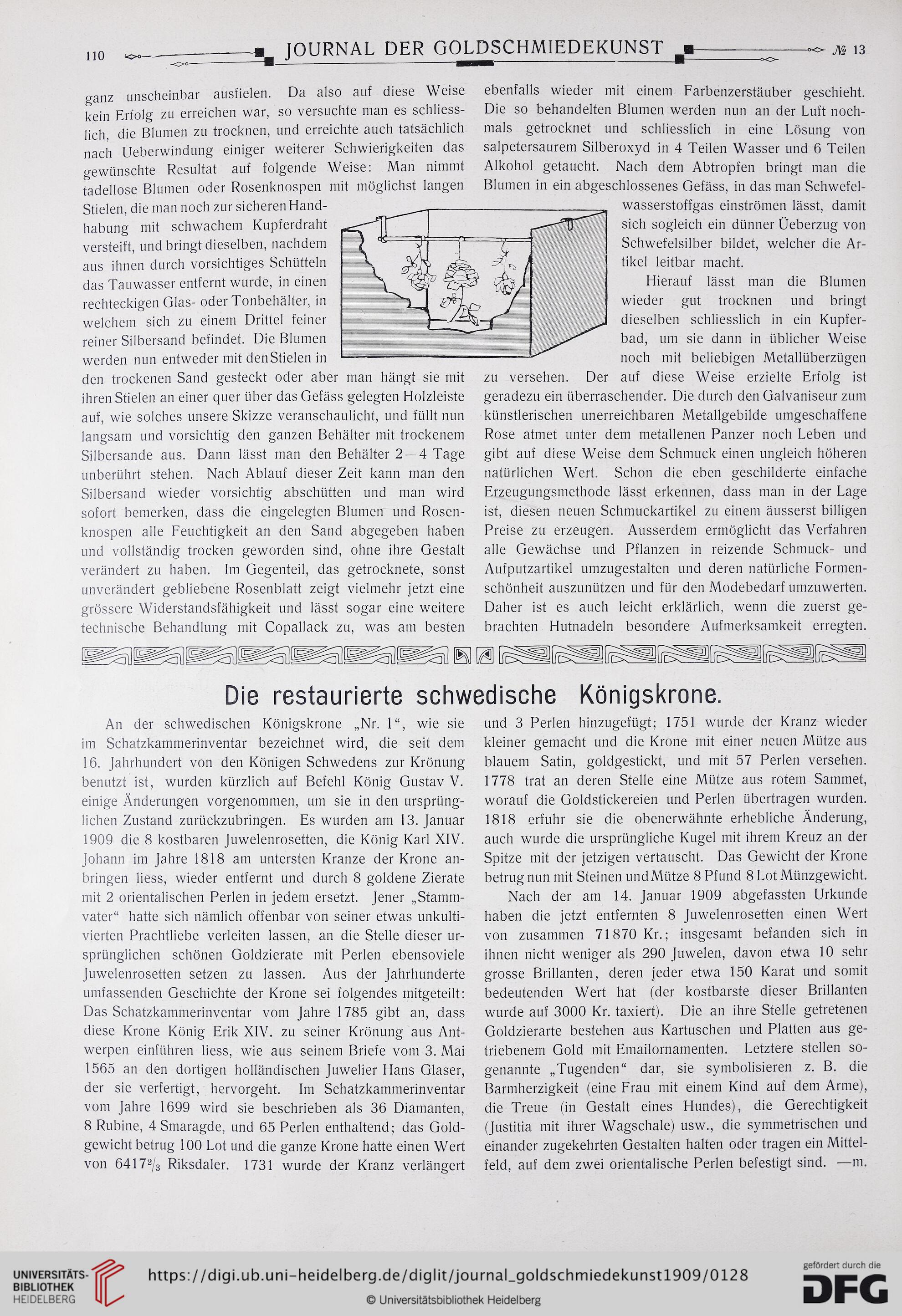JOURNAL DER GOLDSCHMIEDEKUNST
JVs 13
110
ganz unscheinbar ausfielen. Da also auf diese Weise
kein Erfolg zu erreichen war, so versuchte man es schliess-
lich, die Blumen zu trocknen, und erreichte auch tatsächlich
nach Ueberwindung einiger weiterer Schwierigkeiten das
gewünschte Resultat auf folgende Weise: Man nimmt
tadellose Blumen oder Rosenknospen mit möglichst langen
ebenfalls wieder mit einem Farbenzerstäuber geschieht.
Die so behandelten Blumen werden nun an der Luft noch-
mals getrocknet und schliesslich in eine Lösung von
salpetersaurem Silberoxyd in 4 Teilen Wasser und 6 Teilen
Alkohol getaucht. Nach dem Abtropfen bringt man die
Blumen in ein abgeschlossenes Gefäss, in das man Schwefel-
Stielen, die man noch zur sicheren Hand-
habung mit schwachem Kupferdraht
versteift, und bringt dieselben, nachdem
aus ihnen durch vorsichtiges Schütteln
das Tauwasser entfernt wurde, in einen
rechteckigen Glas- oder Tonbehälter, in
welchem sich zu einem Drittel feiner
reiner Silbersand befindet. Die Blumen
werden nun entweder mit denStielen in
wasserstoffgas einströmen lässt, damit
sich sogleich ein dünner Üeberzug von
Schwefelsilber bildet, welcher die Ar-
tikel leitbar macht.
Hierauf lässt man die Blumen
wieder gut trocknen und bringt
dieselben schliesslich in ein Kupfer-
bad, um sie dann in üblicher Weise
noch mit beliebigen Metallüberzügen
den trockenen Sand gesteckt oder aber man hängt sie mit
ihren Stielen an einer quer über das Gefäss gelegten Holzleiste
auf, wie solches unsere Skizze veranschaulicht, und füllt nun
langsam und vorsichtig den ganzen Behälter mit trockenem
Silbersande aus. Dann lässt man den Behälter 2 — 4 Tage
unberührt stehen. Nach Ablauf dieser Zeit kann man den
Silbersand wieder vorsichtig abschütten und man wird
sofort bemerken, dass die eingelegten Blumen und Rosen-
knospen alle Feuchtigkeit an den Sand abgegeben haben
und vollständig trocken geworden sind, ohne ihre Gestalt
verändert zu haben. Im Gegenteil, das getrocknete, sonst
unverändert gebliebene Rosenblatt zeigt vielmehr jetzt eine
grössere Widerstandsfähigkeit und lässt sogar eine weitere
technische Behandlung mit Copallack zu, was am besten
zu versehen. Der auf diese Weise erzielte Erfolg ist
geradezu ein überraschender. Die durch den Galvaniseur zum
künstlerischen unerreichbaren Metallgebilde umgeschaffene
Rose atmet unter dem metallenen Panzer noch Leben und
gibt auf diese Weise dem Schmuck einen ungleich höheren
natürlichen Wert. Schon die eben geschilderte einfache
Erzeugungsmethode lässt erkennen, dass man in der Lage
ist, diesen neuen Schmuckartikel zu einem äusserst billigen
Preise zu erzeugen. Ausserdem ermöglicht das Verfahren
alle Gewächse und Pflanzen in reizende Schmuck- und
Aufputzartikel umzugestalten und deren natürliche Formen-
schönheit auszunützen und für den Modebedarf umzuwerten.
Daher ist es auch leicht erklärlich, wenn die zuerst ge-
brachten Hutnadeln besondere Aufmerksamkeit erregten.
Die restaurierte schwedische Königskrone.
An der schwedischen Königskrone „Nr. 1“, wie sie
im Schatzkammerinventar bezeichnet wird, die seit dem
16. Jahrhundert von den Königen Schwedens zur Krönung
benutzt ist, wurden kürzlich auf Befehl König Gustav V.
einige Änderungen vorgenommen, um sie in den ursprüng-
lichen Zustand zurückzubringen. Es wurden am 13. Januar
1909 die 8 kostbaren Juwelenrosetten, die König Karl XIV.
Johann im Jahre 1818 am untersten Kranze der Krone an-
bringen liess, wieder entfernt und durch 8 goldene Zierate
mit 2 orientalischen Perlen in jedem ersetzt. Jener „Stamm-
vater“ hatte sich nämlich offenbar von seiner etwas unkulti-
vierten Prachtliebe verleiten lassen, an die Stelle dieser ur-
sprünglichen schönen Goldzierate mit Perlen ebensoviele
Juwelenrosetten setzen zu lassen. Aus der Jahrhunderte
umfassenden Geschichte der Krone sei folgendes mitgeteilt:
Das Schatzkammerinventar vom Jahre 1785 gibt an, dass
diese Krone König Erik XIV. zu seiner Krönung aus Ant-
werpen einführen liess, wie aus seinem Briefe vom 3. Mai
1565 an den dortigen holländischen Juwelier Hans Glaser,
der sie verfertigt, hervorgeht. Im Schatzkammerinventar
vom Jahre 1699 wird sie beschrieben als 36 Diamanten,
8 Rubine, 4 Smaragde, und 65 Perlen enthaltend; das Gold-
gewichtbetrug 100 Lot und die ganze Krone hatte einen Wert
von 64172/3 Riksdaler. 1731 wurde der Kranz verlängert
und 3 Perlen hinzugefügt; 1751 wurde der Kranz wieder
kleiner gemacht und die Krone mit einer neuen Mütze aus
blauem Satin, goldgestickt, und mit 57 Perlen versehen.
1778 trat an deren Stelle eine Mütze aus rotem Sammet,
worauf die Goldstickereien und Perlen übertragen wurden.
1818 erfuhr sie die obenerwähnte erhebliche Änderung,
auch wurde die ursprüngliche Kugel mit ihrem Kreuz an der
Spitze mit der jetzigen vertauscht. Das Gewicht der Krone
betrug nun mit Steinen und Mütze 8 Pfund 8 Lot Münzgewicht.
Nach der am 14. Januar 1909 abgefassten Urkunde
haben die jetzt entfernten 8 Juwelenrosetten einen Wert
von zusammen 71870 Kr.; insgesamt befanden sich in
ihnen nicht weniger als 290 Juwelen, davon etwa 10 sehr
grosse Brillanten, deren jeder etwa 150 Karat und somit
bedeutenden Wert hat (der kostbarste dieser Brillanten
wurde auf 3000 Kr. taxiert). Die an ihre Stelle getretenen
Goldzierarte bestehen aus Kartuschen und Platten aus ge-
triebenem Gold mit Emailornamenten. Letztere stellen so-
genannte „Tugenden“ dar, sie symbolisieren z. B. die
Barmherzigkeit (eine Frau mit einem Kind auf dem Arme),
die Treue (in Gestalt eines Hundes), die Gerechtigkeit
(Justitia mit ihrer Wagschale) usw., die symmetrischen und
einander zugekehrten Gestalten halten oder tragen ein Mittel-
feld, auf dem zwei orientalische Perlen befestigt sind. —m.
JVs 13
110
ganz unscheinbar ausfielen. Da also auf diese Weise
kein Erfolg zu erreichen war, so versuchte man es schliess-
lich, die Blumen zu trocknen, und erreichte auch tatsächlich
nach Ueberwindung einiger weiterer Schwierigkeiten das
gewünschte Resultat auf folgende Weise: Man nimmt
tadellose Blumen oder Rosenknospen mit möglichst langen
ebenfalls wieder mit einem Farbenzerstäuber geschieht.
Die so behandelten Blumen werden nun an der Luft noch-
mals getrocknet und schliesslich in eine Lösung von
salpetersaurem Silberoxyd in 4 Teilen Wasser und 6 Teilen
Alkohol getaucht. Nach dem Abtropfen bringt man die
Blumen in ein abgeschlossenes Gefäss, in das man Schwefel-
Stielen, die man noch zur sicheren Hand-
habung mit schwachem Kupferdraht
versteift, und bringt dieselben, nachdem
aus ihnen durch vorsichtiges Schütteln
das Tauwasser entfernt wurde, in einen
rechteckigen Glas- oder Tonbehälter, in
welchem sich zu einem Drittel feiner
reiner Silbersand befindet. Die Blumen
werden nun entweder mit denStielen in
wasserstoffgas einströmen lässt, damit
sich sogleich ein dünner Üeberzug von
Schwefelsilber bildet, welcher die Ar-
tikel leitbar macht.
Hierauf lässt man die Blumen
wieder gut trocknen und bringt
dieselben schliesslich in ein Kupfer-
bad, um sie dann in üblicher Weise
noch mit beliebigen Metallüberzügen
den trockenen Sand gesteckt oder aber man hängt sie mit
ihren Stielen an einer quer über das Gefäss gelegten Holzleiste
auf, wie solches unsere Skizze veranschaulicht, und füllt nun
langsam und vorsichtig den ganzen Behälter mit trockenem
Silbersande aus. Dann lässt man den Behälter 2 — 4 Tage
unberührt stehen. Nach Ablauf dieser Zeit kann man den
Silbersand wieder vorsichtig abschütten und man wird
sofort bemerken, dass die eingelegten Blumen und Rosen-
knospen alle Feuchtigkeit an den Sand abgegeben haben
und vollständig trocken geworden sind, ohne ihre Gestalt
verändert zu haben. Im Gegenteil, das getrocknete, sonst
unverändert gebliebene Rosenblatt zeigt vielmehr jetzt eine
grössere Widerstandsfähigkeit und lässt sogar eine weitere
technische Behandlung mit Copallack zu, was am besten
zu versehen. Der auf diese Weise erzielte Erfolg ist
geradezu ein überraschender. Die durch den Galvaniseur zum
künstlerischen unerreichbaren Metallgebilde umgeschaffene
Rose atmet unter dem metallenen Panzer noch Leben und
gibt auf diese Weise dem Schmuck einen ungleich höheren
natürlichen Wert. Schon die eben geschilderte einfache
Erzeugungsmethode lässt erkennen, dass man in der Lage
ist, diesen neuen Schmuckartikel zu einem äusserst billigen
Preise zu erzeugen. Ausserdem ermöglicht das Verfahren
alle Gewächse und Pflanzen in reizende Schmuck- und
Aufputzartikel umzugestalten und deren natürliche Formen-
schönheit auszunützen und für den Modebedarf umzuwerten.
Daher ist es auch leicht erklärlich, wenn die zuerst ge-
brachten Hutnadeln besondere Aufmerksamkeit erregten.
Die restaurierte schwedische Königskrone.
An der schwedischen Königskrone „Nr. 1“, wie sie
im Schatzkammerinventar bezeichnet wird, die seit dem
16. Jahrhundert von den Königen Schwedens zur Krönung
benutzt ist, wurden kürzlich auf Befehl König Gustav V.
einige Änderungen vorgenommen, um sie in den ursprüng-
lichen Zustand zurückzubringen. Es wurden am 13. Januar
1909 die 8 kostbaren Juwelenrosetten, die König Karl XIV.
Johann im Jahre 1818 am untersten Kranze der Krone an-
bringen liess, wieder entfernt und durch 8 goldene Zierate
mit 2 orientalischen Perlen in jedem ersetzt. Jener „Stamm-
vater“ hatte sich nämlich offenbar von seiner etwas unkulti-
vierten Prachtliebe verleiten lassen, an die Stelle dieser ur-
sprünglichen schönen Goldzierate mit Perlen ebensoviele
Juwelenrosetten setzen zu lassen. Aus der Jahrhunderte
umfassenden Geschichte der Krone sei folgendes mitgeteilt:
Das Schatzkammerinventar vom Jahre 1785 gibt an, dass
diese Krone König Erik XIV. zu seiner Krönung aus Ant-
werpen einführen liess, wie aus seinem Briefe vom 3. Mai
1565 an den dortigen holländischen Juwelier Hans Glaser,
der sie verfertigt, hervorgeht. Im Schatzkammerinventar
vom Jahre 1699 wird sie beschrieben als 36 Diamanten,
8 Rubine, 4 Smaragde, und 65 Perlen enthaltend; das Gold-
gewichtbetrug 100 Lot und die ganze Krone hatte einen Wert
von 64172/3 Riksdaler. 1731 wurde der Kranz verlängert
und 3 Perlen hinzugefügt; 1751 wurde der Kranz wieder
kleiner gemacht und die Krone mit einer neuen Mütze aus
blauem Satin, goldgestickt, und mit 57 Perlen versehen.
1778 trat an deren Stelle eine Mütze aus rotem Sammet,
worauf die Goldstickereien und Perlen übertragen wurden.
1818 erfuhr sie die obenerwähnte erhebliche Änderung,
auch wurde die ursprüngliche Kugel mit ihrem Kreuz an der
Spitze mit der jetzigen vertauscht. Das Gewicht der Krone
betrug nun mit Steinen und Mütze 8 Pfund 8 Lot Münzgewicht.
Nach der am 14. Januar 1909 abgefassten Urkunde
haben die jetzt entfernten 8 Juwelenrosetten einen Wert
von zusammen 71870 Kr.; insgesamt befanden sich in
ihnen nicht weniger als 290 Juwelen, davon etwa 10 sehr
grosse Brillanten, deren jeder etwa 150 Karat und somit
bedeutenden Wert hat (der kostbarste dieser Brillanten
wurde auf 3000 Kr. taxiert). Die an ihre Stelle getretenen
Goldzierarte bestehen aus Kartuschen und Platten aus ge-
triebenem Gold mit Emailornamenten. Letztere stellen so-
genannte „Tugenden“ dar, sie symbolisieren z. B. die
Barmherzigkeit (eine Frau mit einem Kind auf dem Arme),
die Treue (in Gestalt eines Hundes), die Gerechtigkeit
(Justitia mit ihrer Wagschale) usw., die symmetrischen und
einander zugekehrten Gestalten halten oder tragen ein Mittel-
feld, auf dem zwei orientalische Perlen befestigt sind. —m.