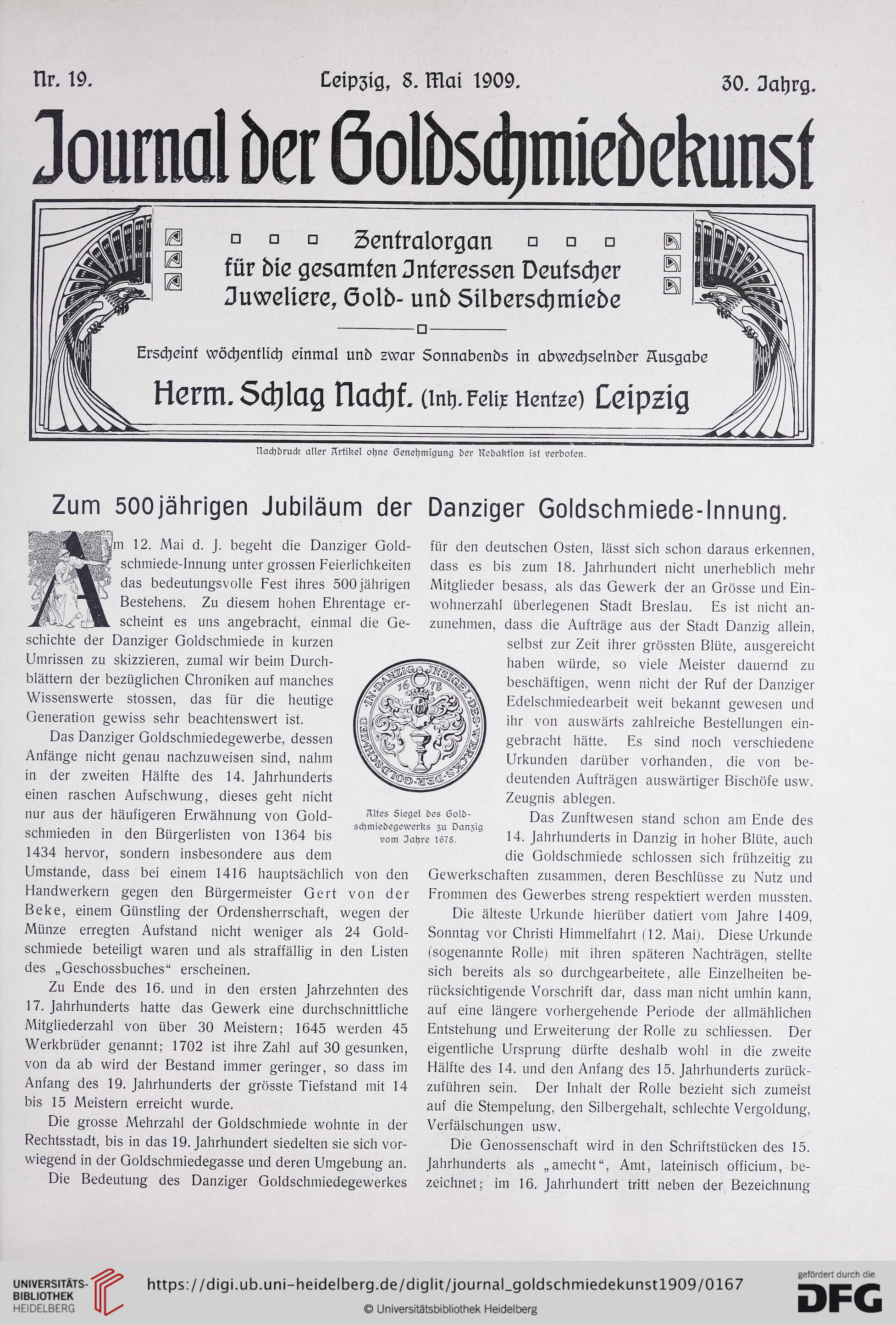Journal der Goldschmiedekunst: ill. Fachzeitschr. für Juweliere, Gold- u. Silberschmiede u. d. Bijouterie-Industrie ; Zentralorgan für d. Interessen dt. Juweliere, Gold- u. Silberschmiede .. — 30.1909
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.55857#0167
DOI Heft:
Nr. 19
DOI Artikel:Zum 500 jährigen Jubiläum der Danziger Goldschmiede-Innung
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.55857#0167
Ur. 19.
Ccipjig, 8. Hai 1909.
30. Datirg.
Journal bei Oolbsdjmiebekunst
riadjbruck aller Artikel otjne Genehmigung ber Rebakfion ist verboten.
Zum 500jährigen Jubiläum der
Danziger Goldschmiede-Innung.
m 12. Mai d. J. begeht die Danziger Gold-
schmiede-Innung unter grossen Feierlichkeiten
das bedeutungsvolle Fest ihres 500 jährigen
Bestehens. Zu diesem hohen Ehrentage er-
scheint es uns angebracht, einmal die Ge-
für den deutschen Osten, lässt sich schon daraus erkennen,
dass es bis zum 18. Jahrhundert nicht unerheblich mehr
Mitglieder besass, als das Gewerk der an Grösse und Ein-
wohnerzahl überlegenen Stadt Breslau. Es ist nicht an-
zunehmen, dass die Aufträge aus der Stadt Danzig allein,
schichte der Danziger Goldschmiede in kurzen
Umrissen zu skizzieren, zumal wir beim Durch-
blättern der bezüglichen Chroniken auf manches
Wissenswerte stossen, das für die heutige
Generation gewiss sehr beachtenswert ist.
Das Danziger Goldschmiedegewerbe, dessen
Anfänge nicht genau nachzuweisen sind, nahm
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
einen raschen Aufschwung, dieses geht nicht
nur aus der häufigeren Erwähnung von Gold-
schmieden in den Bürgerlisten von 1364 bis
1434 hervor, sondern insbesondere aus dem
Umstande, dass bei einem 1416 hauptsächlich
Altes Siegel bes Golb-
sdjmisbegewerks ju Danjig
vom Galjre 1678.
selbst zur Zeit ihrer grössten Blüte, ausgereicht
haben würde, so viele Meister dauernd zu
beschäftigen, wenn nicht der Ruf der Danziger
Edelschmiedearbeit weit bekannt gewesen und
ihr von auswärts zahlreiche Bestellungen ein-
gebracht hätte. Es sind noch verschiedene
Urkunden darüber vorhanden, die von be-
deutenden Aufträgen auswärtiger Bischöfe usw.
Zeugnis ablegen.
Das Zunftwesen stand schon am Ende des
14. Jahrhunderts in Danzig in hoher Blüte, auch
die Goldschmiede schlossen sich frühzeitig zu
von den Gewerkschaften zusammen, deren Beschlüsse zu Nutz und
Handwerkern gegen den Bürgermeister Gert von der
Beke, einem Günstling der Ordensherrschaft, wegen der
Münze erregten Aufstand nicht weniger als 24 Gold-
schmiede beteiligt waren und als straffällig in den Listen
des „Geschossbuches“ erscheinen.
Zu Ende des 16. und in den ersten Jahrzehnten des
17. Jahrhunderts hatte das Gewerk eine durchschnittliche
Frommen des Gewerbes streng respektiert werden mussten.
Die älteste Urkunde hierüber datiert vom Jahre 1409,
Sonntag vor Christi Himmelfahrt (12. Mai). Diese Urkunde
(sogenannte Rolle) mit ihren späteren Nachträgen, stellte
sich bereits als so durchgearbeitete, alle Einzelheiten be-
rücksichtigende Vorschrift dar, dass man nicht umhin kann,
auf eine längere vorhergehende Periode der allmählichen
Mitgliederzahl von über 30 Meistern; 1645 werden 45
Werkbrüder genannt; 1702 ist ihre Zahl auf 30 gesunken,
Entstehung und Erweiterung der Rolle zu schliessen. Der
eigentliche Ursprung dürfte deshalb wohl in die zweite
von da ab wird der Bestand immer geringer, so dass im
Anfang des 19. Jahrhunderts der grösste Tiefstand mit 14
bis 15 Meistern erreicht wurde.
Die grosse Mehrzahl der Goldschmiede wohnte in der
Rechtsstadt, bis in das 19. Jahrhundert siedelten sie sich vor-
wiegend in der Goldschmiedegasse und deren Umgebung an.
Die Bedeutung des Danziger Goldschmiedegewerkes
Hälfte des 14. und den Anfang des 15. Jahrhunderts zurück-
zuführen sein. Der Inhalt der Rolle bezieht sich zumeist
auf die Stempelung, den Silbergehalt, schlechte Vergoldung,
Verfälschungen usw.
Die Genossenschaft wird in den Schriftstücken des 15.
Jahrhunderts als „amecht“, Amt, lateinisch officium, be-
zeichnet; im 16. Jahrhundert tritt neben der Bezeichnung
Ccipjig, 8. Hai 1909.
30. Datirg.
Journal bei Oolbsdjmiebekunst
riadjbruck aller Artikel otjne Genehmigung ber Rebakfion ist verboten.
Zum 500jährigen Jubiläum der
Danziger Goldschmiede-Innung.
m 12. Mai d. J. begeht die Danziger Gold-
schmiede-Innung unter grossen Feierlichkeiten
das bedeutungsvolle Fest ihres 500 jährigen
Bestehens. Zu diesem hohen Ehrentage er-
scheint es uns angebracht, einmal die Ge-
für den deutschen Osten, lässt sich schon daraus erkennen,
dass es bis zum 18. Jahrhundert nicht unerheblich mehr
Mitglieder besass, als das Gewerk der an Grösse und Ein-
wohnerzahl überlegenen Stadt Breslau. Es ist nicht an-
zunehmen, dass die Aufträge aus der Stadt Danzig allein,
schichte der Danziger Goldschmiede in kurzen
Umrissen zu skizzieren, zumal wir beim Durch-
blättern der bezüglichen Chroniken auf manches
Wissenswerte stossen, das für die heutige
Generation gewiss sehr beachtenswert ist.
Das Danziger Goldschmiedegewerbe, dessen
Anfänge nicht genau nachzuweisen sind, nahm
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
einen raschen Aufschwung, dieses geht nicht
nur aus der häufigeren Erwähnung von Gold-
schmieden in den Bürgerlisten von 1364 bis
1434 hervor, sondern insbesondere aus dem
Umstande, dass bei einem 1416 hauptsächlich
Altes Siegel bes Golb-
sdjmisbegewerks ju Danjig
vom Galjre 1678.
selbst zur Zeit ihrer grössten Blüte, ausgereicht
haben würde, so viele Meister dauernd zu
beschäftigen, wenn nicht der Ruf der Danziger
Edelschmiedearbeit weit bekannt gewesen und
ihr von auswärts zahlreiche Bestellungen ein-
gebracht hätte. Es sind noch verschiedene
Urkunden darüber vorhanden, die von be-
deutenden Aufträgen auswärtiger Bischöfe usw.
Zeugnis ablegen.
Das Zunftwesen stand schon am Ende des
14. Jahrhunderts in Danzig in hoher Blüte, auch
die Goldschmiede schlossen sich frühzeitig zu
von den Gewerkschaften zusammen, deren Beschlüsse zu Nutz und
Handwerkern gegen den Bürgermeister Gert von der
Beke, einem Günstling der Ordensherrschaft, wegen der
Münze erregten Aufstand nicht weniger als 24 Gold-
schmiede beteiligt waren und als straffällig in den Listen
des „Geschossbuches“ erscheinen.
Zu Ende des 16. und in den ersten Jahrzehnten des
17. Jahrhunderts hatte das Gewerk eine durchschnittliche
Frommen des Gewerbes streng respektiert werden mussten.
Die älteste Urkunde hierüber datiert vom Jahre 1409,
Sonntag vor Christi Himmelfahrt (12. Mai). Diese Urkunde
(sogenannte Rolle) mit ihren späteren Nachträgen, stellte
sich bereits als so durchgearbeitete, alle Einzelheiten be-
rücksichtigende Vorschrift dar, dass man nicht umhin kann,
auf eine längere vorhergehende Periode der allmählichen
Mitgliederzahl von über 30 Meistern; 1645 werden 45
Werkbrüder genannt; 1702 ist ihre Zahl auf 30 gesunken,
Entstehung und Erweiterung der Rolle zu schliessen. Der
eigentliche Ursprung dürfte deshalb wohl in die zweite
von da ab wird der Bestand immer geringer, so dass im
Anfang des 19. Jahrhunderts der grösste Tiefstand mit 14
bis 15 Meistern erreicht wurde.
Die grosse Mehrzahl der Goldschmiede wohnte in der
Rechtsstadt, bis in das 19. Jahrhundert siedelten sie sich vor-
wiegend in der Goldschmiedegasse und deren Umgebung an.
Die Bedeutung des Danziger Goldschmiedegewerkes
Hälfte des 14. und den Anfang des 15. Jahrhunderts zurück-
zuführen sein. Der Inhalt der Rolle bezieht sich zumeist
auf die Stempelung, den Silbergehalt, schlechte Vergoldung,
Verfälschungen usw.
Die Genossenschaft wird in den Schriftstücken des 15.
Jahrhunderts als „amecht“, Amt, lateinisch officium, be-
zeichnet; im 16. Jahrhundert tritt neben der Bezeichnung