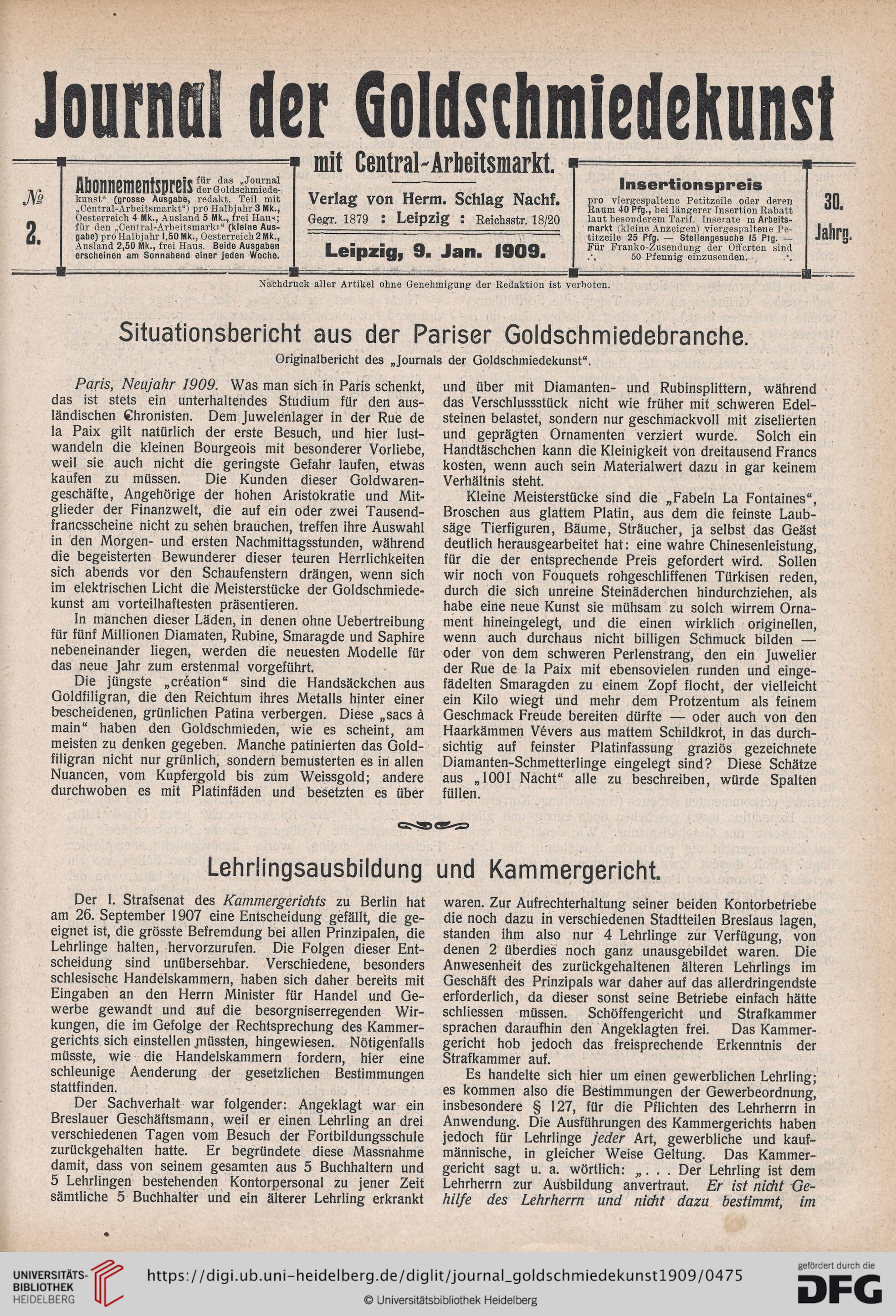Journal der Goldschmiedekunst
X»
2.
Abonnementspreis der Goldschmiede-
kunst“ (grosse Ausgabe, redakt. Teil mit
„Central-Arbeitsmarkt“) pro Halbjahr 3 Mk.,
Oesterreich 4 Mk., Ausland 5 Mk., frei Hau-<;
für den „Central-Arbeitsmarkt“ (kleine Aus-
gabe) pro Halbjahr 1,50 Mk., Oesterreich 2 Mk.,
Ausland 2,50 Mk., frei Haus. Beide Ausgaben
erscheinen am Sonnabend einer jeden Woche.
mit Central-Ärheitsmarkt.
Verlag von Herrn. Schlag Nachf.
Gegr. 1879 : Leipzig : Reichsstr. 18/20
Leipzig, 9. Jan. 1909.
Insertionspreis
pro viergespaltene Petitzeile oder deren
Raum 40 Pfg., bei längerer Insertion Rabatt
laut besonderem Tarif. Inserate m Arbeits-
markt (kleine Anzeigen) viergespaltene Pe-
titzeile 25 Pfg. — Stellengesuche 15 Ptg. —
Für Franko-Zusendung der Offerten sind
50 Pfennig einzusenden.
30.
Jahrs.
Nachdruck aller Artikel ohne Genehmigung der Redaktion ist verboten.
und über mit Diamanten- und Rubinsplittern, während
das Verschlussstück nicht wie früher mit schweren Edel-
steinen belastet, sondern nur geschmackvoll mit ziselierten
und geprägten Ornamenten verziert wurde. Solch ein
Handtäschchen kann die Kleinigkeit von dreitausend Francs
kosten, wenn auch sein Materialwert dazu in gar keinem
Verhältnis steht.
Kleine Meisterstücke sind die „Fabeln La Fontaines“,
Broschen aus glattem Platin, aus dem die feinste Laub-
säge Tierfiguren, Bäume, Sträucher, ja selbst das Geäst
deutlich herausgearbeitet hat: eine wahre Chinesenleistung,
für die der entsprechende Preis gefordert wird. Sollen
wir noch von Fouquets rohgeschliffenen Türkisen reden,
durch die sich unreine Steinäderchen hindurchziehen, als
habe eine neue Kunst sie mühsam zu solch wirrem Orna-
ment hineingelegt, und die einen wirklich originellen,
wenn auch durchaus nicht billigen Schmuck bilden —
oder von dem schweren Perlenstrang, den ein Juwelier
der Rue de la Paix mit ebensovielen runden und einge-
fädelten Smaragden zu einem Zopf flocht, der vielleicht
ein Kilo wiegt und mehr dem Protzentum als feinem
Geschmack Freude bereiten dürfte — oder auch von den
Haarkämmen V&vers aus mattem Schildkrot, in das durch-
sichtig auf feinster Platinfassung graziös gezeichnete
Diamanten-Schmetterlinge eingelegt sind? Diese Schätze
aus „1001 Nacht“ alle zu beschreiben, würde Spalten
füllen.
Paris, Neujahr 1909. Was man sich in Paris schenkt,
das ist stets ein unterhaltendes Studium für den aus-
ländischen Chronisten. Dem Juwelenlager in der Rue de
la Paix gilt natürlich der erste Besuch, und hier lust-
wandeln die kleinen Bourgeois mit besonderer Vorliebe,
weil sie auch nicht die geringste Gefahr laufen, etwas
kaufen zu müssen. Die Kunden dieser Goldwaren-
geschäfte, Angehörige der hohen Aristokratie und Mit-
glieder der Finanzwelt, die auf ein oder zwei Tausend-
francsscheine nicht zu sehen brauchen, treffen ihre Auswahl
in den Morgen- und ersten Nachmittagsstunden, während
die begeisterten Bewunderer dieser teuren Herrlichkeiten
sich abends vor den Schaufenstern drängen, wenn sich
im elektrischen Licht die Meisterstücke der Goldschmiede-
kunst am vorteilhaftesten präsentieren.
In manchen dieser Läden, in denen ohne Uebertreibung
für fünf Millionen Diamaten, Rubine, Smaragde und Saphire
nebeneinander liegen, werden die neuesten Modelle für
das neue Jahr zum erstenmal vorgeführt.
Die jüngste „creation“ sind die Handsäckchen aus
Goldfiligran, die den Reichtum ihres Metalls hinter einer
bescheidenen, grünlichen Patina verbergen. Diese „sacs ä
main“ haben den Goldschmieden, wie es scheint, am
meisten zu denken gegeben. Manche patinierten das Gold-
filigran nicht nur grünlich, sondern bemusterten es in allen
Nuancen, vom Kupfergold bis zum Weissgold; andere
durchwoben es mit Platinfäden und besetzten es über
und Kammergericht.
waren. Zur Aufrechterhaltung seiner beiden Kontorbetriebe
die noch dazu in verschiedenen Stadtteilen Breslaus lagen,
standen ihm also nur 4 Lehrlinge zur Verfügung, von
denen 2 überdies noch ganz unausgebildet waren. Die
Anwesenheit des zurückgehaltenen älteren Lehrlings im
Geschäft des Prinzipals war daher auf das allerdringendste
erforderlich, da dieser sonst seine Betriebe einfach hätte
schliessen müssen. Schöffengericht und Strafkammer
sprachen daraufhin den Angeklagten frei. Das Kammer-
gericht hob jedoch das freisprechende Erkenntnis der
Strafkammer auf.
Es handelte sich hier um einen gewerblichen Lehrling;
es kommen also die Bestimmungen der Gewerbeordnung,
insbesondere § 127, für die Pflichten des Lehrherrn in
Anwendung. Die Ausführungen des Kammergerichts haben
jedoch für Lehrlinge jeder Art, gewerbliche und kauf-
männische, in gleicher Weise Geltung. Das Kammer-
gericht sagt u. a. wörtlich: „. . . Der Lehrling ist dem
Lehrherrn zur Ausbildung anvertraut. Er ist nicht Ge-
hilfe des Lehrherrn und nicht dazu bestimmt, im
Situationsbericht aus der Pariser Goldschmiedebranche.
Originalbericht des „Journals der Goldschmiedekunst“.
Lehrlingsausbildung
Der I. Strafsenat des Kammergerichts zu Berlin hat
am 26. September 1907 eine Entscheidung gefällt, die ge-
eignet ist, die grösste Befremdung bei allen Prinzipalen, die
Lehrlinge halten, hervorzurufen. Die Folgen dieser Ent-
scheidung sind unübersehbar. Verschiedene, besonders
schlesische Handelskammern, haben sich daher bereits mit
Eingaben an den Herrn Minister für Handel und Ge-
werbe gewandt und auf die besorgniserregenden Wir-
kungen, die im Gefolge der Rechtsprechung des Kammer-
gerichts sich einstellen jnüssten, hingewiesen. Nötigenfalls
müsste, wie die Handelskammern fordern, hier eine
schleunige Aenderung der gesetzlichen Bestimmungen
stattfinden.
Der Sachverhalt war folgender: Angeklagt war ein
Breslauer Geschäftsmann, weil er einen Lehrling an drei
verschiedenen Tagen vom Besuch der Fortbildungsschule
zurückgehalten hatte. Er begründete diese Massnahme
damit, dass von seinem gesamten aus 5 Buchhaltern und
5 Lehrlingen bestehenden Kontorpersonal zu jener Zeit
sämtliche 5 Buchhalter und ein älterer Lehrling erkrankt
X»
2.
Abonnementspreis der Goldschmiede-
kunst“ (grosse Ausgabe, redakt. Teil mit
„Central-Arbeitsmarkt“) pro Halbjahr 3 Mk.,
Oesterreich 4 Mk., Ausland 5 Mk., frei Hau-<;
für den „Central-Arbeitsmarkt“ (kleine Aus-
gabe) pro Halbjahr 1,50 Mk., Oesterreich 2 Mk.,
Ausland 2,50 Mk., frei Haus. Beide Ausgaben
erscheinen am Sonnabend einer jeden Woche.
mit Central-Ärheitsmarkt.
Verlag von Herrn. Schlag Nachf.
Gegr. 1879 : Leipzig : Reichsstr. 18/20
Leipzig, 9. Jan. 1909.
Insertionspreis
pro viergespaltene Petitzeile oder deren
Raum 40 Pfg., bei längerer Insertion Rabatt
laut besonderem Tarif. Inserate m Arbeits-
markt (kleine Anzeigen) viergespaltene Pe-
titzeile 25 Pfg. — Stellengesuche 15 Ptg. —
Für Franko-Zusendung der Offerten sind
50 Pfennig einzusenden.
30.
Jahrs.
Nachdruck aller Artikel ohne Genehmigung der Redaktion ist verboten.
und über mit Diamanten- und Rubinsplittern, während
das Verschlussstück nicht wie früher mit schweren Edel-
steinen belastet, sondern nur geschmackvoll mit ziselierten
und geprägten Ornamenten verziert wurde. Solch ein
Handtäschchen kann die Kleinigkeit von dreitausend Francs
kosten, wenn auch sein Materialwert dazu in gar keinem
Verhältnis steht.
Kleine Meisterstücke sind die „Fabeln La Fontaines“,
Broschen aus glattem Platin, aus dem die feinste Laub-
säge Tierfiguren, Bäume, Sträucher, ja selbst das Geäst
deutlich herausgearbeitet hat: eine wahre Chinesenleistung,
für die der entsprechende Preis gefordert wird. Sollen
wir noch von Fouquets rohgeschliffenen Türkisen reden,
durch die sich unreine Steinäderchen hindurchziehen, als
habe eine neue Kunst sie mühsam zu solch wirrem Orna-
ment hineingelegt, und die einen wirklich originellen,
wenn auch durchaus nicht billigen Schmuck bilden —
oder von dem schweren Perlenstrang, den ein Juwelier
der Rue de la Paix mit ebensovielen runden und einge-
fädelten Smaragden zu einem Zopf flocht, der vielleicht
ein Kilo wiegt und mehr dem Protzentum als feinem
Geschmack Freude bereiten dürfte — oder auch von den
Haarkämmen V&vers aus mattem Schildkrot, in das durch-
sichtig auf feinster Platinfassung graziös gezeichnete
Diamanten-Schmetterlinge eingelegt sind? Diese Schätze
aus „1001 Nacht“ alle zu beschreiben, würde Spalten
füllen.
Paris, Neujahr 1909. Was man sich in Paris schenkt,
das ist stets ein unterhaltendes Studium für den aus-
ländischen Chronisten. Dem Juwelenlager in der Rue de
la Paix gilt natürlich der erste Besuch, und hier lust-
wandeln die kleinen Bourgeois mit besonderer Vorliebe,
weil sie auch nicht die geringste Gefahr laufen, etwas
kaufen zu müssen. Die Kunden dieser Goldwaren-
geschäfte, Angehörige der hohen Aristokratie und Mit-
glieder der Finanzwelt, die auf ein oder zwei Tausend-
francsscheine nicht zu sehen brauchen, treffen ihre Auswahl
in den Morgen- und ersten Nachmittagsstunden, während
die begeisterten Bewunderer dieser teuren Herrlichkeiten
sich abends vor den Schaufenstern drängen, wenn sich
im elektrischen Licht die Meisterstücke der Goldschmiede-
kunst am vorteilhaftesten präsentieren.
In manchen dieser Läden, in denen ohne Uebertreibung
für fünf Millionen Diamaten, Rubine, Smaragde und Saphire
nebeneinander liegen, werden die neuesten Modelle für
das neue Jahr zum erstenmal vorgeführt.
Die jüngste „creation“ sind die Handsäckchen aus
Goldfiligran, die den Reichtum ihres Metalls hinter einer
bescheidenen, grünlichen Patina verbergen. Diese „sacs ä
main“ haben den Goldschmieden, wie es scheint, am
meisten zu denken gegeben. Manche patinierten das Gold-
filigran nicht nur grünlich, sondern bemusterten es in allen
Nuancen, vom Kupfergold bis zum Weissgold; andere
durchwoben es mit Platinfäden und besetzten es über
und Kammergericht.
waren. Zur Aufrechterhaltung seiner beiden Kontorbetriebe
die noch dazu in verschiedenen Stadtteilen Breslaus lagen,
standen ihm also nur 4 Lehrlinge zur Verfügung, von
denen 2 überdies noch ganz unausgebildet waren. Die
Anwesenheit des zurückgehaltenen älteren Lehrlings im
Geschäft des Prinzipals war daher auf das allerdringendste
erforderlich, da dieser sonst seine Betriebe einfach hätte
schliessen müssen. Schöffengericht und Strafkammer
sprachen daraufhin den Angeklagten frei. Das Kammer-
gericht hob jedoch das freisprechende Erkenntnis der
Strafkammer auf.
Es handelte sich hier um einen gewerblichen Lehrling;
es kommen also die Bestimmungen der Gewerbeordnung,
insbesondere § 127, für die Pflichten des Lehrherrn in
Anwendung. Die Ausführungen des Kammergerichts haben
jedoch für Lehrlinge jeder Art, gewerbliche und kauf-
männische, in gleicher Weise Geltung. Das Kammer-
gericht sagt u. a. wörtlich: „. . . Der Lehrling ist dem
Lehrherrn zur Ausbildung anvertraut. Er ist nicht Ge-
hilfe des Lehrherrn und nicht dazu bestimmt, im
Situationsbericht aus der Pariser Goldschmiedebranche.
Originalbericht des „Journals der Goldschmiedekunst“.
Lehrlingsausbildung
Der I. Strafsenat des Kammergerichts zu Berlin hat
am 26. September 1907 eine Entscheidung gefällt, die ge-
eignet ist, die grösste Befremdung bei allen Prinzipalen, die
Lehrlinge halten, hervorzurufen. Die Folgen dieser Ent-
scheidung sind unübersehbar. Verschiedene, besonders
schlesische Handelskammern, haben sich daher bereits mit
Eingaben an den Herrn Minister für Handel und Ge-
werbe gewandt und auf die besorgniserregenden Wir-
kungen, die im Gefolge der Rechtsprechung des Kammer-
gerichts sich einstellen jnüssten, hingewiesen. Nötigenfalls
müsste, wie die Handelskammern fordern, hier eine
schleunige Aenderung der gesetzlichen Bestimmungen
stattfinden.
Der Sachverhalt war folgender: Angeklagt war ein
Breslauer Geschäftsmann, weil er einen Lehrling an drei
verschiedenen Tagen vom Besuch der Fortbildungsschule
zurückgehalten hatte. Er begründete diese Massnahme
damit, dass von seinem gesamten aus 5 Buchhaltern und
5 Lehrlingen bestehenden Kontorpersonal zu jener Zeit
sämtliche 5 Buchhalter und ein älterer Lehrling erkrankt