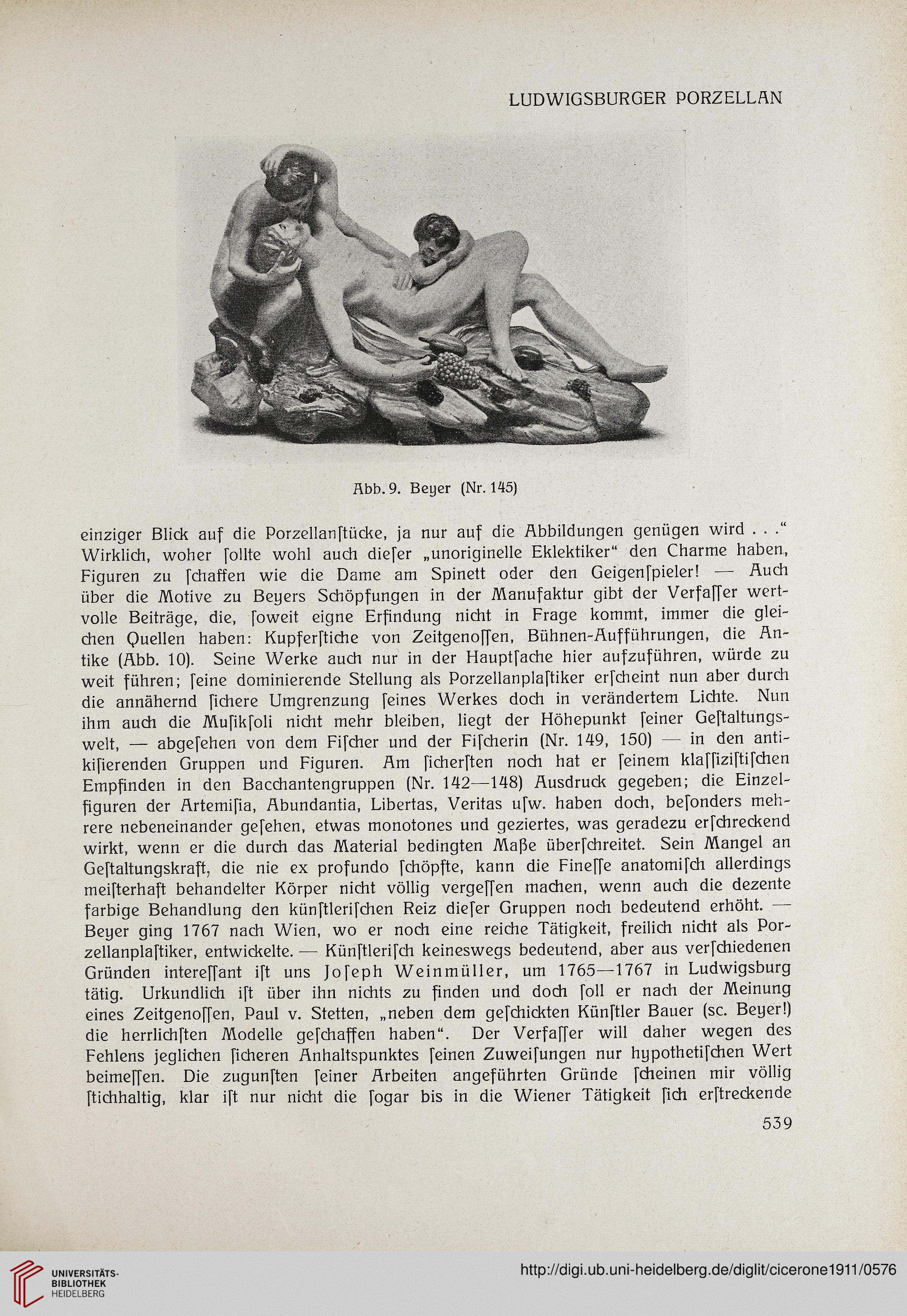Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 3.1911
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0576
DOI issue:
14. Heft
DOI article:Krüger, H. Carl: Ludwigsburger Porzellan
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0576
LUDWIGSBURGER PORZELLAN
einziger Blick auf die Porzellanftücke, ja nur auf die Abbildungen genügen wird . .
Wirklich, woher follte wohl auch diefer „unoriginelle Eklektiker“ den Charme haben,
Figuren zu fchaffen wie die Dame am Spinett oder den Geigenfpieler! — Auch
über die Motive zu Beyers Schöpfungen in der Manufaktur gibt der Verfaffer wert-
volle Beiträge, die, foweit eigne Erfindung nicht in Frage kommt, immer die glei-
chen Quellen haben: Kupferftiche von Zeitgenoffen, Bühnen-Aufführungen, die An-
tike (Abb. 10). Seine Werke auch nur in der Hauptfache hier aufzuführen, würde zu
weit führen; feine dominierende Stellung als Porzellanplaftiker erfcheint nun aber durch
die annähernd fichere Umgrenzung feines Werkes doch in verändertem Lichte. Nun
ihm auch die Mufikfoli nicht mehr bleiben, liegt der Höhepunkt feiner Geftaltungs-
welt, — abgefehen von dem Fifcher und der Fifcherin (Nr. 149, 150) — in den anti-
kifierenden Gruppen und Figuren. Am ficherften noch hat er feinem klaffiziftifchen
Empfinden in den Bacchantengruppen (Nr. 142—148) Ausdruck gegeben; die Einzel-
figuren der Artemifia, Abundantia, Libertas, Veritas ufw. haben doch, befonders meh-
rere nebeneinander gefehen, etwas monotones und geziertes, was geradezu erfchreckend
wirkt, wenn er die durch das Material bedingten Maße überfchreitet. Sein Mangel an
Geftaltungskraft, die nie ex profundo fchöpfte, kann die Fineffe anatomifch allerdings
meifterhaft behandelter Körper nicht völlig vergeffen machen, wenn auch die dezente
farbige Behandlung den künftlerifchen Reiz diefer Gruppen noch bedeutend erhöht. —
Beyer ging 1767 nach Wien, wo er noch eine reiche Tätigkeit, freilich nicht als Por-
zellanplaftiker, entwickelte. — Künftlerifch keineswegs bedeutend, aber aus verfchiedenen
Gründen intereffant ift uns Jofeph Weinmüller, um 1765—1767 in Ludwigsburg
tätig. Urkundlich ift über ihn nichts zu finden und doch foll er nach der Meinung
eines Zeitgenoffen, Paul v. Stetten, „neben dem gefchickten Künftler Bauer (sc. Beyer!)
die herrlichften Modelle gefchaffen haben“. Der Verfaffer will daher wegen des
Fehlens jeglichen ficheren Anhaltspunktes feinen Zuweifungen nur hypothetifchen Wert
beimeffen. Die zugunften feiner Arbeiten angeführten Gründe fcheinen mir völlig
ftichhaltig, klar ift nur nicht die fogar bis in die Wiener Tätigkeit fidi erftreckende
Abb. 9. Beyer (Nr. 145)
539
einziger Blick auf die Porzellanftücke, ja nur auf die Abbildungen genügen wird . .
Wirklich, woher follte wohl auch diefer „unoriginelle Eklektiker“ den Charme haben,
Figuren zu fchaffen wie die Dame am Spinett oder den Geigenfpieler! — Auch
über die Motive zu Beyers Schöpfungen in der Manufaktur gibt der Verfaffer wert-
volle Beiträge, die, foweit eigne Erfindung nicht in Frage kommt, immer die glei-
chen Quellen haben: Kupferftiche von Zeitgenoffen, Bühnen-Aufführungen, die An-
tike (Abb. 10). Seine Werke auch nur in der Hauptfache hier aufzuführen, würde zu
weit führen; feine dominierende Stellung als Porzellanplaftiker erfcheint nun aber durch
die annähernd fichere Umgrenzung feines Werkes doch in verändertem Lichte. Nun
ihm auch die Mufikfoli nicht mehr bleiben, liegt der Höhepunkt feiner Geftaltungs-
welt, — abgefehen von dem Fifcher und der Fifcherin (Nr. 149, 150) — in den anti-
kifierenden Gruppen und Figuren. Am ficherften noch hat er feinem klaffiziftifchen
Empfinden in den Bacchantengruppen (Nr. 142—148) Ausdruck gegeben; die Einzel-
figuren der Artemifia, Abundantia, Libertas, Veritas ufw. haben doch, befonders meh-
rere nebeneinander gefehen, etwas monotones und geziertes, was geradezu erfchreckend
wirkt, wenn er die durch das Material bedingten Maße überfchreitet. Sein Mangel an
Geftaltungskraft, die nie ex profundo fchöpfte, kann die Fineffe anatomifch allerdings
meifterhaft behandelter Körper nicht völlig vergeffen machen, wenn auch die dezente
farbige Behandlung den künftlerifchen Reiz diefer Gruppen noch bedeutend erhöht. —
Beyer ging 1767 nach Wien, wo er noch eine reiche Tätigkeit, freilich nicht als Por-
zellanplaftiker, entwickelte. — Künftlerifch keineswegs bedeutend, aber aus verfchiedenen
Gründen intereffant ift uns Jofeph Weinmüller, um 1765—1767 in Ludwigsburg
tätig. Urkundlich ift über ihn nichts zu finden und doch foll er nach der Meinung
eines Zeitgenoffen, Paul v. Stetten, „neben dem gefchickten Künftler Bauer (sc. Beyer!)
die herrlichften Modelle gefchaffen haben“. Der Verfaffer will daher wegen des
Fehlens jeglichen ficheren Anhaltspunktes feinen Zuweifungen nur hypothetifchen Wert
beimeffen. Die zugunften feiner Arbeiten angeführten Gründe fcheinen mir völlig
ftichhaltig, klar ift nur nicht die fogar bis in die Wiener Tätigkeit fidi erftreckende
Abb. 9. Beyer (Nr. 145)
539