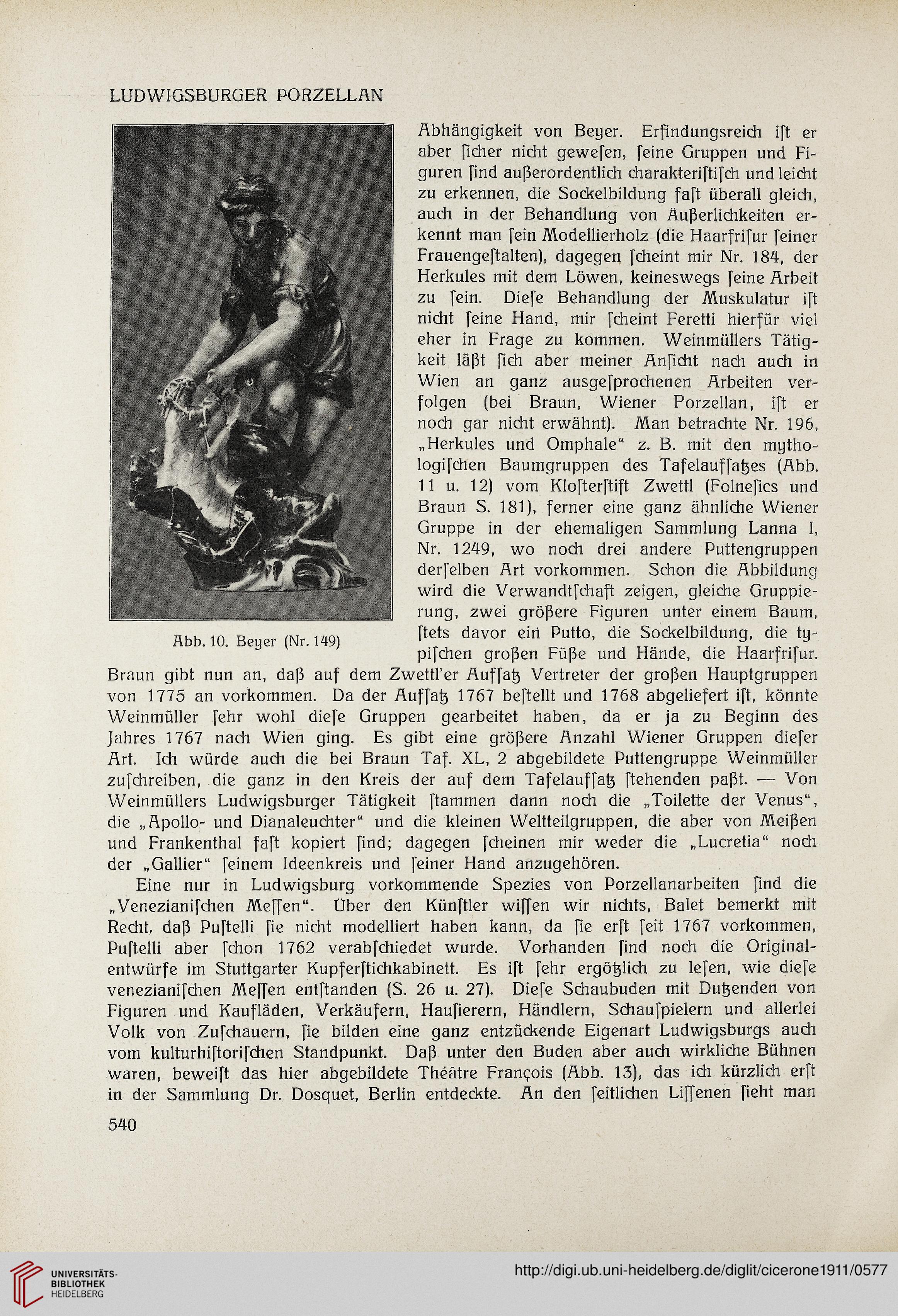Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 3.1911
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0577
DOI Heft:
14. Heft
DOI Artikel:Krüger, H. Carl: Ludwigsburger Porzellan
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0577
LUDWIGSBURGER PORZELLAN
Abhängigkeit von Beyer. Erfindungsreich ift er
aber ficher nicht gewefen, feine Gruppen und Fi-
guren find außerordentlich charakteriftifch und leicht
zu erkennen, die Sockelbildung faft überall gleich,
auch in der Behandlung von Äußerlichkeiten er-
kennt man fein Modellierholz (die Haarfrifur feiner
Frauengeftalten), dagegen fcheint mir Nr. 184, der
Herkules mit dem Löwen, keineswegs feine Arbeit
zu fein. Diefe Behandlung der Muskulatur ift
nicht feine Hand, mir fcheint Feretti hierfür viel
eher in Frage zu kommen. Weinmüllers Tätig-
keit läßt fich aber meiner Anficht nach auch in
Wien an ganz ausgefprochenen Arbeiten ver-
folgen (bei Braun, Wiener Porzellan, ift er
noch gar nicht erwähnt). Man betrachte Nr. 196,
„Herkules und Omphale“ z. B. mit den mytho-
logifchen Baumgruppen des Tafelauffatjes (Abb.
11 u. 12) vom Klofterftift Zwettl (Folnefics und
Braun S. 181), ferner eine ganz ähnliche Wiener
Gruppe in der ehemaligen Sammlung Lanna I,
Nr. 1249, wo noch drei andere Puttengruppen
derfelben Art Vorkommen. Schon die Abbildung
wird die Verwandtfchaft zeigen, gleiche Gruppie-
rung, zwei größere Figuren unter einem Baum,
ftets davor ein Putto, die Sockelbildung, die ty-
pifchen großen Füße und Hände, die Haarfrifur.
Braun gibt nun an, daß auf dem Zwettl’er Auffat} Vertreter der großen Hauptgruppen
von 1775 an Vorkommen. Da der Auffa^ 1767 beftellt und 1768 abgeliefert ift, könnte
Weinmüller fehr wohl diefe Gruppen gearbeitet haben, da er ja zu Beginn des
Jahres 1767 nach Wien ging. Es gibt eine größere Anzahl Wiener Gruppen diefer
Art. Ich würde auch die bei Braun Taf. XL, 2 abgebildete Puttengruppe Weinmüller
zufchreiben, die ganz in den Kreis der auf dem Tafelauffafe ftehenden paßt. — Von
Weinmüllers Ludwigsburger Tätigkeit ftammen dann noch die „Toilette der Venus“,
die „Apollo- und Dianaleuchter“ und die kleinen Weltteilgruppen, die aber von Meißen
und Frankenthal faft kopiert find; dagegen fcheinen mir weder die „Lucretia“ noch
der „Gallier“ feinem Ideenkreis und feiner Hand anzugehören.
Eine nur in Ludwigsburg vorkommende Spezies von Porzellanarbeiten find die
„Venezianifchen Meffen“. Über den Künftler wiffen wir nichts, Balet bemerkt mit
Recht, daß Puftelli fie nicht modelliert haben kann, da fie erft feit 1767 Vorkommen,
Puftelli aber fchon 1762 verabfchiedet wurde. Vorhanden find noch die Original-
entwürfe im Stuttgarter Kupferftichkabinett. Es ift fehr ergö^lich zu lefen, wie diefe
venezianifchen Meffen entftanden (S. 26 u. 27). Diefe Schaubuden mit Duzenden von
Figuren und Kaufläden, Verkäufern, Haufierern, Händlern, Schaufpielern und allerlei
Volk von Zufchauern, fie bilden eine ganz entzückende Eigenart Ludwigsburgs auch
vom kulturhiftorifchen Standpunkt. Daß unter den Buden aber auch wirkliche Bühnen
waren, beweift das hier abgebildete Theätre Franpois (Abb. 13), das ich kürzlich erft
in der Sammlung Dr. Dosguet, Berlin entdeckte. An den feitlichen Liffenen fieht man
540
Abhängigkeit von Beyer. Erfindungsreich ift er
aber ficher nicht gewefen, feine Gruppen und Fi-
guren find außerordentlich charakteriftifch und leicht
zu erkennen, die Sockelbildung faft überall gleich,
auch in der Behandlung von Äußerlichkeiten er-
kennt man fein Modellierholz (die Haarfrifur feiner
Frauengeftalten), dagegen fcheint mir Nr. 184, der
Herkules mit dem Löwen, keineswegs feine Arbeit
zu fein. Diefe Behandlung der Muskulatur ift
nicht feine Hand, mir fcheint Feretti hierfür viel
eher in Frage zu kommen. Weinmüllers Tätig-
keit läßt fich aber meiner Anficht nach auch in
Wien an ganz ausgefprochenen Arbeiten ver-
folgen (bei Braun, Wiener Porzellan, ift er
noch gar nicht erwähnt). Man betrachte Nr. 196,
„Herkules und Omphale“ z. B. mit den mytho-
logifchen Baumgruppen des Tafelauffatjes (Abb.
11 u. 12) vom Klofterftift Zwettl (Folnefics und
Braun S. 181), ferner eine ganz ähnliche Wiener
Gruppe in der ehemaligen Sammlung Lanna I,
Nr. 1249, wo noch drei andere Puttengruppen
derfelben Art Vorkommen. Schon die Abbildung
wird die Verwandtfchaft zeigen, gleiche Gruppie-
rung, zwei größere Figuren unter einem Baum,
ftets davor ein Putto, die Sockelbildung, die ty-
pifchen großen Füße und Hände, die Haarfrifur.
Braun gibt nun an, daß auf dem Zwettl’er Auffat} Vertreter der großen Hauptgruppen
von 1775 an Vorkommen. Da der Auffa^ 1767 beftellt und 1768 abgeliefert ift, könnte
Weinmüller fehr wohl diefe Gruppen gearbeitet haben, da er ja zu Beginn des
Jahres 1767 nach Wien ging. Es gibt eine größere Anzahl Wiener Gruppen diefer
Art. Ich würde auch die bei Braun Taf. XL, 2 abgebildete Puttengruppe Weinmüller
zufchreiben, die ganz in den Kreis der auf dem Tafelauffafe ftehenden paßt. — Von
Weinmüllers Ludwigsburger Tätigkeit ftammen dann noch die „Toilette der Venus“,
die „Apollo- und Dianaleuchter“ und die kleinen Weltteilgruppen, die aber von Meißen
und Frankenthal faft kopiert find; dagegen fcheinen mir weder die „Lucretia“ noch
der „Gallier“ feinem Ideenkreis und feiner Hand anzugehören.
Eine nur in Ludwigsburg vorkommende Spezies von Porzellanarbeiten find die
„Venezianifchen Meffen“. Über den Künftler wiffen wir nichts, Balet bemerkt mit
Recht, daß Puftelli fie nicht modelliert haben kann, da fie erft feit 1767 Vorkommen,
Puftelli aber fchon 1762 verabfchiedet wurde. Vorhanden find noch die Original-
entwürfe im Stuttgarter Kupferftichkabinett. Es ift fehr ergö^lich zu lefen, wie diefe
venezianifchen Meffen entftanden (S. 26 u. 27). Diefe Schaubuden mit Duzenden von
Figuren und Kaufläden, Verkäufern, Haufierern, Händlern, Schaufpielern und allerlei
Volk von Zufchauern, fie bilden eine ganz entzückende Eigenart Ludwigsburgs auch
vom kulturhiftorifchen Standpunkt. Daß unter den Buden aber auch wirkliche Bühnen
waren, beweift das hier abgebildete Theätre Franpois (Abb. 13), das ich kürzlich erft
in der Sammlung Dr. Dosguet, Berlin entdeckte. An den feitlichen Liffenen fieht man
540