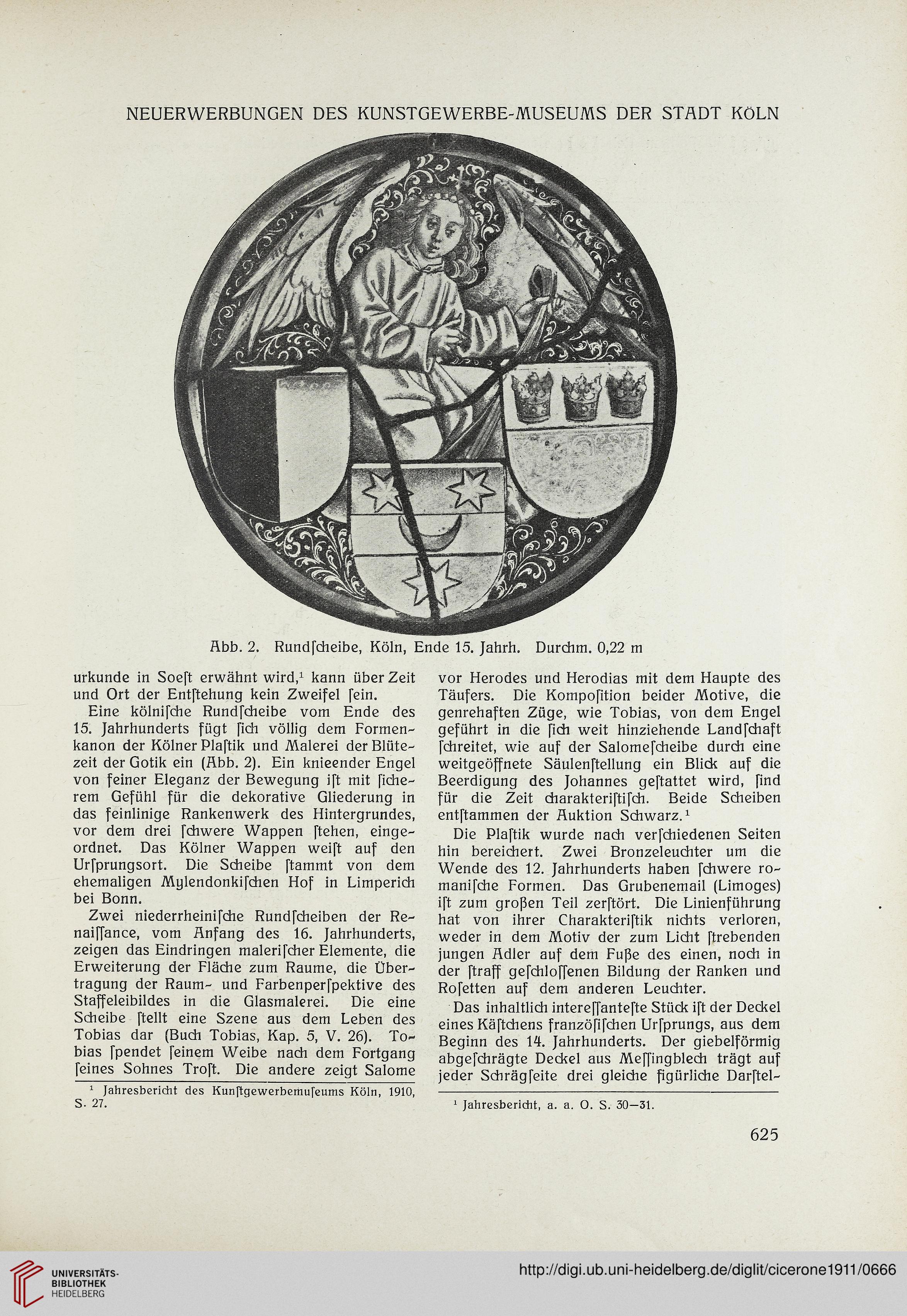Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 3.1911
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0666
DOI issue:
16. Heft
DOI article:Neuwerwerbungen des Kunstgewerbemuseums der Stadt Köln
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0666
NEUERWERBUNGEN DES KUNSTGEWERBE-MUSEUMS DER STADT KÖLN
Äbb. 2. Rundfcheibe, Köln, Ende 15. Jahrh. Durchm. 0,22 m
urkunde in Soeft erwähnt wird,1 kann über Zeit
und Ort der Entftehung kein Zweifel fein.
Eine kölnifche Rundfcheibe vom Ende des
15. Jahrhunderts fügt [ich völlig dem Formen-
kanon der Kölner Plaftik und Malerei der Blüte-
zeit der Gotik ein (Äbb. 2). Ein knieender Engel
von feiner Eleganz der Bewegung ift mit fiche-
rem Gefühl für die dekorative Gliederung in
das feinlinige Rankenwerk des Hintergrundes,
vor dem drei fchwere Wappen ftehen, einge-
ordnet. Das Kölner Wappen weift auf den
Urfprungsort. Die Scheibe ftammt von dem
ehemaligen Mylendonkifchen Hof in Limperich
bei Bonn.
Zwei niederrheinifche Rundfcheiben der Re-
naiffance, vom Änfang des 16. Jahrhunderts,
zeigen das Eindringen malerifcher Elemente, die
Erweiterung der Fläche zum Raume, die Über-
tragung der Raum- und Farbenperfpektive des
Staffeleibildes in die Glasmalerei. Die eine
Scheibe ftellt eine Szene aus dem Leben des
Tobias dar (Buch Tobias, Kap. 5, V. 26). To-
bias fpendet feinem Weibe nach dem Fortgang
feines Sohnes Troft. Die andere zeigt Salome * S.
1 Jahresbericht des Kunftgewerbemufeums Köln, 1910,
S. 27.
vor Herodes und Herodias mit dem Haupte des
Täufers. Die Kompofition beider Motive, die
genrehaften Züge, wie Tobias, von dem Engel
geführt in die fich weit hinziehende Landfchaft
fchreitet, wie auf der Salomefcheibe durch eine
weitgeöffnete Säulenftellung ein Blick auf die
Beerdigung des Johannes geftattet wird, find
für die Zeit charakteriftifdi. Beide Scheiben
entftammen der Äuktion Schwarz.1
Die Plaftik wurde nach verfchiedenen Seiten
hin bereichert. Zwei Bronzeleuchter um die
Wende des 12. Jahrhunderts haben fchwere ro-
manifdie Formen. Das Grubenemail (Limoges)
ift zum großen Teil zerftört. Die Linienführung
hat von ihrer Charakteriftik nichts verloren,
weder in dem Motiv der zum Licht ftrebenden
jungen Ädler auf dem Fuße des einen, noch in
der ftraff gefchloffenen Bildung der Ranken und
Rofetten auf dem anderen Leuchter.
Das inhaltlich intereffantefte Stück ift der Deckel
eines Käftchens franzöfifchen Urfprungs, aus dem
Beginn des 14. Jahrhunderts. Der giebelförmig
abgefchrägte Deckel aus Meffingblech trägt auf
jeder Schrägfeite drei gleiche figürliche Darftel-
1 Jahresbericht, a. a. O. S. 30—31.
625
Äbb. 2. Rundfcheibe, Köln, Ende 15. Jahrh. Durchm. 0,22 m
urkunde in Soeft erwähnt wird,1 kann über Zeit
und Ort der Entftehung kein Zweifel fein.
Eine kölnifche Rundfcheibe vom Ende des
15. Jahrhunderts fügt [ich völlig dem Formen-
kanon der Kölner Plaftik und Malerei der Blüte-
zeit der Gotik ein (Äbb. 2). Ein knieender Engel
von feiner Eleganz der Bewegung ift mit fiche-
rem Gefühl für die dekorative Gliederung in
das feinlinige Rankenwerk des Hintergrundes,
vor dem drei fchwere Wappen ftehen, einge-
ordnet. Das Kölner Wappen weift auf den
Urfprungsort. Die Scheibe ftammt von dem
ehemaligen Mylendonkifchen Hof in Limperich
bei Bonn.
Zwei niederrheinifche Rundfcheiben der Re-
naiffance, vom Änfang des 16. Jahrhunderts,
zeigen das Eindringen malerifcher Elemente, die
Erweiterung der Fläche zum Raume, die Über-
tragung der Raum- und Farbenperfpektive des
Staffeleibildes in die Glasmalerei. Die eine
Scheibe ftellt eine Szene aus dem Leben des
Tobias dar (Buch Tobias, Kap. 5, V. 26). To-
bias fpendet feinem Weibe nach dem Fortgang
feines Sohnes Troft. Die andere zeigt Salome * S.
1 Jahresbericht des Kunftgewerbemufeums Köln, 1910,
S. 27.
vor Herodes und Herodias mit dem Haupte des
Täufers. Die Kompofition beider Motive, die
genrehaften Züge, wie Tobias, von dem Engel
geführt in die fich weit hinziehende Landfchaft
fchreitet, wie auf der Salomefcheibe durch eine
weitgeöffnete Säulenftellung ein Blick auf die
Beerdigung des Johannes geftattet wird, find
für die Zeit charakteriftifdi. Beide Scheiben
entftammen der Äuktion Schwarz.1
Die Plaftik wurde nach verfchiedenen Seiten
hin bereichert. Zwei Bronzeleuchter um die
Wende des 12. Jahrhunderts haben fchwere ro-
manifdie Formen. Das Grubenemail (Limoges)
ift zum großen Teil zerftört. Die Linienführung
hat von ihrer Charakteriftik nichts verloren,
weder in dem Motiv der zum Licht ftrebenden
jungen Ädler auf dem Fuße des einen, noch in
der ftraff gefchloffenen Bildung der Ranken und
Rofetten auf dem anderen Leuchter.
Das inhaltlich intereffantefte Stück ift der Deckel
eines Käftchens franzöfifchen Urfprungs, aus dem
Beginn des 14. Jahrhunderts. Der giebelförmig
abgefchrägte Deckel aus Meffingblech trägt auf
jeder Schrägfeite drei gleiche figürliche Darftel-
1 Jahresbericht, a. a. O. S. 30—31.
625