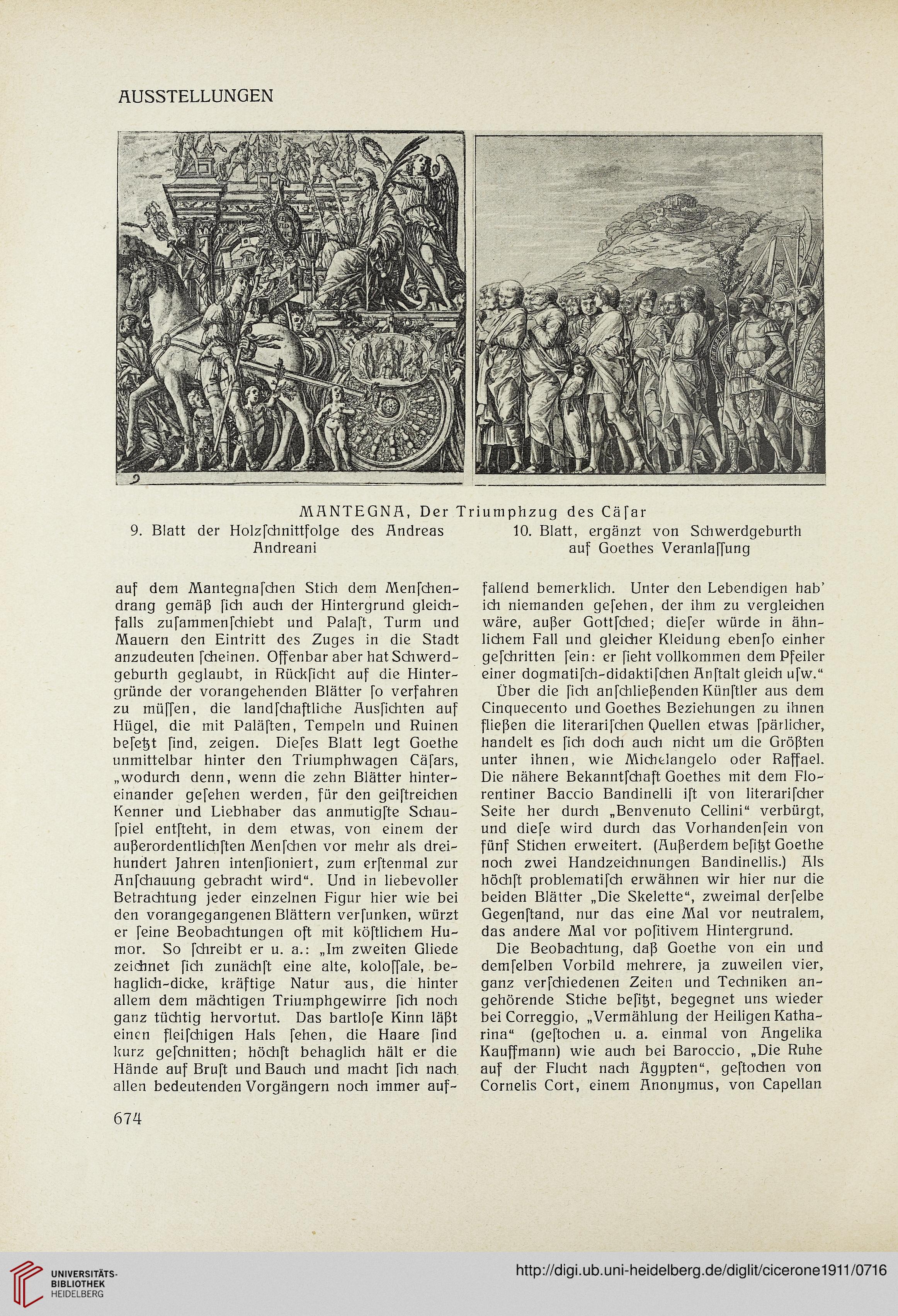Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 3.1911
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0716
DOI issue:
17. Heft
DOI article:Ausstellungen
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0716
AUSSTELLUNGEN
MÄNTEGNÄ, Der Triumphzug des Cäfar
9. Blatt der Holzfchnittfolge des Andreas
Andreani
10. Blatt, ergänzt von Schwerdgeburth
auf Goethes Veranlaffung
auf dem Mantegnafchen Stich dem Menfchen-
drang gemäß [ich auch der Hintergrund gleich-
falls zufammenfchiebt und Palaft, Turm und
Mauern den Eintritt des Zuges in die Stadt
anzudeuten fcheinen. Offenbar aber hat Schwerd-
geburth geglaubt, in Rückficht auf die Hinter-
gründe der vorangehenden Blätter fo verfahren
zu müffen, die landfchaftliche Ausfichten auf
Hügel, die mit Paläften, Tempeln und Ruinen
befeßt find, zeigen. Diefes Blatt legt Goethe
unmittelbar hinter den Triumphwagen Cäfars,
„wodurch denn, wenn die zehn Blätter hinter-
einander gefehen werden, für den geiftreichen
Kenner und Liebhaber das anmutigfte Schau-
fpiel entfteht, in dem etwas, von einem der
außerordentlichften Menfchen vor mehr als drei-
hundert Jahren intenfioniert, zum erftenmal zur
Anfchauung gebracht wird“. Und in liebevoller
Betrachtung jeder einzelnen Figur hier wie bei
den vorangegangenen Blättern verfunken, würzt
er feine Beobachtungen oft mit köftlichem Hu-
mor. So fchreibt er u. a.: „Im zweiten Gliede
zeichnet fich zunächft eine alte, koloffale, be-
haglich-dicke, kräftige Natur aus, die hinter
allem dem mächtigen Triumphgewirre fich noch
ganz tüchtig hervortut. Das bartlofe Kinn läßt
einen fleifchigen Hals fehen, die Haare find
kurz gefchnitten; höchft behaglich hält er die
Hände auf Bruft und Bauch und macht fich nach
allen bedeutenden Vorgängern noch immer auf-
fallend bemerklich. Unter den Lebendigen hab’
ich niemanden gefehen, der ihm zu vergleichen
wäre, außer Gottfched; diefer würde in ähn-
lichem Fall und gleicher Kleidung ebenfo einher
gefchritten fein: er fieht vollkommen dem Pfeiler
einer dogmatifch-didaktifchen Anftalt gleich ufw.“
Über die fich anfchließenden Künftler aus dem
Cinquecento und Goethes Beziehungen zu ihnen
fließen die literarifchen Quellen etwas fpärlicher,
handelt es fich doch auch nicht um die Größten
unter ihnen, wie Michelangelo oder Raffael.
Die nähere Bekanntfchaft Goethes mit dem Flo-
rentiner Baccio Bandinelli ift von literarifcher
Seite her durch „Benvenuto Cellini“ verbürgt,
und diefe wird durch das Vorhandenfein von
fünf Stichen erweitert. (Außerdem befißt Goethe
noch zwei Handzeichnungen Bandinellis.) Als
höchft problematifch erwähnen wir hier nur die
beiden Blätter „Die Skelette“, zweimal derfelbe
Gegenftand, nur das eine Mal vor neutralem,
das andere Mal vor pofitivem Hintergrund.
Die Beobachtung, daß Goethe von ein und
demfelben Vorbild mehrere, ja zuweilen vier,
ganz verfchiedenen Zeiten und Techniken an-
gehörende Stiche befißt, begegnet uns wieder
bei Correggio, „Vermählung der Heiligen Katha-
rina“ (geftochen u. a. einmal von Angelika
Kauffmann) wie auch bei Baroccio, „Die Ruhe
auf der Flucht nach Ägypten“, geftochen von
Cornelis Cort, einem Anonymus, von Capellan
674
MÄNTEGNÄ, Der Triumphzug des Cäfar
9. Blatt der Holzfchnittfolge des Andreas
Andreani
10. Blatt, ergänzt von Schwerdgeburth
auf Goethes Veranlaffung
auf dem Mantegnafchen Stich dem Menfchen-
drang gemäß [ich auch der Hintergrund gleich-
falls zufammenfchiebt und Palaft, Turm und
Mauern den Eintritt des Zuges in die Stadt
anzudeuten fcheinen. Offenbar aber hat Schwerd-
geburth geglaubt, in Rückficht auf die Hinter-
gründe der vorangehenden Blätter fo verfahren
zu müffen, die landfchaftliche Ausfichten auf
Hügel, die mit Paläften, Tempeln und Ruinen
befeßt find, zeigen. Diefes Blatt legt Goethe
unmittelbar hinter den Triumphwagen Cäfars,
„wodurch denn, wenn die zehn Blätter hinter-
einander gefehen werden, für den geiftreichen
Kenner und Liebhaber das anmutigfte Schau-
fpiel entfteht, in dem etwas, von einem der
außerordentlichften Menfchen vor mehr als drei-
hundert Jahren intenfioniert, zum erftenmal zur
Anfchauung gebracht wird“. Und in liebevoller
Betrachtung jeder einzelnen Figur hier wie bei
den vorangegangenen Blättern verfunken, würzt
er feine Beobachtungen oft mit köftlichem Hu-
mor. So fchreibt er u. a.: „Im zweiten Gliede
zeichnet fich zunächft eine alte, koloffale, be-
haglich-dicke, kräftige Natur aus, die hinter
allem dem mächtigen Triumphgewirre fich noch
ganz tüchtig hervortut. Das bartlofe Kinn läßt
einen fleifchigen Hals fehen, die Haare find
kurz gefchnitten; höchft behaglich hält er die
Hände auf Bruft und Bauch und macht fich nach
allen bedeutenden Vorgängern noch immer auf-
fallend bemerklich. Unter den Lebendigen hab’
ich niemanden gefehen, der ihm zu vergleichen
wäre, außer Gottfched; diefer würde in ähn-
lichem Fall und gleicher Kleidung ebenfo einher
gefchritten fein: er fieht vollkommen dem Pfeiler
einer dogmatifch-didaktifchen Anftalt gleich ufw.“
Über die fich anfchließenden Künftler aus dem
Cinquecento und Goethes Beziehungen zu ihnen
fließen die literarifchen Quellen etwas fpärlicher,
handelt es fich doch auch nicht um die Größten
unter ihnen, wie Michelangelo oder Raffael.
Die nähere Bekanntfchaft Goethes mit dem Flo-
rentiner Baccio Bandinelli ift von literarifcher
Seite her durch „Benvenuto Cellini“ verbürgt,
und diefe wird durch das Vorhandenfein von
fünf Stichen erweitert. (Außerdem befißt Goethe
noch zwei Handzeichnungen Bandinellis.) Als
höchft problematifch erwähnen wir hier nur die
beiden Blätter „Die Skelette“, zweimal derfelbe
Gegenftand, nur das eine Mal vor neutralem,
das andere Mal vor pofitivem Hintergrund.
Die Beobachtung, daß Goethe von ein und
demfelben Vorbild mehrere, ja zuweilen vier,
ganz verfchiedenen Zeiten und Techniken an-
gehörende Stiche befißt, begegnet uns wieder
bei Correggio, „Vermählung der Heiligen Katha-
rina“ (geftochen u. a. einmal von Angelika
Kauffmann) wie auch bei Baroccio, „Die Ruhe
auf der Flucht nach Ägypten“, geftochen von
Cornelis Cort, einem Anonymus, von Capellan
674