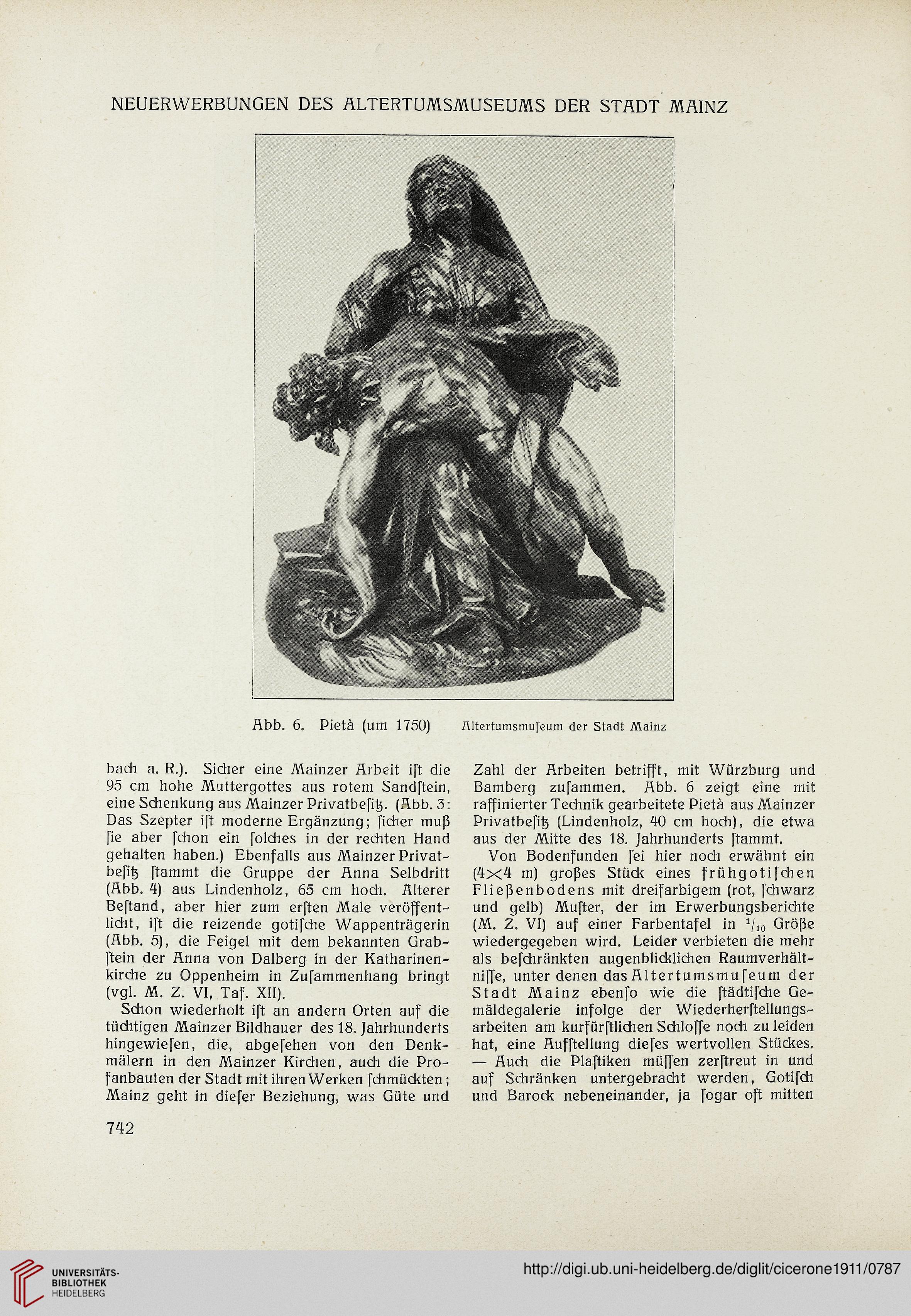Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 3.1911
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0787
DOI Heft:
19. Heft
DOI Artikel:Rundschau - Sammlungen
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0787
NEUERWERBUNGEN DES ALTERTUMSMUSEUMS DER STADT MAINZ
Äbb. 6. Pietä (um 1750) itltertumsmufeum der Stadt Mainz
bach a. R.). Sicher eine Mainzer Ärbeit ipt die
95 cm hohe Muttergottes aus rotem Sandftein,
eine Schenkung aus Mainzer Privatbefit^. (Äbb. 3:
Das Szepter ift moderne Ergänzung; [icher muß
[ie aber fchon ein folches in der rechten Hand
gehalten haben.) Ebenfalls aus Mainzer Privat-
befilj ftammt die Gruppe der Än na Selbdritt
(Äbb. 4) aus Lindenholz, 65 cm hoch. Älterer
Beftand, aber hier zum erften Male veröffent-
licht, ift die reizende gotifche Wappenträgerin
(Äbb. 5), die Feigel mit dem bekannten Grab-
ftein der Änna von Dalberg in der Katharinen-
kirche zu Oppenheim in Zufammenhang bringt
(vgl. M. Z. VI, Taf. XII).
Schon wiederholt ift an andern Orten auf die
tüchtigen Mainzer Bildhauer des 18. Jahrhunderts
hingewiefen, die, abgefehen von den Denk-
mälern in den Mainzer Kirchen, auch die Pro-
fanbauten der Stadt mit ihren Werken fchmückten ;
Mainz geht in diefer Beziehung, was Güte und
Zahl der Ärbeiten betrifft, mit Würzburg und
Bamberg zufammen. Äbb. 6 zeigt eine mit
raffinierter Technik gearbeitete Pieta aus Mainzer
Privatbefifs (Lindenholz, 40 cm hoch), die etwa
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts ftammt.
Von Bodenfunden fei hier noch erwähnt ein
(4x4 m) großes Stück eines frühgotifchen
Fließenbodens mit dreifarbigem (rot, fchwarz
und gelb) Mufter, der im Erwerbungsberichte
(M. Z. VI) auf einer Farbentafel in x/10 Größe
wiedergegeben wird. Leider verbieten die mehr
als befchränkten augenblicklichen Raumverhält-
niffe, unter denen dasÄltertumsmufeum der
Stadt Mainz ebenfo wie die ftädtifche Ge-
mäldegalerie infolge der Wiederherftellungs-
arbeiten am kurfürftlichen Schlöffe noch zu leiden
hat, eine Äufftellung diefes wertvollen Stückes.
— Äuch die Plaftiken müffen zerftreut in und
auf Schränken untergebracht werden, Gotifch
und Barock nebeneinander, ja fogar oft mitten
742
Äbb. 6. Pietä (um 1750) itltertumsmufeum der Stadt Mainz
bach a. R.). Sicher eine Mainzer Ärbeit ipt die
95 cm hohe Muttergottes aus rotem Sandftein,
eine Schenkung aus Mainzer Privatbefit^. (Äbb. 3:
Das Szepter ift moderne Ergänzung; [icher muß
[ie aber fchon ein folches in der rechten Hand
gehalten haben.) Ebenfalls aus Mainzer Privat-
befilj ftammt die Gruppe der Än na Selbdritt
(Äbb. 4) aus Lindenholz, 65 cm hoch. Älterer
Beftand, aber hier zum erften Male veröffent-
licht, ift die reizende gotifche Wappenträgerin
(Äbb. 5), die Feigel mit dem bekannten Grab-
ftein der Änna von Dalberg in der Katharinen-
kirche zu Oppenheim in Zufammenhang bringt
(vgl. M. Z. VI, Taf. XII).
Schon wiederholt ift an andern Orten auf die
tüchtigen Mainzer Bildhauer des 18. Jahrhunderts
hingewiefen, die, abgefehen von den Denk-
mälern in den Mainzer Kirchen, auch die Pro-
fanbauten der Stadt mit ihren Werken fchmückten ;
Mainz geht in diefer Beziehung, was Güte und
Zahl der Ärbeiten betrifft, mit Würzburg und
Bamberg zufammen. Äbb. 6 zeigt eine mit
raffinierter Technik gearbeitete Pieta aus Mainzer
Privatbefifs (Lindenholz, 40 cm hoch), die etwa
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts ftammt.
Von Bodenfunden fei hier noch erwähnt ein
(4x4 m) großes Stück eines frühgotifchen
Fließenbodens mit dreifarbigem (rot, fchwarz
und gelb) Mufter, der im Erwerbungsberichte
(M. Z. VI) auf einer Farbentafel in x/10 Größe
wiedergegeben wird. Leider verbieten die mehr
als befchränkten augenblicklichen Raumverhält-
niffe, unter denen dasÄltertumsmufeum der
Stadt Mainz ebenfo wie die ftädtifche Ge-
mäldegalerie infolge der Wiederherftellungs-
arbeiten am kurfürftlichen Schlöffe noch zu leiden
hat, eine Äufftellung diefes wertvollen Stückes.
— Äuch die Plaftiken müffen zerftreut in und
auf Schränken untergebracht werden, Gotifch
und Barock nebeneinander, ja fogar oft mitten
742