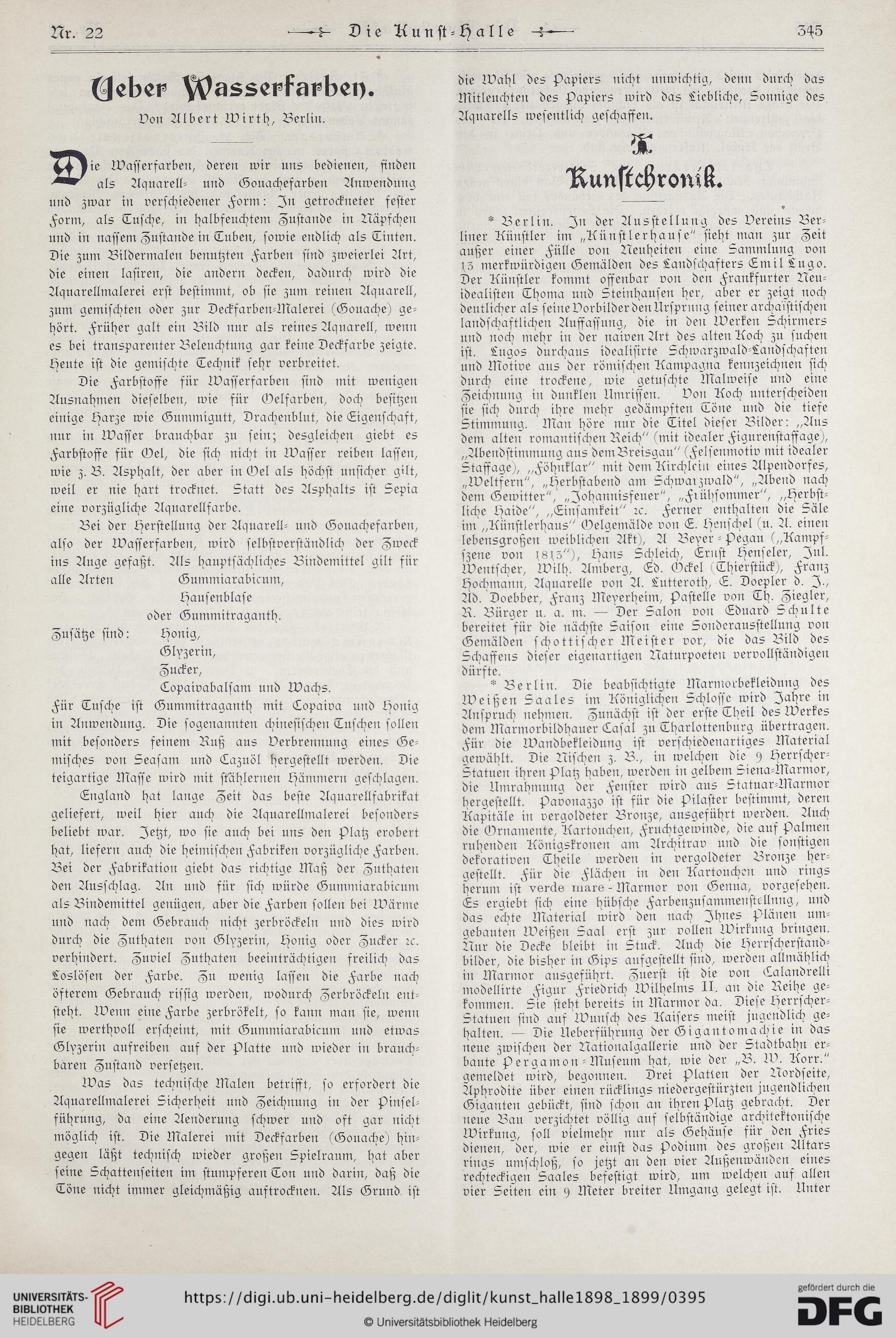Die Kunst-Halle — 4.1898/1899
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.63302#0395
DOI Heft:
Nummer 22
DOI Artikel:Wirth, Albert: Ueber Wasserfarben
DOI Artikel:Kunstchronik
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.63302#0395
Nr. 22
Die Aun st-Halle -z-
3^5
Eeber Wasserfgi-bey.
von Albert Wirth, Berlin.
^^Hie Wasserfarben, deren wir uns bedienen, finden
als Aquarell- und Gouachesarben Anwendung
und zwar in verschiedener Form: In getrockneter fester
Form, als Tusche, in halbfeuchtem Zustande in Näpfchen
und in nassem Zustande in Tuben, sowie endlich als Tinten.
Die zum Bildermalen benutzter: Warben sind zweierlei Art,
die einen lasiren, die andern decken, dadurch wird die
Aquarellmalerei erst bestimmt, ob sie zum reinen Aquarell,
zum gemischten oder zur Decksarben-Malerei (Gouache) ge-
hört. Früher galt ein Bild nur als reines Aquarell, wenn
es bei transparenter Beleuchtung gar keine Deckfarbe zeigte,
heute ist die gemischte Technik sehr verbreitet.
Die Farbstoffe für Wasserfarben sind mit wenigen
Ausnahmen dieselben, wie für Gelsarben, doch besitzen
einige harze wie Gummigutt, Drachenblut, die Eigenschaft,
nur in Wasser brauchbar zu sein; desgleichen giebt es
Farbstoffe sür Gel, die sich nicht in Wasser reiben lassen,
wie z. B. Asphalt, der aber in Gel als höchst unsicher gilt,
weil er nie hart trocknet. Statt des Asphalts ist Sepia
eine vorzügliche Aquarellfarbe.
Bei der Herstellung der Aquarell- und Gouachesarben,
also der Wasserfarben, wird selbstverständlich der Zweck
ins Auge gefaßt. Als hauptsächliches Bindemittel gilt sür
alle Arten Gummiarabicum,
Hausenblase
oder Gummitraganth.
Zusätze sind: Honig,
Glyzerin,
Zucker,
Topaivabalsam und wachs.
Für Tusche ist Gummitraganth mit Lopaiva und Honig
in Anwendung. Die sogenannten chinesischen Tuschen sollen
mit besonders seinem Ruß aus Verbrennung eines Ge-
misches von Seasam und Tazuöl hergestellt werden. Die
teigartige Nasse wird mit stählernen hämmern geschlagen.
England hat lange Zeit das beste Aquarellsabrikat
geliefert, weil hier auch die Aquarellmalerei besonders
beliebt war. Jetzt, wo sie auch bei uns den Platz erobert
hat, liefern auch die heimischen Fabriken vorzügliche Farben.
Bei der Fabrikation giebt das richtige Naß der Zuthaten
de:: Ausschlag. An und sür sich würde Gummiarabicum
als Bindemittel genügen, aber die Farben sollen bei Wärme
und nach dem Gebrauch nicht zerbröckeln und dies wird
durch die Zuthaten von Glyzerin, Honig oder Zucker rc.
verhindert. Zuviel Zuthaten beeinträchtigen freilich das
Loslösen der Farbe. Zu wenig lassen die Farbe nach
öfterem Gebrauch rissig werden, wodurch Zerbröckeln ent-
steht. wenn eine Farbe zerbrökelt, so kann man sie, wenn
sie werthvoll erscheint, mit Gummiarabicum und etwas
Glyzerin ausreiben aus der Platte und wieder in brauch-
baren Zustand versetzen.
was das technische Nalen betrifft, so erfordert die
Aquarellmalerei Sicherheit und Zeichnung in der Pinsel-
führung, da eine Aenderung schwer und oft gar nicht
möglich ist. Die Malerei mit Deckfarben (Gouache) hin-
gegen läßt technisch wieder großen Spielraum, hat aber
seine Schattenseiten im stumpferen Ton und darin, daß die
Löne nicht immer gleichmäßig austrocknen. Als Grund ist
die Wahl des Papiers nicht unwichtig, denn durch das
Nitleuchten des Papiers wird das Liebliche, Sonnige des
Aquarells wesentlich geschaffen.
X
Aunstchromk.
* Berlin. In der Ausstellung des Vereins Ber-
liner Künstler im „Künstlerhause" sieht man zur Zeit
außer einer Fülle von Neuheiten eine Sammlung von
merkwürdigen Gemälden des Landschafters Emil Lugo.
Der Künstler kommt offenbar von den Frankfurter Neu-
idealisten Thoma und Steinhaufen her, aber er zeigt noch
deutlicher als seine Vorbilder den Ursprung seiner archaistischen
landschaftlichen Auffassung, die in den Werken Schirmers
und noch mehr in der naiver: Art des alten Koch zu suchen
ist. Lugos durchaus idealisirte Schwarzwald-Landschaften
und Motive aus der römischen Kampagne kennzeichne,: sich
durch eine trockene, wie getuschte Malweise und eine
Zeichnung in dunklen Umrissen. von Koch unterscheiden
sie sich durch ihre mehr gedämpften Töne und die tiefe
Stimmung. Man höre nur die Titel dieser Bilder: „Aus
dem alten romantischen Reich" (mit idealer Fignrenstaffage),
„Abendstimmung aus demBreisgau" (Felsenmotiv mit idealer
Staffage), „Föhnklar" mit dem Kirchlein eines Alpendorses,
„weltfern", „herbstabend am Schwarzwald", „Abend nach
dem Gewitter", „Iohannisseuer", „Frühsommer", „herbst-
liche Haide", „Einsamkeit" rc. Ferner enthalten die Säle
in: „Künstlerhaus" Gelgemälde von E. Henschel (u. A. einen
lebensgroßen weiblichen Akt), A Beyer - Pegau („Kamps-
szene von s8s5"), Hans Schleich, Ernst henseler, Jul.
wentscher, wilh. Amberg, Ed. Gckel (Thierstück), Franz
hochmann, Aquarelle von A. Lutteroth, E. Doepler d. I.,
Ad. Doebber, Franz Neyerheim, Pastelle von Th. Ziegler,
R. Bürger u. a. m. — Der Salon von Eduard Schulte
bereitet sür die nächste Saison eine Sonderausstellung von
Gemälden schottischer Meister vor, die das Bild des
Schaffens dieser eigenartigen Naturpoeten vervollständigen
dürste.
* Berlin. Die beabsichtigte Marmorbekleidung des
Weißen Saales im Königlichen Schlosse wird Jahre in
Anspruch nehmen. Zunächst ist der erste Theil des Werkes
dem Marmorbildhauer Lasal zu Tharlottenburg übertragen.
Für die Wandbekleidung ist verschiedenartiges Material
gewählt. Die Nischen z. B., in welchen die st Herrscher-
Statuen ihren Platz haben, werden in gelbem tviena-Marmor,
die Umrahmung der Fenster wird aus t^tatuar-Marmor
hergestellt, pavonazzo ist sür die Pilaster bestimmt, deren
Kapitale in vergoldeter Bronze, ausgeführt werden. Auch
die Grnamente, Kartouchen, Fruchtgewinde, die aus Palmen
ruhenden Königskronen am Architrav und die sonstigen
dekorativen Theile werden in vergoldeter Bronze her-
gestellt. Für die Flächen in den Kartouchen und rings
herum ist voräs iug.ro - Marmor von Genna, vorgesehen.
Es ergiebt sich eine hübsche Farbenzusammenstcllnng, und
das echte Material wird den nach Ihnes Plänen um-
gebauten Weißen Saal erst zur vollen Wirkung bringen.
Nur die Decke bleibt in Stuck. Auch die Herrscherstand-
bilder, die bisher in Gips ausgestellt sind, werden allmählich
in Marmor ausgeführt. Zuerst ist die von Talandrelli
modellirte Figur Friedrich Wilhelms H. an die Reihe ge-
kommen. Sie steht bereits in Marmor da. Diese Herrscher-
Statuen sind aus Wunsch des Kaisers meist jugendlich ge-
halten. — Die Uebersührung der Gigantomachie in das
neue zwischen der Nationalgallerie und der Stadtbahn er-
baute Pergamon-Museum hat, wie der „B. w. Korr."
gemeldet wird, begonnen. Drei Platten der Nordseite,
Aphrodite über einen rücklings niedergestürzten jugendlichen
Giganten gebückt, sind schon an ihren Platz gebracht. Der
neue Bau verzichtet völlig aus selbständige architektonische
Wirkung, soll vielmehr nur als Gehäuse für den Fries
dienen, der, wie er einst das Podium des grossen Altars
rings umschloß, so jetzt an den vier Außenwänden eines
rechteckigen Saales befestigt wird, um welchen aus allen
vier Seiten ein st Meter breiter Umgang gelegt ist. Unter
Die Aun st-Halle -z-
3^5
Eeber Wasserfgi-bey.
von Albert Wirth, Berlin.
^^Hie Wasserfarben, deren wir uns bedienen, finden
als Aquarell- und Gouachesarben Anwendung
und zwar in verschiedener Form: In getrockneter fester
Form, als Tusche, in halbfeuchtem Zustande in Näpfchen
und in nassem Zustande in Tuben, sowie endlich als Tinten.
Die zum Bildermalen benutzter: Warben sind zweierlei Art,
die einen lasiren, die andern decken, dadurch wird die
Aquarellmalerei erst bestimmt, ob sie zum reinen Aquarell,
zum gemischten oder zur Decksarben-Malerei (Gouache) ge-
hört. Früher galt ein Bild nur als reines Aquarell, wenn
es bei transparenter Beleuchtung gar keine Deckfarbe zeigte,
heute ist die gemischte Technik sehr verbreitet.
Die Farbstoffe für Wasserfarben sind mit wenigen
Ausnahmen dieselben, wie für Gelsarben, doch besitzen
einige harze wie Gummigutt, Drachenblut, die Eigenschaft,
nur in Wasser brauchbar zu sein; desgleichen giebt es
Farbstoffe sür Gel, die sich nicht in Wasser reiben lassen,
wie z. B. Asphalt, der aber in Gel als höchst unsicher gilt,
weil er nie hart trocknet. Statt des Asphalts ist Sepia
eine vorzügliche Aquarellfarbe.
Bei der Herstellung der Aquarell- und Gouachesarben,
also der Wasserfarben, wird selbstverständlich der Zweck
ins Auge gefaßt. Als hauptsächliches Bindemittel gilt sür
alle Arten Gummiarabicum,
Hausenblase
oder Gummitraganth.
Zusätze sind: Honig,
Glyzerin,
Zucker,
Topaivabalsam und wachs.
Für Tusche ist Gummitraganth mit Lopaiva und Honig
in Anwendung. Die sogenannten chinesischen Tuschen sollen
mit besonders seinem Ruß aus Verbrennung eines Ge-
misches von Seasam und Tazuöl hergestellt werden. Die
teigartige Nasse wird mit stählernen hämmern geschlagen.
England hat lange Zeit das beste Aquarellsabrikat
geliefert, weil hier auch die Aquarellmalerei besonders
beliebt war. Jetzt, wo sie auch bei uns den Platz erobert
hat, liefern auch die heimischen Fabriken vorzügliche Farben.
Bei der Fabrikation giebt das richtige Naß der Zuthaten
de:: Ausschlag. An und sür sich würde Gummiarabicum
als Bindemittel genügen, aber die Farben sollen bei Wärme
und nach dem Gebrauch nicht zerbröckeln und dies wird
durch die Zuthaten von Glyzerin, Honig oder Zucker rc.
verhindert. Zuviel Zuthaten beeinträchtigen freilich das
Loslösen der Farbe. Zu wenig lassen die Farbe nach
öfterem Gebrauch rissig werden, wodurch Zerbröckeln ent-
steht. wenn eine Farbe zerbrökelt, so kann man sie, wenn
sie werthvoll erscheint, mit Gummiarabicum und etwas
Glyzerin ausreiben aus der Platte und wieder in brauch-
baren Zustand versetzen.
was das technische Nalen betrifft, so erfordert die
Aquarellmalerei Sicherheit und Zeichnung in der Pinsel-
führung, da eine Aenderung schwer und oft gar nicht
möglich ist. Die Malerei mit Deckfarben (Gouache) hin-
gegen läßt technisch wieder großen Spielraum, hat aber
seine Schattenseiten im stumpferen Ton und darin, daß die
Löne nicht immer gleichmäßig austrocknen. Als Grund ist
die Wahl des Papiers nicht unwichtig, denn durch das
Nitleuchten des Papiers wird das Liebliche, Sonnige des
Aquarells wesentlich geschaffen.
X
Aunstchromk.
* Berlin. In der Ausstellung des Vereins Ber-
liner Künstler im „Künstlerhause" sieht man zur Zeit
außer einer Fülle von Neuheiten eine Sammlung von
merkwürdigen Gemälden des Landschafters Emil Lugo.
Der Künstler kommt offenbar von den Frankfurter Neu-
idealisten Thoma und Steinhaufen her, aber er zeigt noch
deutlicher als seine Vorbilder den Ursprung seiner archaistischen
landschaftlichen Auffassung, die in den Werken Schirmers
und noch mehr in der naiver: Art des alten Koch zu suchen
ist. Lugos durchaus idealisirte Schwarzwald-Landschaften
und Motive aus der römischen Kampagne kennzeichne,: sich
durch eine trockene, wie getuschte Malweise und eine
Zeichnung in dunklen Umrissen. von Koch unterscheiden
sie sich durch ihre mehr gedämpften Töne und die tiefe
Stimmung. Man höre nur die Titel dieser Bilder: „Aus
dem alten romantischen Reich" (mit idealer Fignrenstaffage),
„Abendstimmung aus demBreisgau" (Felsenmotiv mit idealer
Staffage), „Föhnklar" mit dem Kirchlein eines Alpendorses,
„weltfern", „herbstabend am Schwarzwald", „Abend nach
dem Gewitter", „Iohannisseuer", „Frühsommer", „herbst-
liche Haide", „Einsamkeit" rc. Ferner enthalten die Säle
in: „Künstlerhaus" Gelgemälde von E. Henschel (u. A. einen
lebensgroßen weiblichen Akt), A Beyer - Pegau („Kamps-
szene von s8s5"), Hans Schleich, Ernst henseler, Jul.
wentscher, wilh. Amberg, Ed. Gckel (Thierstück), Franz
hochmann, Aquarelle von A. Lutteroth, E. Doepler d. I.,
Ad. Doebber, Franz Neyerheim, Pastelle von Th. Ziegler,
R. Bürger u. a. m. — Der Salon von Eduard Schulte
bereitet sür die nächste Saison eine Sonderausstellung von
Gemälden schottischer Meister vor, die das Bild des
Schaffens dieser eigenartigen Naturpoeten vervollständigen
dürste.
* Berlin. Die beabsichtigte Marmorbekleidung des
Weißen Saales im Königlichen Schlosse wird Jahre in
Anspruch nehmen. Zunächst ist der erste Theil des Werkes
dem Marmorbildhauer Lasal zu Tharlottenburg übertragen.
Für die Wandbekleidung ist verschiedenartiges Material
gewählt. Die Nischen z. B., in welchen die st Herrscher-
Statuen ihren Platz haben, werden in gelbem tviena-Marmor,
die Umrahmung der Fenster wird aus t^tatuar-Marmor
hergestellt, pavonazzo ist sür die Pilaster bestimmt, deren
Kapitale in vergoldeter Bronze, ausgeführt werden. Auch
die Grnamente, Kartouchen, Fruchtgewinde, die aus Palmen
ruhenden Königskronen am Architrav und die sonstigen
dekorativen Theile werden in vergoldeter Bronze her-
gestellt. Für die Flächen in den Kartouchen und rings
herum ist voräs iug.ro - Marmor von Genna, vorgesehen.
Es ergiebt sich eine hübsche Farbenzusammenstcllnng, und
das echte Material wird den nach Ihnes Plänen um-
gebauten Weißen Saal erst zur vollen Wirkung bringen.
Nur die Decke bleibt in Stuck. Auch die Herrscherstand-
bilder, die bisher in Gips ausgestellt sind, werden allmählich
in Marmor ausgeführt. Zuerst ist die von Talandrelli
modellirte Figur Friedrich Wilhelms H. an die Reihe ge-
kommen. Sie steht bereits in Marmor da. Diese Herrscher-
Statuen sind aus Wunsch des Kaisers meist jugendlich ge-
halten. — Die Uebersührung der Gigantomachie in das
neue zwischen der Nationalgallerie und der Stadtbahn er-
baute Pergamon-Museum hat, wie der „B. w. Korr."
gemeldet wird, begonnen. Drei Platten der Nordseite,
Aphrodite über einen rücklings niedergestürzten jugendlichen
Giganten gebückt, sind schon an ihren Platz gebracht. Der
neue Bau verzichtet völlig aus selbständige architektonische
Wirkung, soll vielmehr nur als Gehäuse für den Fries
dienen, der, wie er einst das Podium des grossen Altars
rings umschloß, so jetzt an den vier Außenwänden eines
rechteckigen Saales befestigt wird, um welchen aus allen
vier Seiten ein st Meter breiter Umgang gelegt ist. Unter