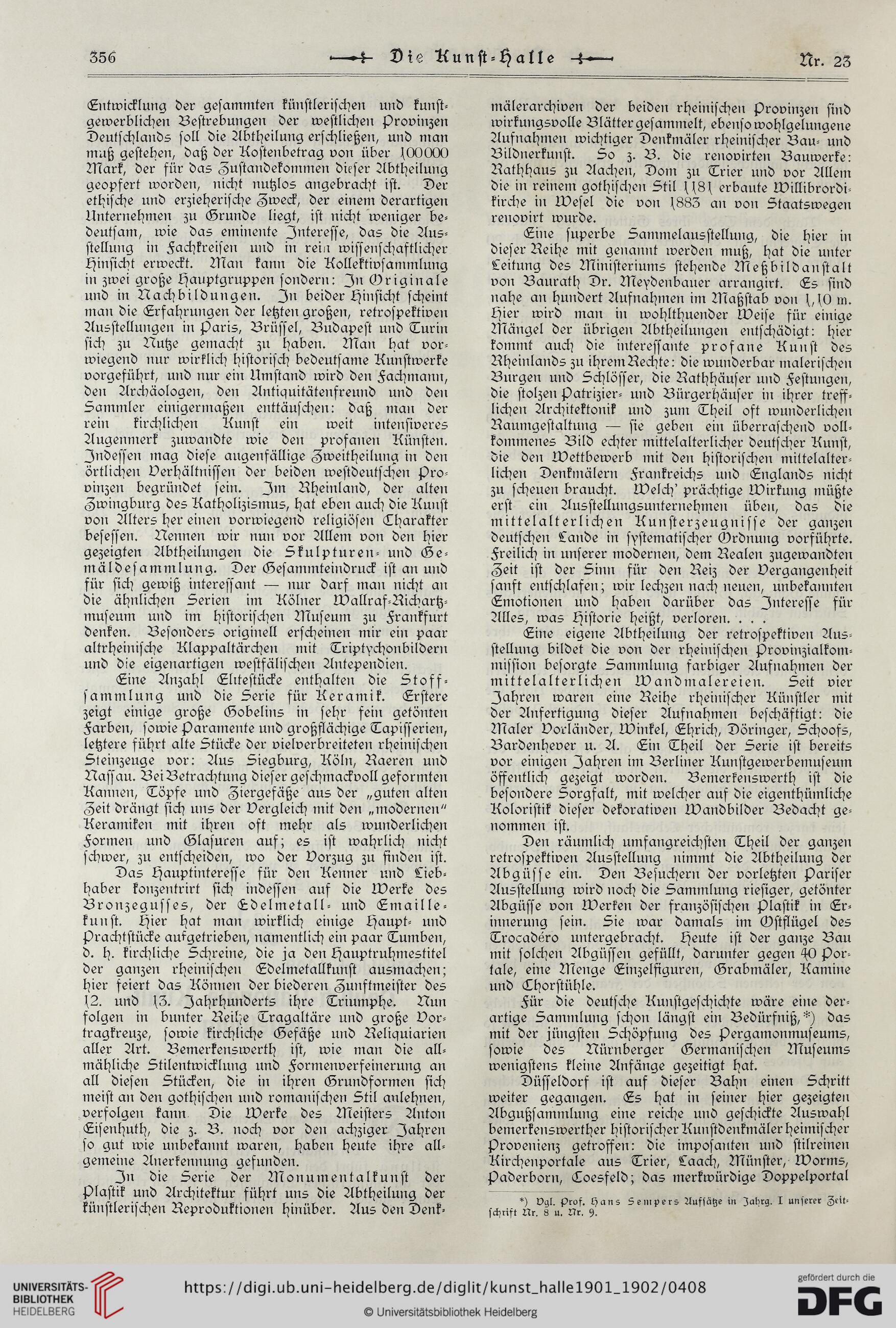Die Kunst-Halle — 7.1901/1902
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.62513#0408
DOI Heft:
Nr. 23
DOI Artikel:Harrach, Max: Düsseldorf 1902: Deutsch-nationale Kunstausstellung, [5]
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.62513#0408
Yir. 23
Entwicklung der geſammten künſtleriſchen und kunſt-
gewerblichen Beſtrebungen der weſtlichen Provinzen
Deutſchlands ſoll die Abtheilung erſchließen, und man
muß geſtehen, daß der HKoſtenbetrag von über 100000
Mark, der für das HSuſtandekommen dieſer Abtheilung
geopfert worden, nicht nutzlos angebracht iſt. Der
ethiſche und erzieheriſche Sweck, der einem derartigen
Unternehmen zu Grunde liegt, iſt nicht weniger be-
deutſam, wie das eminente Intereſſe, das die Aus-
ſtellung in Fachkreiſen und in rein wiſſenſchaftlicher
Hinſicht erweckt. Man kann die Uollektivſammlung
in zwei große Bauptgruppen ſondern: In Originale
und in Nachbildungen. In beider Hinſicht ſcheint
man die Erfahrungen der letzten großen, retroſpektiven
Ausſtellungen in Paris, Brüſſel, Budapeſt und Turin
ſich zu Nutze gemacht zu haben. Man hat vor-
wiegend nur wirklich hiſtoriſch bedeutſame Kunſtwerke
vorgeführt, und nur ein Umſtand wird den Fachmann,
den Archäologen, den Antiquitätenfreund und den
Sammler einigermaßen enttäuſchen: daß man der
rein kirchlichen Kunſt ein weit intenſiveres
Augenmerk zuwandte wie den profanen Künſten.
Indeſſen mag dieſe augenfällige Sweitheilung in den
örtlichen Perhältniſſen der beiden weſtdeutſchen Pro-
vinzen begründet ſein. Im Kheinland, der alten
Zwingburg des Katholizismus, hat eben auch die Kunft
von Alters her einen vorwiegend religiöſen Charakter
beſeſſen. Nennen wir nun vor Allem von den hier
gezeigten Abtheilungen die Skulpturen- und Ge-
mäldeſammlung. Der Geſammteindruck iſt an und
für ſich gewiß intereſſant — nur darf man nicht an
die ähnlichen Serien im Kölner Wallraf-Richartz-
muſeum und im hiſtoriſchen Muſeum zu Frankfurt
denken. Beſonders originell erſcheinen mir ein paar
altrheiniſche Klappaltärchen mit Triptychonbildern
und die eigenartigen weſtfäliſchen Antependien.
Eine Anzahl Eliteſtücke enthalten die Stoff-
ſammlung und die Serie für Keramik. Erſtere
zeigt einige große Gobelins in ſehr fein getönten
Farben, ſowie Paramente und großflächige Tapiſſerien,
letztere führt alte Stücke der vielverbreiteten rheiniſchen
Steinzeuge vor: Aus Siegburg, Köln, Raeren und
Naſſau. Bei Betrachtung dieſer geſchmackvoll geformten
Kannen, Töpfe und Siergefäße aus der „guten alten
Zeit drängt ſich uns der Vergleich mit den „modernen“
Keramifen mit ihren oft mehr als wunderlichen
Formen und Glaſuren auf; es iſt wahrlich nicht
ſchwer, zu entſcheiden, wo der Vorzug zu finden iſt.
Das Hauptintereſſe für den Kenner und Lieb-
haber konzentrirt ſich indeſſen auf die Werke des
Bronzeguſſes, der Edelmetall- und Emaille-
kunſt. Hier hat man wirklich einige Haupt- und
Prachtſtücke aufgetrieben, namentlich ein paar Tumben,
d. h. kirchliche Schreine, die ja den Hauptruhmestitel
der ganzen rheiniſchen Edelmetallkunſt ausmachen;
hier feiert das Können der biederen Zunftmeiſter des
I2. und 13. Jahrhunderts ihre Triumphe. Vun
folgen in bunter Reihe Tragaltäre und große Vor-
tragkreuze, ſowie kirchliche Gefäße und Reliquiarien
aller Art. Bemerkenswerth iſt, wie man die all-
mähliche Stilentwicklung und Formenverfeinerung an
all dieſen Stücken, die in ihren Grundformen ſich
meiſt an den gothiſchen und romaniſchen Stil aulehnen,
verfolgen kann Die Werke des Meifters Anton
Eiſenhuth, die 3. B. noch vor den achziger Jahren
ſo gut wie unbekannt waren, haben heute ihre all-
gemeine Anerkennung gefunden.
In die Serie der Monumentalkunſt der
Plaſtik und Architektur führt uns die Abtheilung der
künſtleriſchen Reproduktionen hinüber. Aus den Denk-
mälerarchiven der beiden rheiniſchen Provinzen ſind
wirkungsvolle Blätter geſammelt, ebenſo wohlgeiungene
Aufnahmen wichtiger Denkmäler rheiniſcher Bau- und
Bildnerkunſt. So 3. B. die renovirten Bauwerke:
Rathhaus zu Aachen, Dom zu Trier und vor Allem
die in reinem gothiſchen Stil 1181 erbaute Willibrordi-
kirche in Weſel die von 1883 an von Staatswegen
renovirt wurde.
Eine ſuperbe Sammelausſtellung, die hier in
dieſer Reihe mit genannt werden muß, hat die unter
Leitung des Miniſteriums ſtehende Reßbildanſtalt
von Baurath Dr. Meydenbauer arrangirt. Es ſind
nahe an hundert Aufnahmen im Maßſtab von 1,10 m.
Hier wird man in wohlthuender Weiſe für einige
Mängel dex übrigen Abtheilungen entſchädigt: hier
kommt auch die intereſſante profane Kunſt des
Bheinlands zu ihrem Rechte: die wunderbar maleriſchen
Burgen und Schlöſſer, die Bathhäuſer und Feſtungen,
die ſtolzen Patrizier- und Bürgerhäuſer in ihrer treff-
lichen Architektonik und zum Theil oft wunderlichen
Raumgeſtaltung — ſie geben ein überraſchend voll-
kommenes Bild echter mittelalterlicher deutſcher Kunſt,
die den Wettbewerb mit den hiſtoriſchen mittelalter-
lichen Denkmälern Frankreichs und Englands nicht
zu ſcheuen braucht. Welch' prächtige Wirkung müßte
erſt ein Ausſtellungsunternehmen üben, das die
mittelalterlichen Kunſterzeugniſſe der gaͤnzen
deutſchen Lande in ſyſtematiſcher Grdnung vorführte.
Freilich in unſerer modernen, dem Bealen zugewandten
Seit iſt der Sinn für den Beiz der Vergangenheit
ſanft entſchlafen; wir lechzen nach neuen, unbekannten
Emotionen und haben darüber das Intereſſe für
Alles, was Hiſtorie heißt, verloren. . . .
Eine eigene Abtheilung der retroſpektiven Aus-
ſtellung bildet die von der rheiniſchen Provinzialkom-
miſſion beſorgte Sammlung farbiger Aufnahmen der
mittelalterlichen Wandmalereien. Seit vier
Jahren waren eine Reihe rheiniſcher Künſtler mit
der Anfertigung dieſer Aufnahmen beſchäftigt: die
Maler Vorländer, Winkel, Ehrich, Döringer, Schoofs,
Bardenhever u. A. Ein Theil der Serie iſt bereits
vor einigen Jahren im Berliner Kunſtgewerbemuſeum
öffentlich gezeigt worden. Bemerkenswerth iſt die
beſondere Sorgfalt, mit welcher auf die eigenthümliche
koloriſtik dieſer dekorativen Wandbilder Bedacht ge-
nommen iſt.
Den räumlich umfangreichſten Theil der ganzen
retroſpektiven Ausſtellung nimmt die Abtheilung der
Abgüſſe ein. Den Beſuchern der vorletzten Pariſer
Ausſtellung wird noch die Sammlung rieſiger, getönter
Abgüſſe von Werken der franzöſiſchen Plaſtik in Er-
innerung ſein. Sie war damals im Gſtflügel des
Trocadéro untergebracht. Heute iſt der ganze Bau
mit ſolchen Abgüſſen gefüllt, darunter gegen 40 Por-
tale, eine Menge Einzelfiguren, Grabmäler, Kamine
und Chorſtühle.
Für die deutſche Kunſtgeſchichte wäre eine der-
artige Sammlung ſchon längſt ein Bedürfniß,) das
mit der jüngſten Schöpfung des Pergamonmuſeums,
ſowie des Vürnberger Germaniſchen Muſeums
wenigſtens kleine Anfänge gezeitigt hat.
Düſſeldorf iſt auf dieſer Bahn einen Schritt
weiter gegangen. Es hat in ſeiner hier gezeigten
Abgußſammlung eine reiche und geſchickte Auswahl
bemerkenswerther hiſtoriſcher Kunſtdenkmäler heimiſcher
Provenienz getroffen: die impoſanten und ſtilreinen
Kirchenportale aus Trier, Laach, Münſter, Worms,
Paderborn, Coesfeld; das merkwürdige Doppelportal
*) Dal. Prof. Hans Sempers Auffätze in Jahrg. I unſerer Zeit-
ſchrift Nr. s u. Nr. 9.