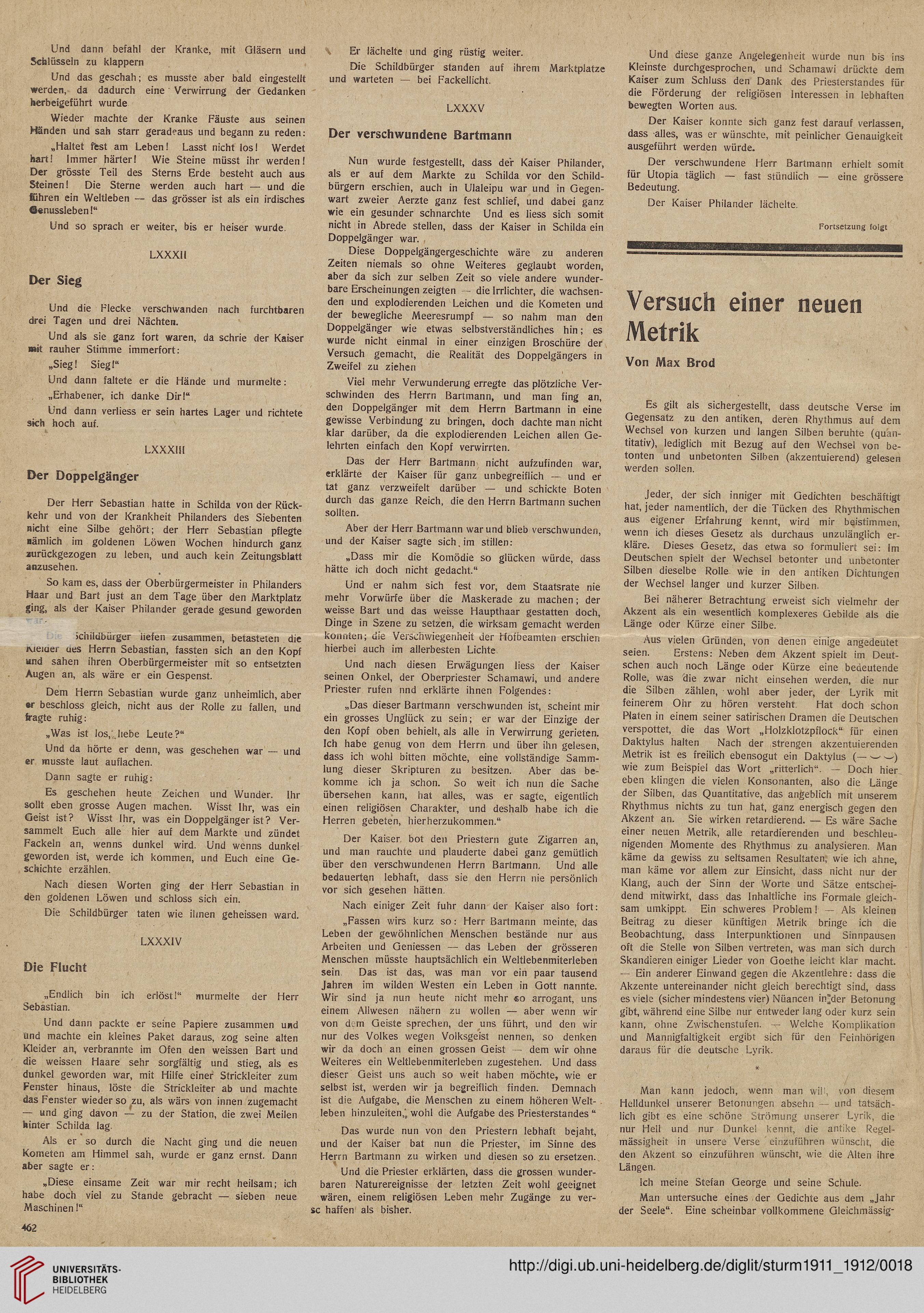Und dann befahl der Kranke, mit Qläsern und
Schlüsseln zu klappern
Und das geschah; es musste aber bald eingesteiit
werden, da dadurch eine Verwirrung der Qedanken
herbeigeführt wurde
Wieder machte der Kranke Fäuste aus seinen
Händen und sah starr geradeaus und begann zu reden:
„Haltet fest am Leben! Lasst nicht los! Werdet
hart! Immer härter! Wie Steine müsst ihr werden!
Der grösste Teil des Sterns Erde besteht auch aus
Steinen! Die Sterne werden auch hart — und die
führen ein Weltleben — das grösser ist als ein irdisches
Qenussleben!“
Und so sprach er weiter, bis er heiser wurde.
LXXXIl
Der Sieg
Und die Flecke verschwanden nach furchtbaren
drei Tagen und drei Nächten.
Und als sie ganz fort waren, da schrie der Kaiser
■»it rauher Stimme immerfort:
„Sieg! Sieg!“
Und dann faltete er die Hände und murmelte:
„Erhabener, ich danke Dir!“
Und dann verliess er sein hartes Lager und richtete
sich hoch auf.
LXXXIII
Der Doppelgänger
Der Herr Sebastian hatte in Schilda von der Rück-
kehr und von der Krankheit Philanders des Siebenten
nicht eine Silbe gehört; der Herr Sebastian pflegte
»ämlich im goldenen Löwen Wochen hindurch ganz
aurückgezogen zu leben, und auch kein Zeitungsblatt
anzusehen.
So kam es, dass der Oberbürgermeister in Philanders
Haar und Bart just an dem Tage über den Marktplatz
ging, als der Kaiser Philander gerade gesund geworden
ichildbürger iiefen zusammen, betasteien die
ivieiuer ues Herrn Sebastian, fassten sich an den Kopf
und sahen ihren Oberbürgermeister mit so entsetzten
Augen an, als wäre er ein Qespenst.
Dem Herrn Sebastian wurde ganz unheimlich, aber
»r beschloss gieich, nicht aus der Rolle zu fallen, und
Iragte ruhig:
„Was ist Ios,„hebe Leute?“
Und da hörte er denn, was geschehen war — und
er musste iaut auflachen.
Dann sagte er ruhig:
Es geschehen heute Zeichen und Wunder. Ihr
sollt eben grosse Augen machen. Wisst Ihr, was ein
Geist ist? Wisst Ihr, was ein Doppelgänger ist? Ver-
sammelt Euch alle hier auf dem Markte und zündet
Fackeln an, wenns dunkel wird. Und wenns dunkel
geworden ist, werde ich kommen, und Euch eine Qe-
schichte erzählen.
Nach diesen Worten ging der Herr Sebastian in
den goldenen Löwen und schloss sich ein.
Die Schildbürger taten wie ilmen geheissen ward.
LXXXIV
Die Flucht
„Endlich bin ich erlöst!“ murmelte der Herr
Sebastian.
Und dann packte er seine Papiere zusammen u«d
und machte ein kleines Paket daraus, zog seine alten
Kleider an, verbrannte im Ofen den weissen Bart und
die weissen Haare sehr sorgfältig und stieg, als es
dunkel geworden war, mit Hilfe einer Strickleiter zum
Fenster hinaus, löste die Strickleiter ab und machte
das Fenster wieder so zu, a!s wärs von innen zugemacht
— und ging davon — zu der Station, die zwei Meilen
hinter Schilda lag
Als er so durch die Nacht ging und die neuen
Kometen am Himmel sah, wurde er ganz ernst. Dann
aber sagte er:
„Diese einsame Zeit war mir recht heilsam; ich
habe doch viel zu Stande gebracht — sieben neue
Maschinen!“
\ Er lächelte und ging rüstig weiter.
Die Schildbürger standen auf ihrem Marktplatze
und warteten — bei Fackellicht.
LXXXV
Der verschwundene Bartmann
Nun wurde festgestellt, dass de'r Kaiser Philander,
als er auf dem Markte zu Schilda vor den Schild-
bürgern erschien, auch in Ulaleipu war und in Gegen-
wart zweier Aerzte ganz fest schlief, und dabei ganz
wie ein gesunder schnarchte Und es liess sich somit
nicht in Abrede stellen, dass der Kaiser in Schilda ein
Doppelgänger war.
Diese Doppelgängergeschichte wäre zu anderen
Zeiten niemais so ohne Weiteres geglaubt worden,
aber da sich zur selben Zeit so viele andere wunder-
bare Erscheinungen zeigten die lrrlichter, die wachsen-
den und explodierenden Leichen und die Kometen und
der bewegliche Meeresrumpf — so nahm nian den
Doppelgänger wie etwas selbstverständliches hin; es
wurde nicht einmal in einer einzigen Broschüre der
Versuch gemacht, die Realität des Doppelgängers in
Zweifel zu ziehen
Viel mehr Verwunderung erregte das plötzliche Ver-
schwinden des Herrn Bartmann, und man fing an,
den Doppelgänger mit dem Herrn Bartmann in eine
gewisse Verbindung zu bringen, doch dachte man nicht
klar darüber, da die explodierenden Leichen allen Qe-
lehrten einfach den Kopf verwirrten.
Das der Herr Bartmann nicht aufzufinden war,
erklärte der Kaiser für ganz unbegreiflich — und er
tat ganz verzweifelt darüber — und schickte Boten
durch das ganze Reich, die den Herrn Bartmann suchen
sollten.
Aber der Herr Bartmann war und blieb verschwunden,
und der Kaiser sagte sich.im stillen:
„Dass mir die Komödie so glücken würde, dass
hätte ich doch nicht gedacht.“
Und er nahm sich fest vor, dem Staatsrate nie
mehr Vorwürfe über die Maskerade zu machen; der
weisse Bart und das weisse Haupthaar gestatten doch,
Dinge in Szene zu setzen, die wirksam gemacht werden
konnten; uie Verscnwiegenheit der Hofbeamten erschien
hierbei auch im allerbesten Lichte
Und nach diesen Erwägungen liess der Kaiser
seinen Onkel, der Oberpriester Schamawi, und andere
Priester rufen nnd erklärte ihnen Folgendes:
„Das dieser Bartmann verschwunden ist, scheint mir
ein grosses Unglück zu sein; er war der Einzige der
den Kopf oben behielt, als alle in Verwirrung gerieten.
Ich habe genug von dem Herrn und über ihn gelesen,
dass ich wohl bitten möchte, eine vollständige Samm-
lung dieser Skripturen zu besitzen. Aber das be-
komme ich ja schon. So weit ich nun die Sache
übersehen kann, hat alles, was er sagte, eigentlich
einen religiösen Charakter, und deshalb habe ich die
Herren gebeten, hierherzukommen.“
Der Kaiser bot den Priestern gute Zigarren an,
und man rauchte und plauderte dabei ganz gemütlich
über den verschwundenen Herrn Bartmann. Und aile
bedauerten lebhaft, dass sie den Herrn nie persönlich
vor sich gesehen hätten.
Nach einiger Zeit fuhr dann der Kaiser also fort:
„Fassen wirs kurz so: Herr Bartmann meinte, das
Leben der gewöhnlichen Menschen bestände nur aus
Arbeiten und Qeniessen — das Leben der grösseren
Menschen müsste hauptsächiich ein Weltlebenmiterleben
sein Das ist das, was man vor ein paar tausend
Jahren im wilden Westen ein Leben in Qott nannte.
Wir sind ja nun heute nicht mehr «o arrogant, uns
einem Allwesen nähern zu wollcn — aber wenn wir
von d.m Qeiste sprechen, der uns führt, und den wir
nur des Volkes wegen Volksgeist nennen, so denken
wir da doch an einen grossen Qeist — dem wir ohne
Weiteres ein Weltlebenmiterleben zugestehen. Und dass
dieser Qeist uns auch so weit haben möchte, wie er
selbst ist, werden wir ja begreiflich finden. Demnach
ist die Aufgabe, die Menschen zu einem höheren Welt-
leben hinzuleiten,) wohl die Aufgabe des Priesterstandes “
Das wurde nun von den Priestern lebhaft bejaht,
und der Kaiser bat nun die Priester, im Sinne des
Herrn Bartmann zu wirken und diesen so zu ersetzen.
-
Und die Priester erklärten, dass die grossen wunder-
baren Naturereignisse der Ietzten Zeit wohl geeignet
wären, einem religiösen Leben mehr Zugänge zu ver-
sc haffen als bisher.
Und diese ganze Angelegenheit wurde nun bis ins
Kleinste durchgesprochen, und Schamawi drückte dem
Kaiser zum Schluss den Dank des Priesterstandes für
die Förderung der religiösen Interessen in lebhaften
bewegten Worten aus.
Der Kaiser konnte sich ganz fest darauf verlassen,
dass alles, was er wünschte, mit peinlicher Genauigkeit
ausgeführt werden würde.
Der verschwundene Herr Bartmann erhielt somit
für Utopia täglich — fast stündlich — eine grössere
Bedeutung.
Der Kaiser Philander lächelte.
Fortsetzung folgt
Versuch einer neuen
Metrik
Von Max Brod
Es gilt als sichergestellt, dass deutsche Verse im
Qegensatz zu den antiken, deren Rhythmus auf dem
Wechsel von kurzen und langen Silben beruhte (qu'an-
titativ), ledigiich mit Bezug auf den Wechse! von be-
tonten und unbetonten Silben (akzentuierend) gelesen
werden sollen.
Jeder, der sich inniger mit Qedichten beschäftigt
hat, jeder namentlich, der die Tücken des Rhythmischen
aus eigener Erfahrung kennt, wird mir beistimmen,
wenn ich dieses Gesetz als durchaus unzulänglich er-
kläre. Dieses Gesetz, das etwa so formuliert sei: Im
Deutschen spieit der Wechsel betonter und unbetonter
Silben dieselbe Rolle wie in den antiken Dichtungen
der Wechsel Ianger und kurzer Silben.
Bei näherer Betrachtung erweist sich vielmehr der
Akzent als ein wesentlich komplexeres Gebilde als die
Länge oder Kiirze einer Silbe.
Aus vielen üründen, von denen einige angedeutet
seien. Erstens: Neben dem Akzent spielt im Deut-
schen auch noch Länge oder Kürze eine bedeutende
Rolle, was die zwar nicht einsehen werden, die nur
die Silben zählen, wohl aber jeder, der Lyrik mit
feinerem Ohr zu hören versteht Hat doch schon
Platen in einem seiner satirischen Dramen die Deutschen
verspottet, die das Wort „Holzklotzpflock“ für einen
Daktylus halten Nach der strengen akzentuierenden
Metrik ist es freilich ebensogut ein Daktylus (— —■'—)
wie zum Beispiel das Wort „ritterlich“. — Doch hier
eben klingen die vielen Konsonanten, also die Länge
der Silben, das Quantitative, das angeblich mit unserem
Rhythinus nichts zu tun hat, ganz energisch gegen den
Akzent an. Sie wirken retardierend. — Es wäre Sache
einer neuen Metrik, alle retardierenden und beschleu-
nigenden Momente des Rhythmus zu analysieren. Man
käme da gewiss zu seltsamen Resultaten, wie ich ahne,
man käme vor allem zur Einsicht, dass nicht nur der
Klang, auch der Sinn der Worte und Sätze entschei-
dend mitwirkt, dass das Inhaltliche ins Formale gleich-
sam umkippt. Ein schweres Problem I — Als kleinen
Beitrag zu dieser künftigen Metrik bringe ich die
Beobachtung, dass Interpunktionen und Sinnpausen
oft die Stelle von Silben vertreten, was man sich durch
Skandieren einiger Lieder von Goethe leicht klar macht.
— Ein anderer Einwand gegen die Akzentlehre: dass die
Akzente untereinander nicht gleich berechtigt sind, dass
es viele (sicher mindestens vier) Nüancen in^der Betonung
gibt, während eine Silbe nur entweder lang oder kurz sein
kann, ohne Zwischenstufen. — Welche Komplikation
und Mannigfaltigkeit ergibt sich für den Feinhörigen
daraus für die deutsche Lyrik.
*
Man kann jedoch, wenn man will, von diesem
Helldunkel unserer Betonungen absehn und tatsäch-
lich gibt es eine schöne Strömung unserer Lyrik, die
nur Heil und nur Dunkel kennt, die antike Regel-
mässigheit in unsere Verse einzuführen wünscht, die
den Akzent so einzuführen wünscht, wie die Alten ihre
Längen.
Ich meine Stefan George und seine Schule.
Man untersuche eines der Qedichte aus dem „Jahr
der Seele“. Eine scheinbar vollkommene Qleichmässig-
462
Schlüsseln zu klappern
Und das geschah; es musste aber bald eingesteiit
werden, da dadurch eine Verwirrung der Qedanken
herbeigeführt wurde
Wieder machte der Kranke Fäuste aus seinen
Händen und sah starr geradeaus und begann zu reden:
„Haltet fest am Leben! Lasst nicht los! Werdet
hart! Immer härter! Wie Steine müsst ihr werden!
Der grösste Teil des Sterns Erde besteht auch aus
Steinen! Die Sterne werden auch hart — und die
führen ein Weltleben — das grösser ist als ein irdisches
Qenussleben!“
Und so sprach er weiter, bis er heiser wurde.
LXXXIl
Der Sieg
Und die Flecke verschwanden nach furchtbaren
drei Tagen und drei Nächten.
Und als sie ganz fort waren, da schrie der Kaiser
■»it rauher Stimme immerfort:
„Sieg! Sieg!“
Und dann faltete er die Hände und murmelte:
„Erhabener, ich danke Dir!“
Und dann verliess er sein hartes Lager und richtete
sich hoch auf.
LXXXIII
Der Doppelgänger
Der Herr Sebastian hatte in Schilda von der Rück-
kehr und von der Krankheit Philanders des Siebenten
nicht eine Silbe gehört; der Herr Sebastian pflegte
»ämlich im goldenen Löwen Wochen hindurch ganz
aurückgezogen zu leben, und auch kein Zeitungsblatt
anzusehen.
So kam es, dass der Oberbürgermeister in Philanders
Haar und Bart just an dem Tage über den Marktplatz
ging, als der Kaiser Philander gerade gesund geworden
ichildbürger iiefen zusammen, betasteien die
ivieiuer ues Herrn Sebastian, fassten sich an den Kopf
und sahen ihren Oberbürgermeister mit so entsetzten
Augen an, als wäre er ein Qespenst.
Dem Herrn Sebastian wurde ganz unheimlich, aber
»r beschloss gieich, nicht aus der Rolle zu fallen, und
Iragte ruhig:
„Was ist Ios,„hebe Leute?“
Und da hörte er denn, was geschehen war — und
er musste iaut auflachen.
Dann sagte er ruhig:
Es geschehen heute Zeichen und Wunder. Ihr
sollt eben grosse Augen machen. Wisst Ihr, was ein
Geist ist? Wisst Ihr, was ein Doppelgänger ist? Ver-
sammelt Euch alle hier auf dem Markte und zündet
Fackeln an, wenns dunkel wird. Und wenns dunkel
geworden ist, werde ich kommen, und Euch eine Qe-
schichte erzählen.
Nach diesen Worten ging der Herr Sebastian in
den goldenen Löwen und schloss sich ein.
Die Schildbürger taten wie ilmen geheissen ward.
LXXXIV
Die Flucht
„Endlich bin ich erlöst!“ murmelte der Herr
Sebastian.
Und dann packte er seine Papiere zusammen u«d
und machte ein kleines Paket daraus, zog seine alten
Kleider an, verbrannte im Ofen den weissen Bart und
die weissen Haare sehr sorgfältig und stieg, als es
dunkel geworden war, mit Hilfe einer Strickleiter zum
Fenster hinaus, löste die Strickleiter ab und machte
das Fenster wieder so zu, a!s wärs von innen zugemacht
— und ging davon — zu der Station, die zwei Meilen
hinter Schilda lag
Als er so durch die Nacht ging und die neuen
Kometen am Himmel sah, wurde er ganz ernst. Dann
aber sagte er:
„Diese einsame Zeit war mir recht heilsam; ich
habe doch viel zu Stande gebracht — sieben neue
Maschinen!“
\ Er lächelte und ging rüstig weiter.
Die Schildbürger standen auf ihrem Marktplatze
und warteten — bei Fackellicht.
LXXXV
Der verschwundene Bartmann
Nun wurde festgestellt, dass de'r Kaiser Philander,
als er auf dem Markte zu Schilda vor den Schild-
bürgern erschien, auch in Ulaleipu war und in Gegen-
wart zweier Aerzte ganz fest schlief, und dabei ganz
wie ein gesunder schnarchte Und es liess sich somit
nicht in Abrede stellen, dass der Kaiser in Schilda ein
Doppelgänger war.
Diese Doppelgängergeschichte wäre zu anderen
Zeiten niemais so ohne Weiteres geglaubt worden,
aber da sich zur selben Zeit so viele andere wunder-
bare Erscheinungen zeigten die lrrlichter, die wachsen-
den und explodierenden Leichen und die Kometen und
der bewegliche Meeresrumpf — so nahm nian den
Doppelgänger wie etwas selbstverständliches hin; es
wurde nicht einmal in einer einzigen Broschüre der
Versuch gemacht, die Realität des Doppelgängers in
Zweifel zu ziehen
Viel mehr Verwunderung erregte das plötzliche Ver-
schwinden des Herrn Bartmann, und man fing an,
den Doppelgänger mit dem Herrn Bartmann in eine
gewisse Verbindung zu bringen, doch dachte man nicht
klar darüber, da die explodierenden Leichen allen Qe-
lehrten einfach den Kopf verwirrten.
Das der Herr Bartmann nicht aufzufinden war,
erklärte der Kaiser für ganz unbegreiflich — und er
tat ganz verzweifelt darüber — und schickte Boten
durch das ganze Reich, die den Herrn Bartmann suchen
sollten.
Aber der Herr Bartmann war und blieb verschwunden,
und der Kaiser sagte sich.im stillen:
„Dass mir die Komödie so glücken würde, dass
hätte ich doch nicht gedacht.“
Und er nahm sich fest vor, dem Staatsrate nie
mehr Vorwürfe über die Maskerade zu machen; der
weisse Bart und das weisse Haupthaar gestatten doch,
Dinge in Szene zu setzen, die wirksam gemacht werden
konnten; uie Verscnwiegenheit der Hofbeamten erschien
hierbei auch im allerbesten Lichte
Und nach diesen Erwägungen liess der Kaiser
seinen Onkel, der Oberpriester Schamawi, und andere
Priester rufen nnd erklärte ihnen Folgendes:
„Das dieser Bartmann verschwunden ist, scheint mir
ein grosses Unglück zu sein; er war der Einzige der
den Kopf oben behielt, als alle in Verwirrung gerieten.
Ich habe genug von dem Herrn und über ihn gelesen,
dass ich wohl bitten möchte, eine vollständige Samm-
lung dieser Skripturen zu besitzen. Aber das be-
komme ich ja schon. So weit ich nun die Sache
übersehen kann, hat alles, was er sagte, eigentlich
einen religiösen Charakter, und deshalb habe ich die
Herren gebeten, hierherzukommen.“
Der Kaiser bot den Priestern gute Zigarren an,
und man rauchte und plauderte dabei ganz gemütlich
über den verschwundenen Herrn Bartmann. Und aile
bedauerten lebhaft, dass sie den Herrn nie persönlich
vor sich gesehen hätten.
Nach einiger Zeit fuhr dann der Kaiser also fort:
„Fassen wirs kurz so: Herr Bartmann meinte, das
Leben der gewöhnlichen Menschen bestände nur aus
Arbeiten und Qeniessen — das Leben der grösseren
Menschen müsste hauptsächiich ein Weltlebenmiterleben
sein Das ist das, was man vor ein paar tausend
Jahren im wilden Westen ein Leben in Qott nannte.
Wir sind ja nun heute nicht mehr «o arrogant, uns
einem Allwesen nähern zu wollcn — aber wenn wir
von d.m Qeiste sprechen, der uns führt, und den wir
nur des Volkes wegen Volksgeist nennen, so denken
wir da doch an einen grossen Qeist — dem wir ohne
Weiteres ein Weltlebenmiterleben zugestehen. Und dass
dieser Qeist uns auch so weit haben möchte, wie er
selbst ist, werden wir ja begreiflich finden. Demnach
ist die Aufgabe, die Menschen zu einem höheren Welt-
leben hinzuleiten,) wohl die Aufgabe des Priesterstandes “
Das wurde nun von den Priestern lebhaft bejaht,
und der Kaiser bat nun die Priester, im Sinne des
Herrn Bartmann zu wirken und diesen so zu ersetzen.
-
Und die Priester erklärten, dass die grossen wunder-
baren Naturereignisse der Ietzten Zeit wohl geeignet
wären, einem religiösen Leben mehr Zugänge zu ver-
sc haffen als bisher.
Und diese ganze Angelegenheit wurde nun bis ins
Kleinste durchgesprochen, und Schamawi drückte dem
Kaiser zum Schluss den Dank des Priesterstandes für
die Förderung der religiösen Interessen in lebhaften
bewegten Worten aus.
Der Kaiser konnte sich ganz fest darauf verlassen,
dass alles, was er wünschte, mit peinlicher Genauigkeit
ausgeführt werden würde.
Der verschwundene Herr Bartmann erhielt somit
für Utopia täglich — fast stündlich — eine grössere
Bedeutung.
Der Kaiser Philander lächelte.
Fortsetzung folgt
Versuch einer neuen
Metrik
Von Max Brod
Es gilt als sichergestellt, dass deutsche Verse im
Qegensatz zu den antiken, deren Rhythmus auf dem
Wechsel von kurzen und langen Silben beruhte (qu'an-
titativ), ledigiich mit Bezug auf den Wechse! von be-
tonten und unbetonten Silben (akzentuierend) gelesen
werden sollen.
Jeder, der sich inniger mit Qedichten beschäftigt
hat, jeder namentlich, der die Tücken des Rhythmischen
aus eigener Erfahrung kennt, wird mir beistimmen,
wenn ich dieses Gesetz als durchaus unzulänglich er-
kläre. Dieses Gesetz, das etwa so formuliert sei: Im
Deutschen spieit der Wechsel betonter und unbetonter
Silben dieselbe Rolle wie in den antiken Dichtungen
der Wechsel Ianger und kurzer Silben.
Bei näherer Betrachtung erweist sich vielmehr der
Akzent als ein wesentlich komplexeres Gebilde als die
Länge oder Kiirze einer Silbe.
Aus vielen üründen, von denen einige angedeutet
seien. Erstens: Neben dem Akzent spielt im Deut-
schen auch noch Länge oder Kürze eine bedeutende
Rolle, was die zwar nicht einsehen werden, die nur
die Silben zählen, wohl aber jeder, der Lyrik mit
feinerem Ohr zu hören versteht Hat doch schon
Platen in einem seiner satirischen Dramen die Deutschen
verspottet, die das Wort „Holzklotzpflock“ für einen
Daktylus halten Nach der strengen akzentuierenden
Metrik ist es freilich ebensogut ein Daktylus (— —■'—)
wie zum Beispiel das Wort „ritterlich“. — Doch hier
eben klingen die vielen Konsonanten, also die Länge
der Silben, das Quantitative, das angeblich mit unserem
Rhythinus nichts zu tun hat, ganz energisch gegen den
Akzent an. Sie wirken retardierend. — Es wäre Sache
einer neuen Metrik, alle retardierenden und beschleu-
nigenden Momente des Rhythmus zu analysieren. Man
käme da gewiss zu seltsamen Resultaten, wie ich ahne,
man käme vor allem zur Einsicht, dass nicht nur der
Klang, auch der Sinn der Worte und Sätze entschei-
dend mitwirkt, dass das Inhaltliche ins Formale gleich-
sam umkippt. Ein schweres Problem I — Als kleinen
Beitrag zu dieser künftigen Metrik bringe ich die
Beobachtung, dass Interpunktionen und Sinnpausen
oft die Stelle von Silben vertreten, was man sich durch
Skandieren einiger Lieder von Goethe leicht klar macht.
— Ein anderer Einwand gegen die Akzentlehre: dass die
Akzente untereinander nicht gleich berechtigt sind, dass
es viele (sicher mindestens vier) Nüancen in^der Betonung
gibt, während eine Silbe nur entweder lang oder kurz sein
kann, ohne Zwischenstufen. — Welche Komplikation
und Mannigfaltigkeit ergibt sich für den Feinhörigen
daraus für die deutsche Lyrik.
*
Man kann jedoch, wenn man will, von diesem
Helldunkel unserer Betonungen absehn und tatsäch-
lich gibt es eine schöne Strömung unserer Lyrik, die
nur Heil und nur Dunkel kennt, die antike Regel-
mässigheit in unsere Verse einzuführen wünscht, die
den Akzent so einzuführen wünscht, wie die Alten ihre
Längen.
Ich meine Stefan George und seine Schule.
Man untersuche eines der Qedichte aus dem „Jahr
der Seele“. Eine scheinbar vollkommene Qleichmässig-
462