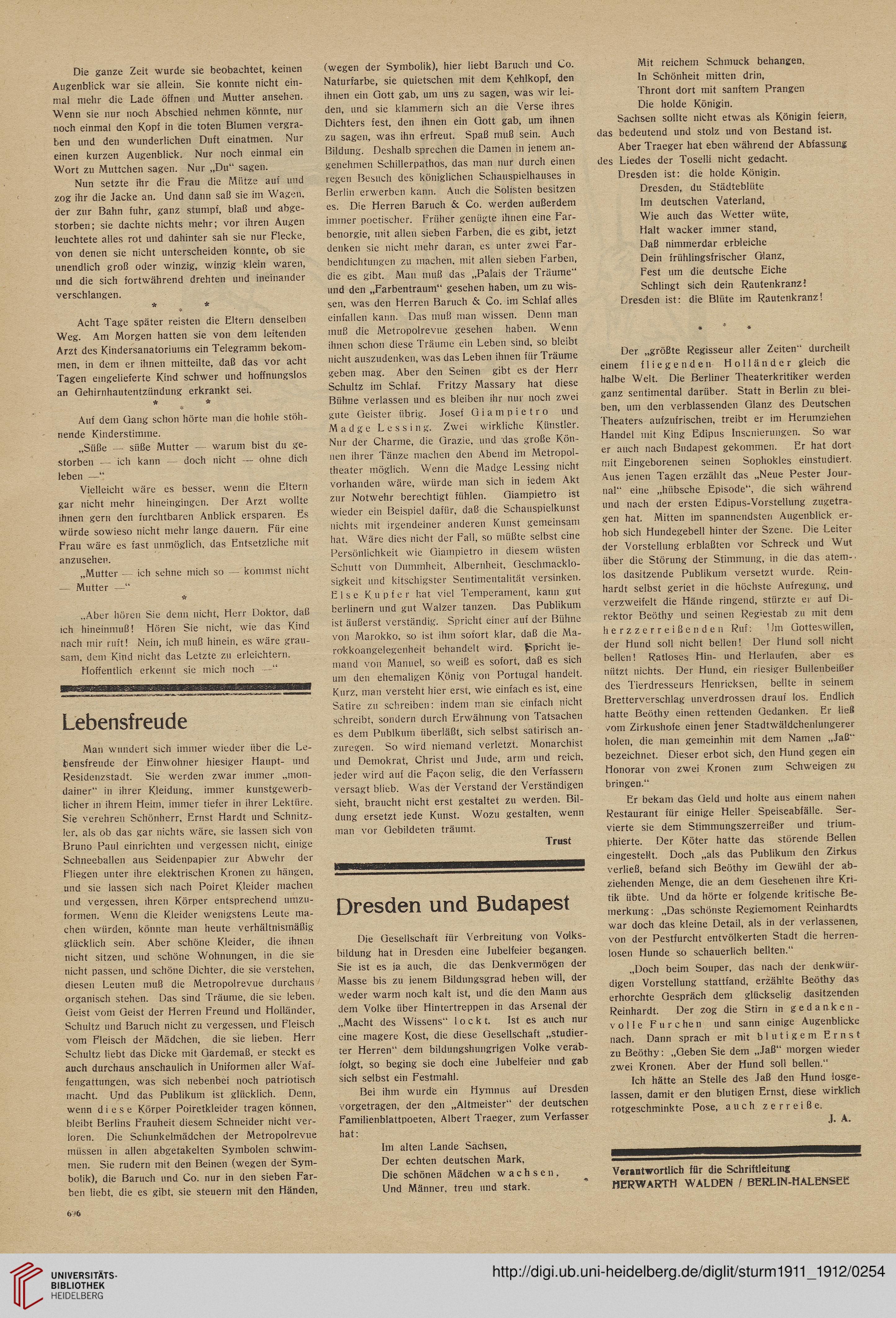Die ganze Zeit wurde sie beobachtet, keinen
Augenblick war sie allein. Sie konnte nicht ein-
nial mehr die Lade öffnen und Mutter ansehen.
Wenn sie nur noch Abschied nehmen könnte, nur
noch einmal den Kopf in die toten Blumen vergra-
fcen und den wunderlichen Duft einatmen. Nur
einen kurzen Augenblick. Nur noch einmal ein
Wort zu Muttchen sagen. Nur „Du“ sagen.
Nun setzte ihr die Frau die Miitze auf urid
zog ihr die Jacke an. Und dann saß sie iin Wagen,
aer zur Bahn fuhr, ganz stumpf, blaß und abge-
storben; sie dachte nichts mehr; vor ihren Augen
leuchtete alles rot und dahinter sah sie nur Flecke,
von denen sie nicht unterscheiden konnte, ob sie
unendlich groß oder winzig, winzig klein waren,
und die sich fortwährend drehten und ineinander
verschlangen.
* *
*
Acht Tage später reisten die Eltern denselben
Weg. Am Morgen hatten sie von dem leitenden
Arzt des Kindersanatoriums ein Telegramm bekom-
men, in dem er ihnen mitteilte, daß das vor acht
Tagen eingelieferte Kind schwer und hoffnungslos
an Gehirnhautentzündung erkrankt sei.
* *
*
Auf dem üang schon hörte nian die hohle stöh-
nende Kinderstimme.
„Siiße - siiße Mutter — warurn bist du ge-
storben — ich kann doch nicht — ohne dich
leben —“
Vielleicht wäre es besser. wenn die Eltern
gar nicht mehr hineingingen. Der Arzt wollte
ihnen gern den furchtbaren Anblick ersparen. Es
würde sowieso nicht mehr lange datiern. Für eine
Frau wäre es fast unmöglich, das Entsetzliche mit
anzusehet’.
„Mutter - ich sehne mich so — kornnist nicht
— Mutter —“
*
„Aber hören Sie denit nicht, Herr Doktor, daß
tch hineinnruß! Hören Sie nicht, wie das Kind
nach rnir ruft! Nein, ich rnuß hinein, es wäre grati-
sam. denr Kind nicht das Letzte ztt erleichtern.
Hoffentiich erkennt sie mich rioch —“
Lebensfreude
Man wundert sich imrner wieder iiber die Le-
fcensfreude der Einwohner hiesiger Haupt- und
Residenzstadt. Sie werden zwar irnmer „mon-
dainer“ in ihrer Kleidung, immer kunstgewerb-
licher ln ihrertr Heim, imnier tiefer in ihrer Lektiire.
Sie verehreu Schönherr, Ernst Hardt und Schnitz-
ler, als ob das gar nichts wäre, sie lassen sich von
Bruno Paul einrichten tind vergessen nicht, einige
Schneeballen aus Seidenpapier zur Abwehr der
Fliegen unter ihre eiektrischen Kronen zu hängen,
und sie lassen sich nach Poiret Kleider machen
und vergessen, lhren Körper entsprechend timzu-
forrnen. Wenn die Kleider wenigstens Leute ma-
chen wiirden, könnte tnan heute verhältnismäßig
glücklich sein. Aber schöne Kleider, die ihnen
nicht sitzen, und schöne Wohnungen, in die sie
nicht passen, und schöne Dichter, die sie verstehen,
diesen Leuten muß die Metropolrevue durchaus
organisch stehen. Das sind Träutne, die sie leben.
Geist vom Geist der Herren Freuiid tmd Holländer,
Schultz tind Baruch nicht zu vergessen, und Fleisch
vom Fleisch der Mädchen, die sie lieben. Herr
Schultz liebt das Däcke mit Gardemaß, er steckt es
auch durchaus anschaulich in Uniforrnen aller Waf-
fengattungen, was sich nebenbei noch patriotisch
inacht. Und das Publikum ist gliicklich. Denn,
wenn d i e s e Körper Poiretkleider tragen können,
bleibt Berlins Frauheit diesem Schneider nicht ver-
loren. Die Schunkelmädchen der Metropolrevue
müssen in allen abgetakelten Symbolen schwim-
men. Sie rudern mit den Beinen (wegen der Sym-
bolik), die Baruch und Co. nur in den sieben Far-
ben liebt, die es gibt, sie steuern rnit den Händen,
(wegen der Symbolik), hier liebt Baruch und Co.
Naturfarbe, sie quietschen mit dem Kehlkopf, den
ihnen ein Gott gab, um uns zu sagen, was wir lei-
den, und sie klammern sich an die Verse ihres
Dichters fest, den ihnen ein Gott gab, um ihnen
zu sagen, was ihn erfreut. Spaß muß sein. Auch
Bildung. Deshalb sprechen die Damen in jenem an-
genehmen Schillerpathos, das man nur durch eiiren
regeri Besuch des königlichen Schauspielhauses in
Berlin erwerben kann. Auch die Solisten besitzen
es. Die Herren Baruch & Co. werden außerdem
immer poetischer. Friiher genügte ihnen eine Far-
benorgie, niit allen sieben Farben, die es gibt, jetzt
denken sie nicht mehr daran, es unter zwei Far-
bendichtungen zu machen. nrit allen sieben Farben,
die es gibt. Man muß das „Palais der Träume“
und den „Farbentraum“ gesehen haben, um zu wis-
sen, was den Herren Baruch & Co. im Schlaf ailes
einfallen kann. Das inuß man wissen. Denn man
muß die Metropolrevue gesehen haben. Werni
ihnen schon diese Trätime ein Leben sind, so bleibt
nicht ausztidenken, was das Leben ihnen fiir Träume
geben mag. Aber den Seinen gibt es der Herr
Schultz im Schlaf. Fritzy Massary hat diese
Btihne verlassen und es bleiben ihr nur noch zwei
gute Geister iibrig. Josef Giampietro und
M a d g e L e s s i n g. Zwei wirkliche Kiinstler.
Nttr der Charme, die Grazie, und das große Kön-
nen ihrer Tänze maclien den Abend im Metropol-
theater rnöglich. Wenn die Madge Lessing nicht
vorhanden wäre, würde man sich in iedern Akt
zur Notwehr berechtigt fiihlen. Giampietro ist
wieder ein Beispiel dafür, daß die Schauspielkunst
nichts nrit irgendeiner anderen Kunst gemeinsam
hat. Wäre dies nicht der Fall, so miißte selbst eine
Persönlichkeit wie Giampietro in diesem wiisten
Schutt von Dummheit, Alberriheit, Geschmacklo-
sigkeit und kitschigster Sentimentalität versinken.
E 1 s e K u p f e r hat viel Temperament, kann gut
berlinern und gut Walzer tanzen. Das Publikum
ist äußerst verständig. Spricht einer auf der Bühne
von Marokko, so ist ihm sotort klar, daß die Ma-
rökkoangelegenheit behandelt wird. fspricht ;je-
riiand von Manuel, so weiß es sofort, daß es sich
um den ehemaligen König von Portugal handelt.
Kurz, man versteht hier erst, wie einfach es ist, eine
Satire zu schreiben: indem man sie einfach nicht
schreibt, sondern durch Erwähnung von Tatsachen
es dem Publkum iiberläßt, sich selbst satirisch an-
zuregen. So wird nienrand verletzt. Monarchist
und Demokrat, Christ und Jude, arnr und reich,
jeder wird auf die Faeon selig, die den Verfassern
versagt blieb. Was der Verstand der Verständigen
sieht, braucht nicht erst gestaltet zu werden. Bil-
dung ersetzt jede Kunst. Wozu gestalten, wenn
man vor Gebildeten träunrt.
Dresden und Budapest
Die Qesellschaft für Verbreitung von Volks-
bildung hat in Dresden eine Jubelfeier begangen.
Sie ist es ja aueh, die das Denkvermögen der
Masse bis zu jenem Bildungsgrad heben will, der
weder warm noch kalt ist, und die den Mann aus
dem Volke über Hintertreppen in das Arsenal der
„Macht des Wissens“ lockt. Ist es auch nur
cine magere Kost, die diese Gesellschaft „studier-
ter Herren“ dem bildungshungrigen Volke verab-
folgt, so beging sie doch eine Jubelfeier nnd gab
sich selbst ein Festmahl.
Bei ihm wurde ein Hymnus aut Dresden
vorgetragen, der den „Aitmeister“ der deutschen
Familienblattpoeten, Albert Traeger, zum Verfasser
hat:
Im alten Lande Sachsen,
Der echten deutschen Mark,
Die schönen Mädchen w a c h s e n ,
Und Männer. treu mid stark.
Mit reichem Schmuck behangeu,
In Schönheit mitten drin,
Thront dort mit sanftem Prangen
Die holde Königin.
Sachsen sollte nicht etwas als Königin feiern,
das bedeutend und stolz und von Bestand ist.
AberTraeger hat eben während der Abfassung
des Liedes der Toselli nicht gedacht.
Dresden ist: die holde Königin.
Dresden, du Städteblüte
Im deutschen Vateriand,
Wie auch das Wetter wiite,
tlalt wacker immer stand,
Daß nimmerdar erbleiche
Dein friihlingsfrischer Glanz,
Fest um die deutsche Eiche
Schlingt sich dein Rautenkranz»
Dresden ist: die Bliite im Rautenkranz!
Der „größte Regisseur aller Zeiten" durcheilt
einem f 1 i e g e n d e n H o 11 ä n d e r gteich die
halbe Welt. Die Berliner Theaterkritiker werden
ganz sentimental dariiber. Statt in Berlin zu blei-
ben, um den verblassenden Glanz des Deutschen
Theaters aufzufrischen, treibt er im Herumziehen
Handel init King Edipus Inscnierungen. So war
er atich nach Budapest gekommen. Er hat dort
mit Eingeborenen seinen Sophokles einstudiert.
Aus jenen Tagen erzählt das „Neue Pester Jour-
nal“ eine „hübsche Episode“, die sich während
und nach der ersten Edipus-Vorstellung zugetra-
gen hat. Mitten im spannendsten Augenblick er-
hob sich Hundegebell hinter der Szene. Die Leiter
der Vorstellung erblaßten vor Schreck und Wut
iiber die Störung der Stimmung, in die das atem-'
los dasitzende Publikum versetzt wurde. Rein-
hardt selbst geriet in die höchste Aufregung, und
verzweifelt die Hände ringend, stiirzte ei auf Di-
rektor Beöthy und seinen l^egiestab zu mit dem
herzzerreißenden Rur: !Jm Gotteswillen,
der Hund soll nicht belien! Der Hund soll nicht
bellen! Ratloses Hin- und Herlaufen, aber es
niitzt nichts. Der Hund, ein riesiger Bullenbeißer
des Tierdresseurs Henricksen, bellte in seinem
Bretterverschlag unverdrossen drauf los. Endlich
hatte Beöthy einen rettenden Gedanken. Er ließ
voin Zirkushofe einen jener Stadtwäldchenlungerer
holen, die man gemeinhin mit dem Namen „Jaß“
bezeichnet. Dieser erbot sich, den Hund gegen ein
Honorar von zwei Kronen ztim Schweigen zu
bringen.“
Er bekarn das Geid und holte aus einern naheu
Restaurant für einige Heiler Speiseabfälle. Ser-
vierte sie dem Stimmungszerreißer und trium-
phierte. Der Köter hatte das störende ßellen
eingestellt. Doch „als das Publikum den Zirkus
verließ, befand sich Beöthy im Gewühl der ab-
ziehenden Menge, die an dem Gesehenen ihre Kri-
tik iibte. Und da hörte er folgende kritische Be-
rnerkung: „Das schönste Regiemoment Reinhardts
war doch das kleine Detail, als in der verlassenen,
von der Pestfurcht entvölkerten Stadt die herren-
losen Hunde so schauerlich bellten.“
„Doch beim Souper, das nach der denkwür-
digen Vorstellung stattfand, erzählte Beöthy das
erhorchte Gespräch dem glückselig dasitzenden
Reinhardt. Der zog die Stirn in gedanken-
volle Furchen und sann einige Augenblicke
nach. Dann sprach er mit blutigem Ernst
zu Beöthy: „Geben Sie dem „Jaß“ morgen wieder
zwei Kronen. Aber der Hund soll bellen.“
Ich hätte an Stelle des Jaß den Hund losge-
lassen, damit er den blutigen Ernst, diese wirklich
rotgeschminkte Pose, auch zerreiße.
A.
Verantwortlich für die Schriftleitung
HERWARTH WALDEN / BERLIN-HALENSEE
Augenblick war sie allein. Sie konnte nicht ein-
nial mehr die Lade öffnen und Mutter ansehen.
Wenn sie nur noch Abschied nehmen könnte, nur
noch einmal den Kopf in die toten Blumen vergra-
fcen und den wunderlichen Duft einatmen. Nur
einen kurzen Augenblick. Nur noch einmal ein
Wort zu Muttchen sagen. Nur „Du“ sagen.
Nun setzte ihr die Frau die Miitze auf urid
zog ihr die Jacke an. Und dann saß sie iin Wagen,
aer zur Bahn fuhr, ganz stumpf, blaß und abge-
storben; sie dachte nichts mehr; vor ihren Augen
leuchtete alles rot und dahinter sah sie nur Flecke,
von denen sie nicht unterscheiden konnte, ob sie
unendlich groß oder winzig, winzig klein waren,
und die sich fortwährend drehten und ineinander
verschlangen.
* *
*
Acht Tage später reisten die Eltern denselben
Weg. Am Morgen hatten sie von dem leitenden
Arzt des Kindersanatoriums ein Telegramm bekom-
men, in dem er ihnen mitteilte, daß das vor acht
Tagen eingelieferte Kind schwer und hoffnungslos
an Gehirnhautentzündung erkrankt sei.
* *
*
Auf dem üang schon hörte nian die hohle stöh-
nende Kinderstimme.
„Siiße - siiße Mutter — warurn bist du ge-
storben — ich kann doch nicht — ohne dich
leben —“
Vielleicht wäre es besser. wenn die Eltern
gar nicht mehr hineingingen. Der Arzt wollte
ihnen gern den furchtbaren Anblick ersparen. Es
würde sowieso nicht mehr lange datiern. Für eine
Frau wäre es fast unmöglich, das Entsetzliche mit
anzusehet’.
„Mutter - ich sehne mich so — kornnist nicht
— Mutter —“
*
„Aber hören Sie denit nicht, Herr Doktor, daß
tch hineinnruß! Hören Sie nicht, wie das Kind
nach rnir ruft! Nein, ich rnuß hinein, es wäre grati-
sam. denr Kind nicht das Letzte ztt erleichtern.
Hoffentiich erkennt sie mich rioch —“
Lebensfreude
Man wundert sich imrner wieder iiber die Le-
fcensfreude der Einwohner hiesiger Haupt- und
Residenzstadt. Sie werden zwar irnmer „mon-
dainer“ in ihrer Kleidung, immer kunstgewerb-
licher ln ihrertr Heim, imnier tiefer in ihrer Lektiire.
Sie verehreu Schönherr, Ernst Hardt und Schnitz-
ler, als ob das gar nichts wäre, sie lassen sich von
Bruno Paul einrichten tind vergessen nicht, einige
Schneeballen aus Seidenpapier zur Abwehr der
Fliegen unter ihre eiektrischen Kronen zu hängen,
und sie lassen sich nach Poiret Kleider machen
und vergessen, lhren Körper entsprechend timzu-
forrnen. Wenn die Kleider wenigstens Leute ma-
chen wiirden, könnte tnan heute verhältnismäßig
glücklich sein. Aber schöne Kleider, die ihnen
nicht sitzen, und schöne Wohnungen, in die sie
nicht passen, und schöne Dichter, die sie verstehen,
diesen Leuten muß die Metropolrevue durchaus
organisch stehen. Das sind Träutne, die sie leben.
Geist vom Geist der Herren Freuiid tmd Holländer,
Schultz tind Baruch nicht zu vergessen, und Fleisch
vom Fleisch der Mädchen, die sie lieben. Herr
Schultz liebt das Däcke mit Gardemaß, er steckt es
auch durchaus anschaulich in Uniforrnen aller Waf-
fengattungen, was sich nebenbei noch patriotisch
inacht. Und das Publikum ist gliicklich. Denn,
wenn d i e s e Körper Poiretkleider tragen können,
bleibt Berlins Frauheit diesem Schneider nicht ver-
loren. Die Schunkelmädchen der Metropolrevue
müssen in allen abgetakelten Symbolen schwim-
men. Sie rudern mit den Beinen (wegen der Sym-
bolik), die Baruch und Co. nur in den sieben Far-
ben liebt, die es gibt, sie steuern rnit den Händen,
(wegen der Symbolik), hier liebt Baruch und Co.
Naturfarbe, sie quietschen mit dem Kehlkopf, den
ihnen ein Gott gab, um uns zu sagen, was wir lei-
den, und sie klammern sich an die Verse ihres
Dichters fest, den ihnen ein Gott gab, um ihnen
zu sagen, was ihn erfreut. Spaß muß sein. Auch
Bildung. Deshalb sprechen die Damen in jenem an-
genehmen Schillerpathos, das man nur durch eiiren
regeri Besuch des königlichen Schauspielhauses in
Berlin erwerben kann. Auch die Solisten besitzen
es. Die Herren Baruch & Co. werden außerdem
immer poetischer. Friiher genügte ihnen eine Far-
benorgie, niit allen sieben Farben, die es gibt, jetzt
denken sie nicht mehr daran, es unter zwei Far-
bendichtungen zu machen. nrit allen sieben Farben,
die es gibt. Man muß das „Palais der Träume“
und den „Farbentraum“ gesehen haben, um zu wis-
sen, was den Herren Baruch & Co. im Schlaf ailes
einfallen kann. Das inuß man wissen. Denn man
muß die Metropolrevue gesehen haben. Werni
ihnen schon diese Trätime ein Leben sind, so bleibt
nicht ausztidenken, was das Leben ihnen fiir Träume
geben mag. Aber den Seinen gibt es der Herr
Schultz im Schlaf. Fritzy Massary hat diese
Btihne verlassen und es bleiben ihr nur noch zwei
gute Geister iibrig. Josef Giampietro und
M a d g e L e s s i n g. Zwei wirkliche Kiinstler.
Nttr der Charme, die Grazie, und das große Kön-
nen ihrer Tänze maclien den Abend im Metropol-
theater rnöglich. Wenn die Madge Lessing nicht
vorhanden wäre, würde man sich in iedern Akt
zur Notwehr berechtigt fiihlen. Giampietro ist
wieder ein Beispiel dafür, daß die Schauspielkunst
nichts nrit irgendeiner anderen Kunst gemeinsam
hat. Wäre dies nicht der Fall, so miißte selbst eine
Persönlichkeit wie Giampietro in diesem wiisten
Schutt von Dummheit, Alberriheit, Geschmacklo-
sigkeit und kitschigster Sentimentalität versinken.
E 1 s e K u p f e r hat viel Temperament, kann gut
berlinern und gut Walzer tanzen. Das Publikum
ist äußerst verständig. Spricht einer auf der Bühne
von Marokko, so ist ihm sotort klar, daß die Ma-
rökkoangelegenheit behandelt wird. fspricht ;je-
riiand von Manuel, so weiß es sofort, daß es sich
um den ehemaligen König von Portugal handelt.
Kurz, man versteht hier erst, wie einfach es ist, eine
Satire zu schreiben: indem man sie einfach nicht
schreibt, sondern durch Erwähnung von Tatsachen
es dem Publkum iiberläßt, sich selbst satirisch an-
zuregen. So wird nienrand verletzt. Monarchist
und Demokrat, Christ und Jude, arnr und reich,
jeder wird auf die Faeon selig, die den Verfassern
versagt blieb. Was der Verstand der Verständigen
sieht, braucht nicht erst gestaltet zu werden. Bil-
dung ersetzt jede Kunst. Wozu gestalten, wenn
man vor Gebildeten träunrt.
Dresden und Budapest
Die Qesellschaft für Verbreitung von Volks-
bildung hat in Dresden eine Jubelfeier begangen.
Sie ist es ja aueh, die das Denkvermögen der
Masse bis zu jenem Bildungsgrad heben will, der
weder warm noch kalt ist, und die den Mann aus
dem Volke über Hintertreppen in das Arsenal der
„Macht des Wissens“ lockt. Ist es auch nur
cine magere Kost, die diese Gesellschaft „studier-
ter Herren“ dem bildungshungrigen Volke verab-
folgt, so beging sie doch eine Jubelfeier nnd gab
sich selbst ein Festmahl.
Bei ihm wurde ein Hymnus aut Dresden
vorgetragen, der den „Aitmeister“ der deutschen
Familienblattpoeten, Albert Traeger, zum Verfasser
hat:
Im alten Lande Sachsen,
Der echten deutschen Mark,
Die schönen Mädchen w a c h s e n ,
Und Männer. treu mid stark.
Mit reichem Schmuck behangeu,
In Schönheit mitten drin,
Thront dort mit sanftem Prangen
Die holde Königin.
Sachsen sollte nicht etwas als Königin feiern,
das bedeutend und stolz und von Bestand ist.
AberTraeger hat eben während der Abfassung
des Liedes der Toselli nicht gedacht.
Dresden ist: die holde Königin.
Dresden, du Städteblüte
Im deutschen Vateriand,
Wie auch das Wetter wiite,
tlalt wacker immer stand,
Daß nimmerdar erbleiche
Dein friihlingsfrischer Glanz,
Fest um die deutsche Eiche
Schlingt sich dein Rautenkranz»
Dresden ist: die Bliite im Rautenkranz!
Der „größte Regisseur aller Zeiten" durcheilt
einem f 1 i e g e n d e n H o 11 ä n d e r gteich die
halbe Welt. Die Berliner Theaterkritiker werden
ganz sentimental dariiber. Statt in Berlin zu blei-
ben, um den verblassenden Glanz des Deutschen
Theaters aufzufrischen, treibt er im Herumziehen
Handel init King Edipus Inscnierungen. So war
er atich nach Budapest gekommen. Er hat dort
mit Eingeborenen seinen Sophokles einstudiert.
Aus jenen Tagen erzählt das „Neue Pester Jour-
nal“ eine „hübsche Episode“, die sich während
und nach der ersten Edipus-Vorstellung zugetra-
gen hat. Mitten im spannendsten Augenblick er-
hob sich Hundegebell hinter der Szene. Die Leiter
der Vorstellung erblaßten vor Schreck und Wut
iiber die Störung der Stimmung, in die das atem-'
los dasitzende Publikum versetzt wurde. Rein-
hardt selbst geriet in die höchste Aufregung, und
verzweifelt die Hände ringend, stiirzte ei auf Di-
rektor Beöthy und seinen l^egiestab zu mit dem
herzzerreißenden Rur: !Jm Gotteswillen,
der Hund soll nicht belien! Der Hund soll nicht
bellen! Ratloses Hin- und Herlaufen, aber es
niitzt nichts. Der Hund, ein riesiger Bullenbeißer
des Tierdresseurs Henricksen, bellte in seinem
Bretterverschlag unverdrossen drauf los. Endlich
hatte Beöthy einen rettenden Gedanken. Er ließ
voin Zirkushofe einen jener Stadtwäldchenlungerer
holen, die man gemeinhin mit dem Namen „Jaß“
bezeichnet. Dieser erbot sich, den Hund gegen ein
Honorar von zwei Kronen ztim Schweigen zu
bringen.“
Er bekarn das Geid und holte aus einern naheu
Restaurant für einige Heiler Speiseabfälle. Ser-
vierte sie dem Stimmungszerreißer und trium-
phierte. Der Köter hatte das störende ßellen
eingestellt. Doch „als das Publikum den Zirkus
verließ, befand sich Beöthy im Gewühl der ab-
ziehenden Menge, die an dem Gesehenen ihre Kri-
tik iibte. Und da hörte er folgende kritische Be-
rnerkung: „Das schönste Regiemoment Reinhardts
war doch das kleine Detail, als in der verlassenen,
von der Pestfurcht entvölkerten Stadt die herren-
losen Hunde so schauerlich bellten.“
„Doch beim Souper, das nach der denkwür-
digen Vorstellung stattfand, erzählte Beöthy das
erhorchte Gespräch dem glückselig dasitzenden
Reinhardt. Der zog die Stirn in gedanken-
volle Furchen und sann einige Augenblicke
nach. Dann sprach er mit blutigem Ernst
zu Beöthy: „Geben Sie dem „Jaß“ morgen wieder
zwei Kronen. Aber der Hund soll bellen.“
Ich hätte an Stelle des Jaß den Hund losge-
lassen, damit er den blutigen Ernst, diese wirklich
rotgeschminkte Pose, auch zerreiße.
A.
Verantwortlich für die Schriftleitung
HERWARTH WALDEN / BERLIN-HALENSEE