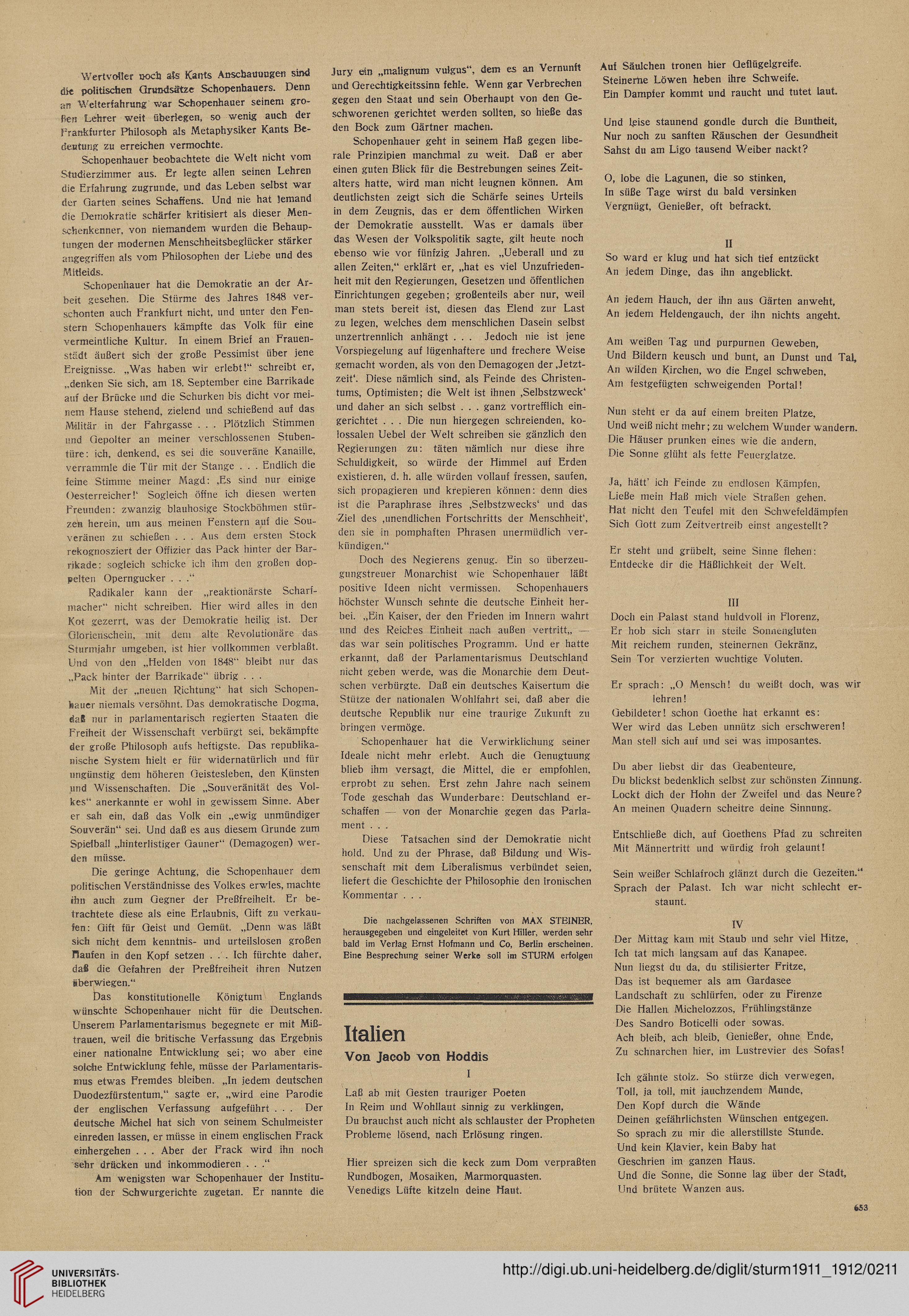Wertvotter oodj sls Kants Aoscbauungen sind
die politischen Grundsatze Schopenhauers. Denn
an Welterfahrung war Schopenhauer seinem gro-
tten Lehrer weit Qberiegen, so wenig auch der
Frankfurter Philosoph als Metaphysiker Kants Be-
deutung zu erreichen vermochte.
Schopenhauer beobachtete die Welt nicht vom
Studierzimmer aus. Er legte allen seinen Lehren
die Erfahrung zugrunde, und das Leben selbst war
der Garten seines Schaffens. Und nie hat Jemand
c!ie Demokratie schärfer kritisiert als dieser Men-
schenkenner, von niemandem wurden die Behaup-
tungen der modernen Menschheitsbegiücker stärker
angegriffen als vom Philosophen der Liebe und des
Mitleids.
Schopenhauer hat die Demokratie an der Ar-
beit gesehen. Die Stiirme des Jahres 1848 ver-
schonten auch Erankfurt nicht, und unter den Fen-
stern Schopenhauers kämpfte das Volk für eine
vermeintliche Kultur. In einein Brief an Frauen-
städt äußert sich der große Pessimist über jene
Ereignisse. „Was haben, wir erlebt!“ schreibt er,
„denken Sie sich, am 18. September eine Barrikade
auf der Brücke und die Schurken bis dicht vor mei-
nem Hause stehend, zielend und schießend auf das
M'ilitär in der Fahrgasse . . . Plötzlich Stimmen
und Gepolter an ineiner verschlossenen Stuben-
tiire: ich, denkend, es sei die souveräne Kanaille,
verrammle die Tiir mit der Stange . . . Endiich die
feine Stimtne meiner Magd: ,Es sind nur einige
Oesterreicher!‘ Sogleich öffne ich diesen werten
Freunden: zwanzig blauhosige Stockböhmen stür-
zeii herein, um aus meinen Fenstern auf die Sou-
veränen zu schießen . . . Aus dem ersten Stoek
rekognosziert der Offizier das Pack hinter der Bar-
rikade: sogleich schicke ich ihm den großen dop-
pelten Operngucker . . .“
Radikaler kann der „reaktionärste Scharf-
macher“ nicht schreiben. Hier wird alles in den
Kot gezerrt, was der Demokratie heilig ist. Der
Giorienschein, mit dem alte Revolutionäre das
Sturmjahr umgeben, ist hier vollkommen verblaßt.
Und von den „Helden von 1848“ bleibt nur das
„Pack hinter der Barrikade“ übrig . . .
Mit der „neuen Richtung“ hat sich Schopen-
hatier niemals versöhnt. Das demokratische Dogma.
daS nur in parlamentarisch regierten Staaten die
Freiheit der Wissenschaft verbiirgt sei, bekämpfte
der große Philosoph aufs heftigste. Das republika-
nische System hielt er für widernatürlich und für
ungünstig dem höheren Geistesleben, den Künsten
und Wissenschaften. Die „Souveränität des Vol-
kes“ anerkannte er wohl in gewissem Sinne. Aber
er sah ein, daß das Volk ein „ewig unmündiger
Souverän“ sei. Und daß es aus diesem Grunde zum
Spiefball „hinterlistiger Gauner“ (Demagogen) wer-
den miisse.
Die geringe Achtung, die Schopenhauer dem
politischen Verständnisse des Volkes erwies, machte
ihn auch zum Gegner der Preßfreiheit. Er be-
trachtete diese als eine Erlaubnis, Gift zu verkau-
fen: Gift für Geist und Gemüt. „Denn was läßt
sich nicht dem kenntnis- und urteilslosen großen
flaufen in den Kopf setzen . . . Ich fiirchte daher,
daß die Gefahren der Preßfreiheit ihren Nutzen
überwiegen.“
Das konstitutionelle Königtum Englands
wünschte Schopenhauer nicht für die Deutschen.
Unserem Parlamentarismus begegnete er mit Miß-
trauen, weil die britische Verfassung das Ergebnis
einer nationalne Entwicklung sei; wo aber eine
solche Entwicklung fehle, müsse der Parlamentaris-
mus etwas Fremdes bleiben. „In jedem deutschen
Duodezfürstentum,“ sagte er, „wird eine Parodie
der englischen Verfassung aufgeführt . . . Der
deutsche Michel hat sich von seinein Schulmeister
einreden lassen, er müsse in einem englischen Frack
einhergehen . . . Aber der Frack wird ihn noch
sehr drücken und inkommodieren . . .“
Am wenigsten war Schopenhauer der Institu-
tion der Schwurgerichte zugetan. Er nannte die
Jury ein „malignum vulgus“, dem es an Vernunft
und Gerechtigkeitssinn fehle. Wenn gar Verbrechen
gegen den Staat und sein Oberhaupt von den Ge-
schworenen gerichtet werden sollten, so hieße das
den Bock zum Gärtner machen.
Schopenhauer geht in seinem Haß gegen libe-
rale Prinzipien manchmal zu weit. Daß er aber
einen guten Blick für die Bestrebungen seines Zeit-
alters hatte, wird man nicht Ieugnen können. Am
deutlichsten zeigt sich die Schärfe seines Urteils
in dem Zeugnis, das er dem öffentlichen Wirken
der Demokratie ausstellt. Was er damals über
das Wesen der Volkspolitik sagte, gilt heute noch
ebenso wie vor fünfzig Jahren. „Ueberall und zu
allen Zeiten,“ erklärt er, „hat es viel Unzufrieden-
heit mit den Regierungen, Gesetzen und öffentlichen
Einrichtungen gegeben; großenteils aber nur, weil
man stets bereit ist, diesen das Elend zur Last
zu legen, welches dem menschlichen Dasein selbst
unzertrennlich anhängt . . . Jedoch nie ist jene
Vorspiegelung auf lügenhaftere und frechere Weise
gemacht worden, als von den Demagogen der,Jetzt-
zeit'. Diese nämlich sind, als Feinde des Christen-
tums, Optimisten; die Welt ist ihnen ,Selbstzweck‘
und daher an sich selbst . . . ganz vortrefflich ein-
gerichtet . . . Die nun hiergegen schreienden, ko-
lossalen Uebel der Welt schreiben sie gänzlich den
Regiei ungen zu: täten nämlich nur diese ihre
Schuldigkeit, so wiirde der Himmel auf Erden
existieren, d. h. alle würden vollauf fressen, saufen,
sich propagieren und krepieren können: denn dies
ist die Paraphrase ihres ,Selbstzwecks‘ und das
Ziel des ,unendlichen Fortschritts der Menschheit 1,
den sie in pomphaften Phrasen unermüdlich ver-
kündigen.“
Doch des Negierens genug. Ein so überzeu-
gungstreuer Monarchist wie Schopenhauer läßt
positive Ideen nicht vermissen. Schopenhauers
höchster Wunsch sehnte die deutsche Einheit her-
bei. „Ein Kaiser, der den Frieden im Innern wahrt
und des Reiches Einheit nach außeii vertritt,, —
das war sein politisches Programm. Und er hatte
erkannt, daß der Parlamentarismus Deutschland
nicht geben werde, was die Monarchie dem Deut-
schen verbürgte. Daß ein deutsches Kaisertum die
Stiitze der nationalen Wohlfahrt sei, daß aber die
deutsche Republik nur eine traurige Zukunit zu
bringen vermöge.
Schopenhauer hat die Verwirklichung seiner
Ideale nicht mehr erlebt. Auch die Genugtuung
blieb ihm versagt, die Mittel, die ei empfohlen,
erprobt zu sehen. Erst zehn Jahre nach seinem
Tode geschah das Wunderbare: Deutschland er-
schaffen — von der Monarchie gegen das Parla-
ment . . .
Diese Tatsachen sind der Demokratie nicht
hold. Und zu der Phrase, daß Bildung und Wis-
senschaft mit dem Libcralismus verbündet seien,
liefert die Geschichte der Philosophie den ironischen
Kommentar . . .
Die nachgelassenen Schriften von MAX STEINER,
herausgegeben und eingeleitet von Kurt Hiller, werden sehr
bald im Verlag Ernst Hofmann und Co, Berlin erscheinen.
Eine Besprechung seiner Werke soll im STURM erfolgen
Italien
Von Jaeob von Hoddis
I
Laß ab mit Gesten trauriger Poeten
In Reim und Wohllaut sinnig zu verklingen,
Du brauchst auch nicht als schlauster der Propheten
Probleme lösend, nach Erlösung ringen.
Hier spreizen sich die keck zum Dom verpraßten
Rundbogen, Mosaiken, Marmorquasten.
Venedigs Liifte kitzeln deine Haut.
Aui Säulchen tronen hier Qeflügelgreiie.
Steinertie Löwen heben ihre Schweife.
Ein Dampfer kommt und raucht und tutet laut.
Und lgise staunend gondle durch die Buntheit,
Nur noch zu sanften Räuschen der Gesundheit
Sahst du am Ligo tausend Weiber nackt?
0, lobe die Lagunen, die so stinken,
In süße Tage wiirst du bald versinken
Vergnügt, Genießer, oft befrackt.
II
So ward er klug und hat sich tief entzückt
An jedein Dinge, das ihn angeblickt.
An jedem Hauch, der ihn aus Gärten anweht,
An jedem Heldengauch, der ihn nichts angeht.
Am weißen Tag und purpurnen Geweben,
Und Bildern keusch und bunt, an Dunst und Tal,
An wilden Kirchen, wo die Engel schweben,
Am festgefiigten schweigenden Portal!
Nun steht er da auf einem breiten Platze,
Und weiß nicht mehr; zu welchem Wunder wandern.
Die Häuser prunken eines wie die andern.
Die Sonne glüht als fette Feuerglatze.
Ja, hätt ich Feinde zu cndlosen Kämpfen,
Ließe mein Haß mich viele Straßen gehen.
Hat nicht den Teufel mit den Schwefeidämpfen
Sich Gott zum Zeitvertreib einst angestellt?
Er steht und grübeit, seine Sinne flehen:
Entdecke dir die Häßlichkeit der Welt.
III
Doch ein Palast stand huldvoll in Florenz,
Er hob sich starr in steile Sonnengluten
Mit reichem runden, steinernen Gekränz,
Sein Tor verzierten wuchtige Voluten.
Er sprach: „O Mensch! du weißt doch, was wir
lehren!
Gebildeter! schon Goethe hat erkannt es:
Wer wird das Leben unnütz sich erschweren!
Man stell sich auf und sei was imposantes.
Du aber liebst dir das Geabenteure,
Du blickst bedenklich selbst zur schönsten Zinnung.
Lockt dich der Hohn der Zweifel und das Neure?
An meinen Quadern scheitre deine Sinnung.
Entschließe dich, auf Goethens Pfad zu schreiten
Mit Männertritt und würdig froh gelaunt!
Sein weißer Schlafroch giänzt durch die Gezeiten.“
Sprach der Palast. Ich war nicht schlecht er-
staunt.
IV
Der Mittag kam mit Staub und sehr viel Hitze,
Ich tat mich langsam auf das Kanapee.
Nun Iiegst du da, du stilisierter Fritze,
Das ist bequemer als am Gardasee
Landschaft zu schlürfen, oder zu Firenze
Die Hallen Michelozzos, Frühlingstänze
Des Sandro Boticeili oder sowas.
Ach bleib, ach bleib, Genießer, ohne Ende,
Zu schnarchen hier, im Lustrevier des Sofas!
Ich gähnte stolz. So stürze dich verwegen,
Toll, ja toll, mit jauchzendem Munde,
Den Kopf durch die Wände
Deinen gefährlichsten Wünschen entgegen.
So sprach zu mir die allerstillste Stunde.
Und kein Klavier, kein Baby hat
Geschrien im ganzen Haus.
Und die Sonne, die Sonne lag iiber der Stadt,
Und briitete Wanzen aus.
die politischen Grundsatze Schopenhauers. Denn
an Welterfahrung war Schopenhauer seinem gro-
tten Lehrer weit Qberiegen, so wenig auch der
Frankfurter Philosoph als Metaphysiker Kants Be-
deutung zu erreichen vermochte.
Schopenhauer beobachtete die Welt nicht vom
Studierzimmer aus. Er legte allen seinen Lehren
die Erfahrung zugrunde, und das Leben selbst war
der Garten seines Schaffens. Und nie hat Jemand
c!ie Demokratie schärfer kritisiert als dieser Men-
schenkenner, von niemandem wurden die Behaup-
tungen der modernen Menschheitsbegiücker stärker
angegriffen als vom Philosophen der Liebe und des
Mitleids.
Schopenhauer hat die Demokratie an der Ar-
beit gesehen. Die Stiirme des Jahres 1848 ver-
schonten auch Erankfurt nicht, und unter den Fen-
stern Schopenhauers kämpfte das Volk für eine
vermeintliche Kultur. In einein Brief an Frauen-
städt äußert sich der große Pessimist über jene
Ereignisse. „Was haben, wir erlebt!“ schreibt er,
„denken Sie sich, am 18. September eine Barrikade
auf der Brücke und die Schurken bis dicht vor mei-
nem Hause stehend, zielend und schießend auf das
M'ilitär in der Fahrgasse . . . Plötzlich Stimmen
und Gepolter an ineiner verschlossenen Stuben-
tiire: ich, denkend, es sei die souveräne Kanaille,
verrammle die Tiir mit der Stange . . . Endiich die
feine Stimtne meiner Magd: ,Es sind nur einige
Oesterreicher!‘ Sogleich öffne ich diesen werten
Freunden: zwanzig blauhosige Stockböhmen stür-
zeii herein, um aus meinen Fenstern auf die Sou-
veränen zu schießen . . . Aus dem ersten Stoek
rekognosziert der Offizier das Pack hinter der Bar-
rikade: sogleich schicke ich ihm den großen dop-
pelten Operngucker . . .“
Radikaler kann der „reaktionärste Scharf-
macher“ nicht schreiben. Hier wird alles in den
Kot gezerrt, was der Demokratie heilig ist. Der
Giorienschein, mit dem alte Revolutionäre das
Sturmjahr umgeben, ist hier vollkommen verblaßt.
Und von den „Helden von 1848“ bleibt nur das
„Pack hinter der Barrikade“ übrig . . .
Mit der „neuen Richtung“ hat sich Schopen-
hatier niemals versöhnt. Das demokratische Dogma.
daS nur in parlamentarisch regierten Staaten die
Freiheit der Wissenschaft verbiirgt sei, bekämpfte
der große Philosoph aufs heftigste. Das republika-
nische System hielt er für widernatürlich und für
ungünstig dem höheren Geistesleben, den Künsten
und Wissenschaften. Die „Souveränität des Vol-
kes“ anerkannte er wohl in gewissem Sinne. Aber
er sah ein, daß das Volk ein „ewig unmündiger
Souverän“ sei. Und daß es aus diesem Grunde zum
Spiefball „hinterlistiger Gauner“ (Demagogen) wer-
den miisse.
Die geringe Achtung, die Schopenhauer dem
politischen Verständnisse des Volkes erwies, machte
ihn auch zum Gegner der Preßfreiheit. Er be-
trachtete diese als eine Erlaubnis, Gift zu verkau-
fen: Gift für Geist und Gemüt. „Denn was läßt
sich nicht dem kenntnis- und urteilslosen großen
flaufen in den Kopf setzen . . . Ich fiirchte daher,
daß die Gefahren der Preßfreiheit ihren Nutzen
überwiegen.“
Das konstitutionelle Königtum Englands
wünschte Schopenhauer nicht für die Deutschen.
Unserem Parlamentarismus begegnete er mit Miß-
trauen, weil die britische Verfassung das Ergebnis
einer nationalne Entwicklung sei; wo aber eine
solche Entwicklung fehle, müsse der Parlamentaris-
mus etwas Fremdes bleiben. „In jedem deutschen
Duodezfürstentum,“ sagte er, „wird eine Parodie
der englischen Verfassung aufgeführt . . . Der
deutsche Michel hat sich von seinein Schulmeister
einreden lassen, er müsse in einem englischen Frack
einhergehen . . . Aber der Frack wird ihn noch
sehr drücken und inkommodieren . . .“
Am wenigsten war Schopenhauer der Institu-
tion der Schwurgerichte zugetan. Er nannte die
Jury ein „malignum vulgus“, dem es an Vernunft
und Gerechtigkeitssinn fehle. Wenn gar Verbrechen
gegen den Staat und sein Oberhaupt von den Ge-
schworenen gerichtet werden sollten, so hieße das
den Bock zum Gärtner machen.
Schopenhauer geht in seinem Haß gegen libe-
rale Prinzipien manchmal zu weit. Daß er aber
einen guten Blick für die Bestrebungen seines Zeit-
alters hatte, wird man nicht Ieugnen können. Am
deutlichsten zeigt sich die Schärfe seines Urteils
in dem Zeugnis, das er dem öffentlichen Wirken
der Demokratie ausstellt. Was er damals über
das Wesen der Volkspolitik sagte, gilt heute noch
ebenso wie vor fünfzig Jahren. „Ueberall und zu
allen Zeiten,“ erklärt er, „hat es viel Unzufrieden-
heit mit den Regierungen, Gesetzen und öffentlichen
Einrichtungen gegeben; großenteils aber nur, weil
man stets bereit ist, diesen das Elend zur Last
zu legen, welches dem menschlichen Dasein selbst
unzertrennlich anhängt . . . Jedoch nie ist jene
Vorspiegelung auf lügenhaftere und frechere Weise
gemacht worden, als von den Demagogen der,Jetzt-
zeit'. Diese nämlich sind, als Feinde des Christen-
tums, Optimisten; die Welt ist ihnen ,Selbstzweck‘
und daher an sich selbst . . . ganz vortrefflich ein-
gerichtet . . . Die nun hiergegen schreienden, ko-
lossalen Uebel der Welt schreiben sie gänzlich den
Regiei ungen zu: täten nämlich nur diese ihre
Schuldigkeit, so wiirde der Himmel auf Erden
existieren, d. h. alle würden vollauf fressen, saufen,
sich propagieren und krepieren können: denn dies
ist die Paraphrase ihres ,Selbstzwecks‘ und das
Ziel des ,unendlichen Fortschritts der Menschheit 1,
den sie in pomphaften Phrasen unermüdlich ver-
kündigen.“
Doch des Negierens genug. Ein so überzeu-
gungstreuer Monarchist wie Schopenhauer läßt
positive Ideen nicht vermissen. Schopenhauers
höchster Wunsch sehnte die deutsche Einheit her-
bei. „Ein Kaiser, der den Frieden im Innern wahrt
und des Reiches Einheit nach außeii vertritt,, —
das war sein politisches Programm. Und er hatte
erkannt, daß der Parlamentarismus Deutschland
nicht geben werde, was die Monarchie dem Deut-
schen verbürgte. Daß ein deutsches Kaisertum die
Stiitze der nationalen Wohlfahrt sei, daß aber die
deutsche Republik nur eine traurige Zukunit zu
bringen vermöge.
Schopenhauer hat die Verwirklichung seiner
Ideale nicht mehr erlebt. Auch die Genugtuung
blieb ihm versagt, die Mittel, die ei empfohlen,
erprobt zu sehen. Erst zehn Jahre nach seinem
Tode geschah das Wunderbare: Deutschland er-
schaffen — von der Monarchie gegen das Parla-
ment . . .
Diese Tatsachen sind der Demokratie nicht
hold. Und zu der Phrase, daß Bildung und Wis-
senschaft mit dem Libcralismus verbündet seien,
liefert die Geschichte der Philosophie den ironischen
Kommentar . . .
Die nachgelassenen Schriften von MAX STEINER,
herausgegeben und eingeleitet von Kurt Hiller, werden sehr
bald im Verlag Ernst Hofmann und Co, Berlin erscheinen.
Eine Besprechung seiner Werke soll im STURM erfolgen
Italien
Von Jaeob von Hoddis
I
Laß ab mit Gesten trauriger Poeten
In Reim und Wohllaut sinnig zu verklingen,
Du brauchst auch nicht als schlauster der Propheten
Probleme lösend, nach Erlösung ringen.
Hier spreizen sich die keck zum Dom verpraßten
Rundbogen, Mosaiken, Marmorquasten.
Venedigs Liifte kitzeln deine Haut.
Aui Säulchen tronen hier Qeflügelgreiie.
Steinertie Löwen heben ihre Schweife.
Ein Dampfer kommt und raucht und tutet laut.
Und lgise staunend gondle durch die Buntheit,
Nur noch zu sanften Räuschen der Gesundheit
Sahst du am Ligo tausend Weiber nackt?
0, lobe die Lagunen, die so stinken,
In süße Tage wiirst du bald versinken
Vergnügt, Genießer, oft befrackt.
II
So ward er klug und hat sich tief entzückt
An jedein Dinge, das ihn angeblickt.
An jedem Hauch, der ihn aus Gärten anweht,
An jedem Heldengauch, der ihn nichts angeht.
Am weißen Tag und purpurnen Geweben,
Und Bildern keusch und bunt, an Dunst und Tal,
An wilden Kirchen, wo die Engel schweben,
Am festgefiigten schweigenden Portal!
Nun steht er da auf einem breiten Platze,
Und weiß nicht mehr; zu welchem Wunder wandern.
Die Häuser prunken eines wie die andern.
Die Sonne glüht als fette Feuerglatze.
Ja, hätt ich Feinde zu cndlosen Kämpfen,
Ließe mein Haß mich viele Straßen gehen.
Hat nicht den Teufel mit den Schwefeidämpfen
Sich Gott zum Zeitvertreib einst angestellt?
Er steht und grübeit, seine Sinne flehen:
Entdecke dir die Häßlichkeit der Welt.
III
Doch ein Palast stand huldvoll in Florenz,
Er hob sich starr in steile Sonnengluten
Mit reichem runden, steinernen Gekränz,
Sein Tor verzierten wuchtige Voluten.
Er sprach: „O Mensch! du weißt doch, was wir
lehren!
Gebildeter! schon Goethe hat erkannt es:
Wer wird das Leben unnütz sich erschweren!
Man stell sich auf und sei was imposantes.
Du aber liebst dir das Geabenteure,
Du blickst bedenklich selbst zur schönsten Zinnung.
Lockt dich der Hohn der Zweifel und das Neure?
An meinen Quadern scheitre deine Sinnung.
Entschließe dich, auf Goethens Pfad zu schreiten
Mit Männertritt und würdig froh gelaunt!
Sein weißer Schlafroch giänzt durch die Gezeiten.“
Sprach der Palast. Ich war nicht schlecht er-
staunt.
IV
Der Mittag kam mit Staub und sehr viel Hitze,
Ich tat mich langsam auf das Kanapee.
Nun Iiegst du da, du stilisierter Fritze,
Das ist bequemer als am Gardasee
Landschaft zu schlürfen, oder zu Firenze
Die Hallen Michelozzos, Frühlingstänze
Des Sandro Boticeili oder sowas.
Ach bleib, ach bleib, Genießer, ohne Ende,
Zu schnarchen hier, im Lustrevier des Sofas!
Ich gähnte stolz. So stürze dich verwegen,
Toll, ja toll, mit jauchzendem Munde,
Den Kopf durch die Wände
Deinen gefährlichsten Wünschen entgegen.
So sprach zu mir die allerstillste Stunde.
Und kein Klavier, kein Baby hat
Geschrien im ganzen Haus.
Und die Sonne, die Sonne lag iiber der Stadt,
Und briitete Wanzen aus.