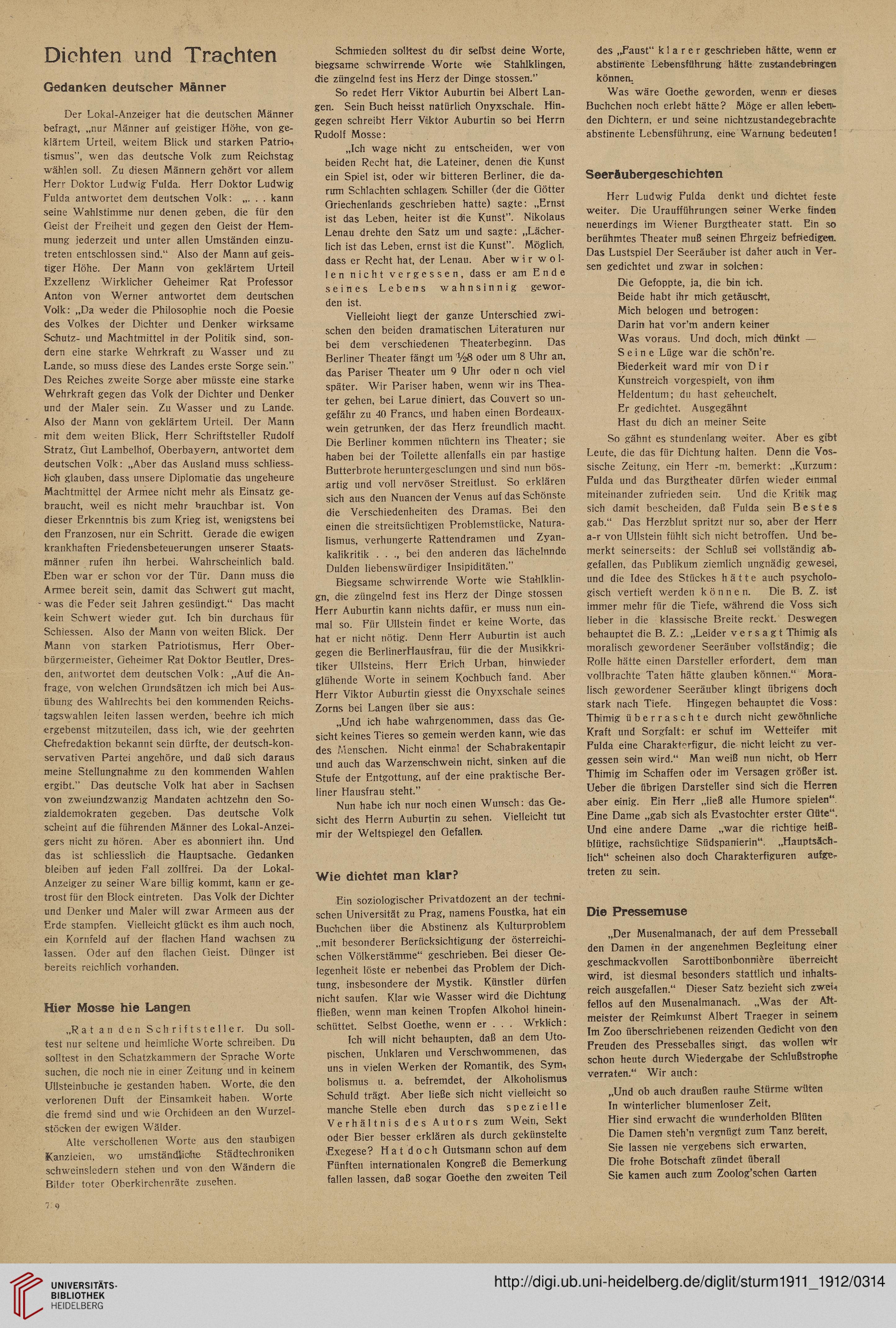Dichten und Trachten
Gedanken deutscher Männer
Der Lokal-Anzeiger hat die deutschen Männer
befragt, „nur Männer auf geistiger Höhe, von ge-
klärtem Urteil, weitem Blick und starken Patricn
tismus", wen das deutsche Volk zum Reichstag
wählen soll. Zu diesen Männern gehört vor allem
Herr Doktor Ludwig Fulda. Herr Doktor Ludwig
Fulda antwortet dem deutschen Volk: . . kann
seine Wahlstimme nur denen geben, die für den
Oeist der Freiheit und gegen den Qeist der Hem-
mung jederzeit und unter allen Umständen einzu-
treten entschlossen sind.“ Also der Mann auf geis-
tiger Höhe. Der Mann von geklärtem Urteil
Exzellenz Wirklicher Geheimer Rat Professor
Anton von Werner antwortet dem deutschen
Volk: „Da weder die Philosophie noch die Poesie
des Volkes der Dichter und Denker wirksame
Schutz- und Machtmittel in der Politik sind, son-
dern eine starke Wehrkraft zu Wasser und zu
Lande, so muss diese des Landes erste Sorge sein.”
Des Reiches zweite Sorge aber müsste eine starke
Wehrkraft gegen das Volk der Dichter und Denker
und der Maler sein. Zu Wasser und zu Lande.
Also der Mann von geklärtem Urteil. Der Mann
mit dem weiten Blick, Herr Schriftsteller Rudolf
Stratz, Gut Lambelhof, Oberbayern, antwortet dem
deutschen Voik: „Aber das Ausland muss schliess-
lich glauben, dass unsere Diplomatie das ungeheure
Machtmittel der Armee nicht mehr als Einsatz ge-
braucht, weil es nicht mehr brauchbar ist. Von
dieser Erkenntnis bis zum Krieg ist, wenigstens bei
den Franzosen, nur ein Schritt. Gerade die ewigen
krankhaften Friedensbeteuerungen unserer Staats-
männer rufen ihn herbei. Wahrscheinlich bald.
Eben war er schon vor der Tür. Dann muss die
Armee bereit sein, damit das Schwert gut macht,
was die Feder seit Jahren gesündigt.“ Das macht
kein Schwert wieder gut. Ich bin durchaus fiir
Schiessen. Also der Mann von weiten Blick. Der
Mann von starken Patriotismus, Herr Ober-
bürgermeister, Geheimer Rat Doktor Beutler, Dres-
den, antwortet dem deutschen Volk: „Auf die An-
frage, von welchen Grundsätzen ich mich bei Aus-
übung des Wahlrechts bei den kommenden Reichs-
tagswahlen leiten lassen werden, beehre ich mich
ergebenst mitzuteilen, dass ich, wie der geehrten
Chefredaktion bekannt sein dürfte, der deutsch-kon-
servativen Partei angehöre, und daß sich daraus
meine Stellungnahme zu den kommenden Wahlen
ergibt.” Das deutsche Volk hat aber in Sachsen
von zweiundzwanzig Mandaten achtzehn den So-
zialdemokraten gegeben. Das deutsche Volk
scheint auf die führenden Männer des Lokal-Anzei-
gers nicht zu hören. Aber es abonniert ihn. Und
das ist schliesslich die Hauptsache. Gedanken
bleiben auf jeden Fall zollfrei. Da der Lokal-
Anzeiger zu seiner Ware billig kommt, kann er ge-
trost für den Block eintreten. Das Volk der Dichter
und Denker und Maler will zwar Armeen aus der
Erde stampfen. Vielleicht glückt es ihm auch noch,
ein Kornfeld auf der flachen Hand wachsen zu
lassen. Oder auf den flachen Geist. Dünger ist
bereits reichlich vorhanden.
Hier Mosse hie Langen
„Rat an den Schriftsteller. Du soll-
test nur seltene und heimliche Worte schreiben. Du
solltest in den Schatzkammern der Sprache Worte
suchen, die noch nie in einer Zeitung und in keinem
UUsteinbuche je gestanden haben. Worte, d'ie den
verlorenen Duft der Einsamkeit haben. Worte
die fremd sind und wie Orchideen an den Wurzel-
stöcken der ewigen Wälder.
Alte verschollenen Worte aus den staubigen
•Kanzieien, wo umständliülie Städtechroniken
schweinsledern stehen und von den Wändem die
Bilder toter Oberkirchenräte zusehen.
Schmieden solltest du dir selbst deine Worte,
biegsame schwirrende Worte wne Stahlklingen,
cfie züngelnd fest ins Herz der Dinge stossen.”
So redet Herr Viktor Auburtin bei Albert Lan-
gen, Sein Buch heisst natiirlioh Onyxschale. Hin-
gegen schreibt Herr Viktor Auburtin so bei Herrn
Rudolf Mosse:
„Ich wage nicht zu entscheiden, wer von
beiden Recht hat, die Lateiner, denen die Kunst
ein Spiel ist, oder wir bitteren Berliner, die da-
rum Schlachten schlagem Schiller (der die Götter
Griechenlands geschrieben hatte) sagte: „Ernst
ist das Leben, heiter ist die Kunst”. Nikolaus
Lenau drehte den Satz um und sagte: „Lächer-
lich ist das Leben, ernst ist die Kunst”. MÖglich,
dass er Recht hat, der Lenau. Aber w i r w o 1-
len nicht vergessen, dass er am E n d e
seines Leberns wahnsinnig gewor-
den ist.
Vielleioht liegt der ganze Unterschied zwi-
schen den beiden dramatischen Uiteraturen nur
bei dem verschiedenen Theaterbeginn. Das
Berliner Theater fängt um ’VSjS oder um 8 Uhr an,
das Pariser Theater um 9 Uhr oder n och viel
später. Wir Pariser haben, wenn wir ins Thea-
ter gehen, bei Larue diniert, das Couvert so un-
gefähr zu 40 Francs, und haben einen Bordeaux-
wein getrunken, der das Herz freundiich macht.
Die Berliner kommen niichtern ins Theater; sie
haben bei der Toilette allenfalls ein par hastige
Butterbrote heruntergesclungen und sind nun bös-
artig und voll nervöser Streitlust. So erklären
sich aus den Nuancen der Venus auf das Schönste
die Verschiedenheiten des Dramas. Bei den
einen die streitsiichtigen Problemstücke, Natura-
lismus, verhungerte Rattendramen und Zyan-
kalikritik . . ., bei den anderen das tächelnnde
Dulden liebenswürdiger Insipiditäten."
Biegsame schwirrende Worte wie Stahlklin-
gn, die züngelnd fest ins Herz der Dinge stossen
Herr Auburtin kann nichts dafür, er muss nun ein-
mal so. Für Ullstein findet er keine Worte, das
hat er nicht nötig. Denn Herr Auburtin ist auch
gegen die BerlinerHausfrau, für die der Musikkri-
tiker Ullsteins, Herr Erich Urban, hinwieder
glühende Worte in seinem Kochbuch fand. Aber
Herr Viktor Auburtin giesst die Onyxschale seines
Zorns bei Langen über sie aus:
„Und ich habe wahrgenommen, dass das Ge-
sicht keines Tieres so gemein werden kann, wie das
des Menschen. Nicht einmal der Schabrakentapir
und auch das Warzenschwein nicht. sinken auf die
Stufe der Entgottung, auf der eine praktische Ber-
liner Hausfrau steht.”
Nun habe ich nur noch einen Wunsch: das Ge-
sicht des Herrn Auburtin zu sehen. Vielleicht tut
mir der Weltspiegel den Gefallen.
Wie diehtet man klar?
Ein soziologischer Privatdozent an der techni-
schen Universität zu Prag, namens Foustka, hat ein
Buchchen iiber die Abstinenz als Kulturproblem
„mit besonderer Berücksichtigung der österreichi-
schen Völkerstämme“ geschrieben. Bei dieser Ge-
Iegenheit löste er nebenbei das Problem der Dich-
tung, insbesondere der Mystik. Künstler dürfen
nicht saufen. Klar wie Wasser wird die Dichtung
fließen, wenn man keinen Tropfen Alkohol hinein-
schüttet. Selbst Goethe, wenn er . . . Wrklich:
Ich will nicht behaupten, daß an dem Uto-
pischen. Unklaren und Verschwommenen, das
uns in vielen Werken der Romantik, des Symi
bolismus u. a. befremdet, der Alkoholismus
Sohuld trägt. Aber ließe sich nicht vielleicht so
manche Stelle eben durch das s p e z i e ! 1 e
Verhältnis des Autors zum Wein, Sekt
oder Bier besser erklären als durch gekünstelte
Exegese? H a t d o c h Gutsmann schon auf dem
Fünften internationalen Kongreß die Bemerkung
fallen lassen, daß sogar Goethe den zweiten Teil
des ,JFaust“ k 1 a r e r geschrieben hätte, wenn er
abstinente Lebensführung hätte zustandebringen
können.
Was wäre Goethe geworden, wenn 1 er dieses
Buchchen noch erlebt hätte? Möge er allen lebem-
den Dichtern, er und se>ine nichtzustandegebrachte
abstinente Lebensführung, eine Warnung bedeuten!
Seerfiuberqeschichten
Herr Ludwig Fulda denkt und dichtet feste
weiter. Die Uraufführungen seiner Werke finden
neuerdings im Wiener Burgtheater statt. Ein so
berühmtes Theater muß seinen Ehrgeiz befriedigen.
Das Lustspiel Der Seeräuber ist daher auch in Ver-
sen gedichtet und zwar in solchen:
Die Gefoppte, ja, die hin ich.
Beide habt ihr mich getäuscht,
Mich belogen und betrogen:
Darin hat vor’m andern keiner
Was voraus. Und doch, mich dünkt —
S e i n e Lüge war die schön’re.
Biederkeit ward mir von D i r
Kunstreich vorgespielt, von ihm
Heldentum; du hast geheuchelt,
Er gedichtet. Ausgegähnt
Hast du dich an meiner Seite
So gähnt es stundenlang woiter. Aber es gibt
Leute, die das fiir Dichtung halten. Denn die Vos-
sische Zeitung, ein Herr -m. bemerkt: „Kurzum:
Fulda und das Burgtheater dürfen wieder emmal
miteinander zufrieden sein. Und die Kritik mag
sich damit bescheiden. daß Fulda sein B e s t e s
gab.“ Das Herzblut spritzt nur so, aber der Herr
a-r von Ullstein fühlt sich nicht betroffen. Und be-
merkt seinerseits: der Schluß sei vollständig ab-
gefallen, das Publikum ziemlich ungnädig gewesei,
und die Idee des Stückes h ä 11 e auch psycholo-
gisch vertieft werden k ö n n e n. Die B. Z. ist
immer mehr für die Tiefe, während die Voss sich
lieber in die klassische Breite reckt. Deswegen
behauptet die B. Z.: „Leider v e r s a g t Thimig als
moralisch gewordener Seeräuber vollständig; dle
RoIIe hätte einen Darsteller erfordert. dem man
vollbrachte Taten hätte glauben können.“ Mora-
lisch gewordener Seeräuber klingt iibrigens doch
stark nach Tiefe. Hingegen behauptet die Voss:
Thimig überraschte durch nicht gewöhnliche
Kraft und Sorgfalt: er schuf im Wetteifer mit
Fulda eine Charakterfigur, die nicht leicht zu ver-
gessen sein wird.“ Man weiß nun nicht, ob Herr
Thimig im Schaffen oder im Versagen größer ist.
Ueber die übrigen Darsteller sind sich die Herren
aber einig. Ein Herr „ließ alle Humore spielen“
Eine Dame „gab sich als Evastochter erster Güte“.
Und eine andere Dame „war die richtige heiß-
blütige, rachsüchtige Siidspanierin“. „Hauptsäch-
lich“ scheinen also doch Charakterfiguren aufge^
treten zu sein.
Die Pressemuse
„Der Musenalmanach, der auf dem Presseball
den Damen in der angenehmen Begleitung einer
geschmackvollen Sarottibonbonniöre überreicht
wird, ist diesmal besonders stattlich und inhalts-
reich ausgefallen.“ Dieser Satz bezieht sich zweb
fellos auf den Musenalmanach. „Was der Alt-
meister der Reimkunst Aibert Traeger in seinem
Im Zoo überschriebenen reizenden Gedicht von den
Freuden des Presseballes singt, das wollen wir
schon heute durch Wiedergabe der Schlußstrophe
verraten.“ Wir auch:
„Und ob auch draußen rauhe Stürme wüten
In winterlicher blumenloser Zeit,
Hier sind erwacht die wunderholden Blüten
Die Damen steh’n vergniigt zum Tanz bereit,
Sie lassen mie vergebens sich erwarten,
Die frohe Botschaft zündet überall
Sie kamen auch zum Zoolog’schen Garten
Gedanken deutscher Männer
Der Lokal-Anzeiger hat die deutschen Männer
befragt, „nur Männer auf geistiger Höhe, von ge-
klärtem Urteil, weitem Blick und starken Patricn
tismus", wen das deutsche Volk zum Reichstag
wählen soll. Zu diesen Männern gehört vor allem
Herr Doktor Ludwig Fulda. Herr Doktor Ludwig
Fulda antwortet dem deutschen Volk: . . kann
seine Wahlstimme nur denen geben, die für den
Oeist der Freiheit und gegen den Qeist der Hem-
mung jederzeit und unter allen Umständen einzu-
treten entschlossen sind.“ Also der Mann auf geis-
tiger Höhe. Der Mann von geklärtem Urteil
Exzellenz Wirklicher Geheimer Rat Professor
Anton von Werner antwortet dem deutschen
Volk: „Da weder die Philosophie noch die Poesie
des Volkes der Dichter und Denker wirksame
Schutz- und Machtmittel in der Politik sind, son-
dern eine starke Wehrkraft zu Wasser und zu
Lande, so muss diese des Landes erste Sorge sein.”
Des Reiches zweite Sorge aber müsste eine starke
Wehrkraft gegen das Volk der Dichter und Denker
und der Maler sein. Zu Wasser und zu Lande.
Also der Mann von geklärtem Urteil. Der Mann
mit dem weiten Blick, Herr Schriftsteller Rudolf
Stratz, Gut Lambelhof, Oberbayern, antwortet dem
deutschen Voik: „Aber das Ausland muss schliess-
lich glauben, dass unsere Diplomatie das ungeheure
Machtmittel der Armee nicht mehr als Einsatz ge-
braucht, weil es nicht mehr brauchbar ist. Von
dieser Erkenntnis bis zum Krieg ist, wenigstens bei
den Franzosen, nur ein Schritt. Gerade die ewigen
krankhaften Friedensbeteuerungen unserer Staats-
männer rufen ihn herbei. Wahrscheinlich bald.
Eben war er schon vor der Tür. Dann muss die
Armee bereit sein, damit das Schwert gut macht,
was die Feder seit Jahren gesündigt.“ Das macht
kein Schwert wieder gut. Ich bin durchaus fiir
Schiessen. Also der Mann von weiten Blick. Der
Mann von starken Patriotismus, Herr Ober-
bürgermeister, Geheimer Rat Doktor Beutler, Dres-
den, antwortet dem deutschen Volk: „Auf die An-
frage, von welchen Grundsätzen ich mich bei Aus-
übung des Wahlrechts bei den kommenden Reichs-
tagswahlen leiten lassen werden, beehre ich mich
ergebenst mitzuteilen, dass ich, wie der geehrten
Chefredaktion bekannt sein dürfte, der deutsch-kon-
servativen Partei angehöre, und daß sich daraus
meine Stellungnahme zu den kommenden Wahlen
ergibt.” Das deutsche Volk hat aber in Sachsen
von zweiundzwanzig Mandaten achtzehn den So-
zialdemokraten gegeben. Das deutsche Volk
scheint auf die führenden Männer des Lokal-Anzei-
gers nicht zu hören. Aber es abonniert ihn. Und
das ist schliesslich die Hauptsache. Gedanken
bleiben auf jeden Fall zollfrei. Da der Lokal-
Anzeiger zu seiner Ware billig kommt, kann er ge-
trost für den Block eintreten. Das Volk der Dichter
und Denker und Maler will zwar Armeen aus der
Erde stampfen. Vielleicht glückt es ihm auch noch,
ein Kornfeld auf der flachen Hand wachsen zu
lassen. Oder auf den flachen Geist. Dünger ist
bereits reichlich vorhanden.
Hier Mosse hie Langen
„Rat an den Schriftsteller. Du soll-
test nur seltene und heimliche Worte schreiben. Du
solltest in den Schatzkammern der Sprache Worte
suchen, die noch nie in einer Zeitung und in keinem
UUsteinbuche je gestanden haben. Worte, d'ie den
verlorenen Duft der Einsamkeit haben. Worte
die fremd sind und wie Orchideen an den Wurzel-
stöcken der ewigen Wälder.
Alte verschollenen Worte aus den staubigen
•Kanzieien, wo umständliülie Städtechroniken
schweinsledern stehen und von den Wändem die
Bilder toter Oberkirchenräte zusehen.
Schmieden solltest du dir selbst deine Worte,
biegsame schwirrende Worte wne Stahlklingen,
cfie züngelnd fest ins Herz der Dinge stossen.”
So redet Herr Viktor Auburtin bei Albert Lan-
gen, Sein Buch heisst natiirlioh Onyxschale. Hin-
gegen schreibt Herr Viktor Auburtin so bei Herrn
Rudolf Mosse:
„Ich wage nicht zu entscheiden, wer von
beiden Recht hat, die Lateiner, denen die Kunst
ein Spiel ist, oder wir bitteren Berliner, die da-
rum Schlachten schlagem Schiller (der die Götter
Griechenlands geschrieben hatte) sagte: „Ernst
ist das Leben, heiter ist die Kunst”. Nikolaus
Lenau drehte den Satz um und sagte: „Lächer-
lich ist das Leben, ernst ist die Kunst”. MÖglich,
dass er Recht hat, der Lenau. Aber w i r w o 1-
len nicht vergessen, dass er am E n d e
seines Leberns wahnsinnig gewor-
den ist.
Vielleioht liegt der ganze Unterschied zwi-
schen den beiden dramatischen Uiteraturen nur
bei dem verschiedenen Theaterbeginn. Das
Berliner Theater fängt um ’VSjS oder um 8 Uhr an,
das Pariser Theater um 9 Uhr oder n och viel
später. Wir Pariser haben, wenn wir ins Thea-
ter gehen, bei Larue diniert, das Couvert so un-
gefähr zu 40 Francs, und haben einen Bordeaux-
wein getrunken, der das Herz freundiich macht.
Die Berliner kommen niichtern ins Theater; sie
haben bei der Toilette allenfalls ein par hastige
Butterbrote heruntergesclungen und sind nun bös-
artig und voll nervöser Streitlust. So erklären
sich aus den Nuancen der Venus auf das Schönste
die Verschiedenheiten des Dramas. Bei den
einen die streitsiichtigen Problemstücke, Natura-
lismus, verhungerte Rattendramen und Zyan-
kalikritik . . ., bei den anderen das tächelnnde
Dulden liebenswürdiger Insipiditäten."
Biegsame schwirrende Worte wie Stahlklin-
gn, die züngelnd fest ins Herz der Dinge stossen
Herr Auburtin kann nichts dafür, er muss nun ein-
mal so. Für Ullstein findet er keine Worte, das
hat er nicht nötig. Denn Herr Auburtin ist auch
gegen die BerlinerHausfrau, für die der Musikkri-
tiker Ullsteins, Herr Erich Urban, hinwieder
glühende Worte in seinem Kochbuch fand. Aber
Herr Viktor Auburtin giesst die Onyxschale seines
Zorns bei Langen über sie aus:
„Und ich habe wahrgenommen, dass das Ge-
sicht keines Tieres so gemein werden kann, wie das
des Menschen. Nicht einmal der Schabrakentapir
und auch das Warzenschwein nicht. sinken auf die
Stufe der Entgottung, auf der eine praktische Ber-
liner Hausfrau steht.”
Nun habe ich nur noch einen Wunsch: das Ge-
sicht des Herrn Auburtin zu sehen. Vielleicht tut
mir der Weltspiegel den Gefallen.
Wie diehtet man klar?
Ein soziologischer Privatdozent an der techni-
schen Universität zu Prag, namens Foustka, hat ein
Buchchen iiber die Abstinenz als Kulturproblem
„mit besonderer Berücksichtigung der österreichi-
schen Völkerstämme“ geschrieben. Bei dieser Ge-
Iegenheit löste er nebenbei das Problem der Dich-
tung, insbesondere der Mystik. Künstler dürfen
nicht saufen. Klar wie Wasser wird die Dichtung
fließen, wenn man keinen Tropfen Alkohol hinein-
schüttet. Selbst Goethe, wenn er . . . Wrklich:
Ich will nicht behaupten, daß an dem Uto-
pischen. Unklaren und Verschwommenen, das
uns in vielen Werken der Romantik, des Symi
bolismus u. a. befremdet, der Alkoholismus
Sohuld trägt. Aber ließe sich nicht vielleicht so
manche Stelle eben durch das s p e z i e ! 1 e
Verhältnis des Autors zum Wein, Sekt
oder Bier besser erklären als durch gekünstelte
Exegese? H a t d o c h Gutsmann schon auf dem
Fünften internationalen Kongreß die Bemerkung
fallen lassen, daß sogar Goethe den zweiten Teil
des ,JFaust“ k 1 a r e r geschrieben hätte, wenn er
abstinente Lebensführung hätte zustandebringen
können.
Was wäre Goethe geworden, wenn 1 er dieses
Buchchen noch erlebt hätte? Möge er allen lebem-
den Dichtern, er und se>ine nichtzustandegebrachte
abstinente Lebensführung, eine Warnung bedeuten!
Seerfiuberqeschichten
Herr Ludwig Fulda denkt und dichtet feste
weiter. Die Uraufführungen seiner Werke finden
neuerdings im Wiener Burgtheater statt. Ein so
berühmtes Theater muß seinen Ehrgeiz befriedigen.
Das Lustspiel Der Seeräuber ist daher auch in Ver-
sen gedichtet und zwar in solchen:
Die Gefoppte, ja, die hin ich.
Beide habt ihr mich getäuscht,
Mich belogen und betrogen:
Darin hat vor’m andern keiner
Was voraus. Und doch, mich dünkt —
S e i n e Lüge war die schön’re.
Biederkeit ward mir von D i r
Kunstreich vorgespielt, von ihm
Heldentum; du hast geheuchelt,
Er gedichtet. Ausgegähnt
Hast du dich an meiner Seite
So gähnt es stundenlang woiter. Aber es gibt
Leute, die das fiir Dichtung halten. Denn die Vos-
sische Zeitung, ein Herr -m. bemerkt: „Kurzum:
Fulda und das Burgtheater dürfen wieder emmal
miteinander zufrieden sein. Und die Kritik mag
sich damit bescheiden. daß Fulda sein B e s t e s
gab.“ Das Herzblut spritzt nur so, aber der Herr
a-r von Ullstein fühlt sich nicht betroffen. Und be-
merkt seinerseits: der Schluß sei vollständig ab-
gefallen, das Publikum ziemlich ungnädig gewesei,
und die Idee des Stückes h ä 11 e auch psycholo-
gisch vertieft werden k ö n n e n. Die B. Z. ist
immer mehr für die Tiefe, während die Voss sich
lieber in die klassische Breite reckt. Deswegen
behauptet die B. Z.: „Leider v e r s a g t Thimig als
moralisch gewordener Seeräuber vollständig; dle
RoIIe hätte einen Darsteller erfordert. dem man
vollbrachte Taten hätte glauben können.“ Mora-
lisch gewordener Seeräuber klingt iibrigens doch
stark nach Tiefe. Hingegen behauptet die Voss:
Thimig überraschte durch nicht gewöhnliche
Kraft und Sorgfalt: er schuf im Wetteifer mit
Fulda eine Charakterfigur, die nicht leicht zu ver-
gessen sein wird.“ Man weiß nun nicht, ob Herr
Thimig im Schaffen oder im Versagen größer ist.
Ueber die übrigen Darsteller sind sich die Herren
aber einig. Ein Herr „ließ alle Humore spielen“
Eine Dame „gab sich als Evastochter erster Güte“.
Und eine andere Dame „war die richtige heiß-
blütige, rachsüchtige Siidspanierin“. „Hauptsäch-
lich“ scheinen also doch Charakterfiguren aufge^
treten zu sein.
Die Pressemuse
„Der Musenalmanach, der auf dem Presseball
den Damen in der angenehmen Begleitung einer
geschmackvollen Sarottibonbonniöre überreicht
wird, ist diesmal besonders stattlich und inhalts-
reich ausgefallen.“ Dieser Satz bezieht sich zweb
fellos auf den Musenalmanach. „Was der Alt-
meister der Reimkunst Aibert Traeger in seinem
Im Zoo überschriebenen reizenden Gedicht von den
Freuden des Presseballes singt, das wollen wir
schon heute durch Wiedergabe der Schlußstrophe
verraten.“ Wir auch:
„Und ob auch draußen rauhe Stürme wüten
In winterlicher blumenloser Zeit,
Hier sind erwacht die wunderholden Blüten
Die Damen steh’n vergniigt zum Tanz bereit,
Sie lassen mie vergebens sich erwarten,
Die frohe Botschaft zündet überall
Sie kamen auch zum Zoolog’schen Garten