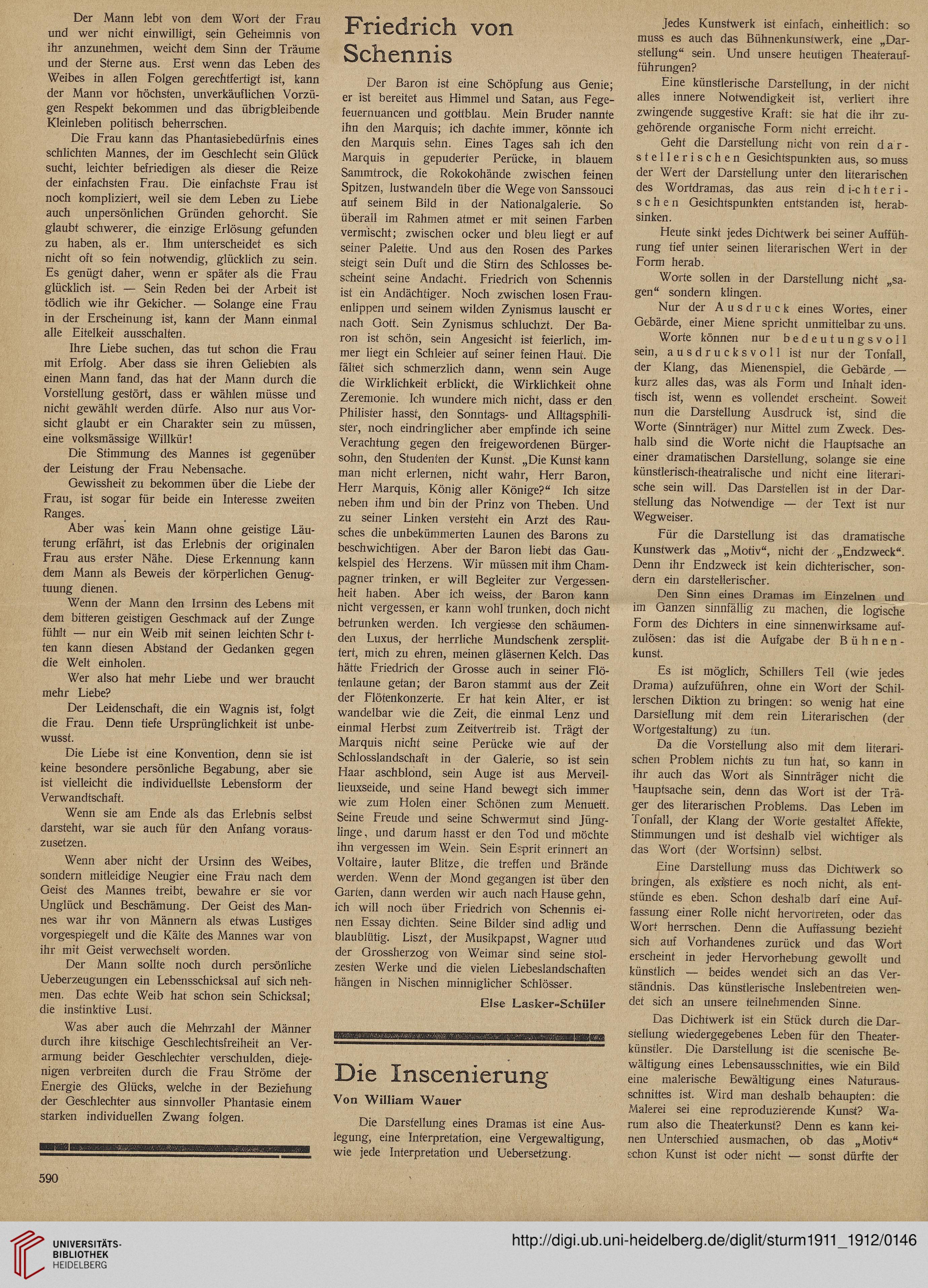Der Sturm: Monatsschrift für Kultur und die Künste — 2.1911-1912
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.31771#0146
DOI Heft:
Nr. 74 (August 1911)
DOI Artikel:Fuchs, Richard: Die Lehrprobe des Mannes
DOI Artikel:Lasker-Schüler, Else: Friedrich von Schennis
DOI Artikel:Wauer, William: Die Inscenierung
DOI Heft:Nr. 75 (August 1911)
DOI Artikel:Walden, Herwarth: Die Vinnen gegen den Erbfeind
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.31771#0146
Der Mann lebt von dem Wort der Frau
und wer nicht einwilligt, sein Geheimnis von
ihr anzunehmen, weicht dem Sinn der Träume
und der Sterne aus. Erst wenn das Leben des
Weibes in allen Folgen gerechtfertigt ist, kann
der Mann vor höchsten, unverkäuflichen Vorzü-
gen Respekt bekommen und das übrigbleibende
Kleinleben politisch beherrschen.
Die Frau kann das Phantasiebedürfnis eines
schlichten Mannes, der im Geschlecht sein Glück
sucht, leichter befriedigen als dieser die Reize
der einfachsten Frau. Die einfachste Frau ist
noch kompliziert, weil sie dem Leben zu Liebe
auch unpersönlichen Gründen gehorcht. Sie
glaubt schwerer, die einzige Erlösung gefunden
zu haben, als er. Ihm unterscheidet es sich
nicht oft so fein notwendig, glücklich zu sein.
Es genügt daher, wenn er später als die Frau
glücklich ist. — Sein Reden bei der Arbeit ist
tödlich wie ihr Gekicher. — Solange eine Frau
in der Erscheinung ist, kann der Mann einmal
alle Eitelkeit ausschalten.
Ihre Liebe suchen, das tut schon die Frau
mit Erfolg. Aber dass sie ihren Geliebten als
einen Mann fand, das hat der Mann durch die
Vorstellung gestört, dass er wählen müsse und
nicht gewählt werden dürfe. Also nur aus Vor-
sicht glaubt er ein Charakter sein zu müssen,
eine volksmässige Willkür!
Die Stimmung des Mannes ist gegenüber
der Leistung der Frau Nebensache.
Gewissheit zu bekommen über die Liebe der
Frau, ist sogar für beide ein Interesse zweiten
Ranges.
Aber was kein Mann ohne geistige Läu-
terung erfährt, ist das Erlebnis der originalen
Frau aus erster Nähe. Diese Erkennung kann
dem Mann als Beweis der körperlichen Genug-
tuung dienen.
Wenn der Mann den Irrsinn des Lebens mit
dem bitteren geistigen Geschmack auf der Zunge
fühflt — nur ein Weib mit seinen leichten Schr t-
ten kann diesen Abstand der Gedanken gegen
die Welt einholen.
Wer also hat mehr Liebe und wer braucht
mehr Liebe?
Der Leidenschaft, die ein Wagnis ist, folgt
die Frau. Denn tiefe Ursprünglichkeit ist unbe-
wusst.
Die Liebe ist eine Konvention, denn sie ist
keine besondere persönliche Begabung, aber sie
ist vielleicht die individuellste Lebensform der
Verwandtschaft.
Wenn sie am Ende als das Erlebnis selbst
clarsteht, war sie auch für den Anfang voraus-
zusetzen.
Wenn aber nicht der Ursinn des Weibes,
sondern mitleidige Neugier eine Frau nach dem
Geist des Mannes treibt, bewahre er sie vor
Unglück und Beschämung. Der Geist des Man-
nes war ihr von Männern als etwas Lustiges
vorgespiegelt und die Kälte des Mannes war von
ihr mit Geist verwechselt worden.
Der Mann sollte noch durch persönliehe
Ueberzeugungen ein Lebensschicksal auf sich neh-
men. Das echte Weib hat schon sein Schicksal;
die instinktive Lust.
Was aber auch die Mehrzahl der Männer
durch ihre kitschige Geschlechtsfreiheit an Ver-
armung beider Geschlechter verschulden, dieje-
nigen verbreiten durch die Frau Ströme der
Energie des Glücks, welche in der Beziehung
der Geschlechter aus sinnvoller Phantasie einem
starken individuellen Zwang folgen.
Friedrich von
Schennis
Der Baron ist eine Schöpfung aus Genie;
er ist bereitet aus Himmel und Satan, aus Fege-
feuernuancen und gottblau. Mein Bruder nannte
ihn den Marquis; ich dachte immer, könnte ich
den Marquis sehn. Eines Tages sah ich den
Marquis in gepuderter Perücke, in blauem
Sammtrock, die Rokokohände zwischen feinen
Spitzen, lustwandeln über die Wege von Sanssouci
auf seinem Bild in der Nationalgalerie. So
überall im Rahmen atmet er mit seinen Farben
vermischt; zwischen ocker und bleu liegt er auf
seiner Palette. Und aus den Rosen des Parkes
steigt sein Duft und die Stim des Schlosses be-
scheint seine Andacht. Friedrich von Schennis
ist ein Andächtiger. Noch zwischen losen Frau-
enlippen und seinem wilden Zynismus lauscht er
nach Gott. Sein Zynismus schluchzt. Der Ba-
ron ist schön, sein Angesicht ist feierlich, im-
mer liegt ein Schleier auf seiner feinen Haut. Die
fältet sich schmerzlich dann, wenn sein Auge
die Wirklichkeit erblickt, die Wirklichkeit ohne
Zeremonie. Ich wundere mich nicht, dass er den
Philister hasst, den Sonntags- und Alltagsphili-
ster, noch eindringlicher aber empfinde ich seine
Verachtung gegen den freigewordenen Bürger-
sohn, den Studenten der Kunst. „Die Kunst kann
man nicht erlernen, nicht wahr, Herr Baron,
Herr Marquis, König aller Könige?“ Ich sitze
neben ihm und bin der Prinz von Theben. Und
zu seiner Linken versteht ein Arzt des Rau-
sches die unbekümmerten Launen des Barons zu
beschwichtigen. Aber der Baron liebt das Gau-
kelspiel des Herzens. Wir müssen mit ihm Cham-
pagner trinken, er will Begleiter zur Vergessen-
heit haben. Aber ich weiss, der Baron kann
nicht vergessen, er kann wohl trunken, doch nicht
betrunken werden. Ich vergiesse den schäumen-
den Luxus, der herrliche Mundschenk zersplit-
tert, mich zu ehren, meinen gläsernen Kelch. Das
hätte Friedrich der Grosse auch in seiner Flö-
tenlaune getan; der Baron stammt aus der Zeit
der Flötenkonzerte. Er hat kein Alter, er ist
wandelbar wie die Zeit, die einmal Lenz und
einmal Herbst zum Zeitvertreib ist. Trägt der
Marquis nicht seine Perücke wie auf der
Schlosslandschaft in der Galerie, so ist sein
Haar aschblond, sein Auge ist aus Merveil-
lieuxseide, und seine Hand bewegt sich immer
wie zum Holen einer Schönen zum Menuett.
Seine Freude und seine Schwermut sind Jüng-
linge, und darum hasst er den Tod und möchte
ihn vergessen im Wein. Sein Esprit erinnert an
Voltaire, lauter Blitze, die treffen und Brände
werden. Wenn der Mond gegangen ist über den
Garten, dann werden wir auch nach Hause gehn,
ich will noch über Friedrich von Schennis ei-
nen Essay dichten. Seine Bilder sind adlig und
blaublütig. Liszt, der Musikpapst, Wagner uud
der Grossherzog von Weimar sind seine stol-
zesten Werke und die vielen Liebeslandschaften
hängen in Nischen minniglicher Schlösser.
Else Lasker-Schüler
Die Inscenierung
Von William Wauer
Die Darstellung eines Dramas ist eine Aus-
legung, eine Interpretation, eine Vergewaltigung,
wie jecle Interpretation und Uebersetzung.
Jedes Kunstwerk ist einfach, einheitlich: so
muss es auch das Bühnenkunstwerk, eine „Dar-
stellung“ sein. Und unsere heutigen Theaterauf-
führungen?
Eine künstlerische Darstellung, in der nicht
alles innere Notwendigkeit ist, verliert ihre
zwingende suggestive Kraft: sie hat die ihr zu-
gehörende organische Form nicht erreicht.
Geht die Darstellung nicht von rein d a r -
stellerischen Gesichtspunkten aus, somuss
der Wert der Darstellung unter den literarischen
des Wortdramas, das aus rein d i-c h t e r i -
s c h e n Gesichtspunkten entstanden ist, herab-
sinken.
Heute sinkt jedes Dichtwerk bei seiner Auffüh-
rung tief unter seinen literarischen Wert in der
Form herab.
Worte sollen in der Darstellung nicht „sa-
gen“ sondern klingen.
Nur der Ausdruck eines Wortes, einer
Gebärde, einer Miene spricht unmittelbar zu uns.
Worte können nur bedeutungsvoll
sein, ausdrucksvoll ist nur der Tonfall,
der Klang, das Mienenspiel, die Gebärde —
kurz alles das, was als Form und Inhalt iden-
tisch ist, wenn es vollendet erscheint. Soweit
nun die Darstellung Ausdruck >st, sind die
Worte (Sinnträger) nur Mittel zum Zweck. Des-
halb sind die Worte nicht die Hauptsache an
einer dramatischen Darstellung, solange sie eine
künstlerisch-theatralische und nicht eine iiterari-
sche sein will. Das Darstellen ist in der Dar-
stellung das Notwendige — der Text ist nur
Wegweiser.
Für die Darstellung ist das dramatische
Kunstwerk das „Motiv“, nicht der „Endzweck“.
Denn ihr Endzweck ist kein dichterischer, son-
dern ein darstellerischer.
Den Sinn eines Dramas im Einzelnen und
im Ganzen sinnfällig zu machen, die logische
Form des Dichters in eine sinnenwirksame auf-
zuiösen: das ist die Aufgabe der B ü h n e n -
kunst.
Es ist möglich', Schillers Tell (wie jedes
Drama) aufzuführen, ohne ein Wort der Schil-
lerschen Diktion zu bringen: so wenig hat eine
Darstellung mit dem rein Literarischen (der
Wortgestaltung) zu iun.
Da die Vorstellung also mit dem literari-
schen Problem nichts zu tun hat, so kann in
ihr auch das Wort als Sinnträger nicht die
Hauptsache sein, denn das Wort ist der Trä-
ger des literarischen Problems. Das Leben im
Tonfall, der Klang der Worte gestaltet Affekte,
Stimmungen und ist deshalb viel wichtiger als
das Wort (der Wortsinn) selbst.
Eine Darstellung muss das Dichtwerk so
bringen, als exfetiere es noch nicht, als ent-
stünde es eben. Schon deshalb darf eine Auf-
fassung einer Rolle nicht hervortreten, oder das
Wori herrschen. Denn die Auffassung bezieht
sich auf Vorhandenes zurück und das Wort
erscheint in jeder Hervorhebung gewollt und
künstlich — beides wendet sich an das Ver-
sfänclnis. Das künstlerische Inslebentreten wen-
det sich an unsere teilnehmenden Sinne.
Das Dichtwerk ist ein Stück durch die Dar-
stellung wiedergegebenes Leben für den Theater-
künstler. Die Darstellung ist die scenische Be-
wältigung eines Lebensausschnittes, wie ein Bild
eine malerische Bewältigung eines Naturaus-
schnittes ist. Wird man deshalb behaupten: die
Malerei sei eine reproduzierende Kunst? Wa-
rum also die Theaterkunst? Denn es kann kei-
nen Unterschied ausmachen, ob das „Motiv“
schon Kunst ist oder nicht — sonst dürfte der
590
und wer nicht einwilligt, sein Geheimnis von
ihr anzunehmen, weicht dem Sinn der Träume
und der Sterne aus. Erst wenn das Leben des
Weibes in allen Folgen gerechtfertigt ist, kann
der Mann vor höchsten, unverkäuflichen Vorzü-
gen Respekt bekommen und das übrigbleibende
Kleinleben politisch beherrschen.
Die Frau kann das Phantasiebedürfnis eines
schlichten Mannes, der im Geschlecht sein Glück
sucht, leichter befriedigen als dieser die Reize
der einfachsten Frau. Die einfachste Frau ist
noch kompliziert, weil sie dem Leben zu Liebe
auch unpersönlichen Gründen gehorcht. Sie
glaubt schwerer, die einzige Erlösung gefunden
zu haben, als er. Ihm unterscheidet es sich
nicht oft so fein notwendig, glücklich zu sein.
Es genügt daher, wenn er später als die Frau
glücklich ist. — Sein Reden bei der Arbeit ist
tödlich wie ihr Gekicher. — Solange eine Frau
in der Erscheinung ist, kann der Mann einmal
alle Eitelkeit ausschalten.
Ihre Liebe suchen, das tut schon die Frau
mit Erfolg. Aber dass sie ihren Geliebten als
einen Mann fand, das hat der Mann durch die
Vorstellung gestört, dass er wählen müsse und
nicht gewählt werden dürfe. Also nur aus Vor-
sicht glaubt er ein Charakter sein zu müssen,
eine volksmässige Willkür!
Die Stimmung des Mannes ist gegenüber
der Leistung der Frau Nebensache.
Gewissheit zu bekommen über die Liebe der
Frau, ist sogar für beide ein Interesse zweiten
Ranges.
Aber was kein Mann ohne geistige Läu-
terung erfährt, ist das Erlebnis der originalen
Frau aus erster Nähe. Diese Erkennung kann
dem Mann als Beweis der körperlichen Genug-
tuung dienen.
Wenn der Mann den Irrsinn des Lebens mit
dem bitteren geistigen Geschmack auf der Zunge
fühflt — nur ein Weib mit seinen leichten Schr t-
ten kann diesen Abstand der Gedanken gegen
die Welt einholen.
Wer also hat mehr Liebe und wer braucht
mehr Liebe?
Der Leidenschaft, die ein Wagnis ist, folgt
die Frau. Denn tiefe Ursprünglichkeit ist unbe-
wusst.
Die Liebe ist eine Konvention, denn sie ist
keine besondere persönliche Begabung, aber sie
ist vielleicht die individuellste Lebensform der
Verwandtschaft.
Wenn sie am Ende als das Erlebnis selbst
clarsteht, war sie auch für den Anfang voraus-
zusetzen.
Wenn aber nicht der Ursinn des Weibes,
sondern mitleidige Neugier eine Frau nach dem
Geist des Mannes treibt, bewahre er sie vor
Unglück und Beschämung. Der Geist des Man-
nes war ihr von Männern als etwas Lustiges
vorgespiegelt und die Kälte des Mannes war von
ihr mit Geist verwechselt worden.
Der Mann sollte noch durch persönliehe
Ueberzeugungen ein Lebensschicksal auf sich neh-
men. Das echte Weib hat schon sein Schicksal;
die instinktive Lust.
Was aber auch die Mehrzahl der Männer
durch ihre kitschige Geschlechtsfreiheit an Ver-
armung beider Geschlechter verschulden, dieje-
nigen verbreiten durch die Frau Ströme der
Energie des Glücks, welche in der Beziehung
der Geschlechter aus sinnvoller Phantasie einem
starken individuellen Zwang folgen.
Friedrich von
Schennis
Der Baron ist eine Schöpfung aus Genie;
er ist bereitet aus Himmel und Satan, aus Fege-
feuernuancen und gottblau. Mein Bruder nannte
ihn den Marquis; ich dachte immer, könnte ich
den Marquis sehn. Eines Tages sah ich den
Marquis in gepuderter Perücke, in blauem
Sammtrock, die Rokokohände zwischen feinen
Spitzen, lustwandeln über die Wege von Sanssouci
auf seinem Bild in der Nationalgalerie. So
überall im Rahmen atmet er mit seinen Farben
vermischt; zwischen ocker und bleu liegt er auf
seiner Palette. Und aus den Rosen des Parkes
steigt sein Duft und die Stim des Schlosses be-
scheint seine Andacht. Friedrich von Schennis
ist ein Andächtiger. Noch zwischen losen Frau-
enlippen und seinem wilden Zynismus lauscht er
nach Gott. Sein Zynismus schluchzt. Der Ba-
ron ist schön, sein Angesicht ist feierlich, im-
mer liegt ein Schleier auf seiner feinen Haut. Die
fältet sich schmerzlich dann, wenn sein Auge
die Wirklichkeit erblickt, die Wirklichkeit ohne
Zeremonie. Ich wundere mich nicht, dass er den
Philister hasst, den Sonntags- und Alltagsphili-
ster, noch eindringlicher aber empfinde ich seine
Verachtung gegen den freigewordenen Bürger-
sohn, den Studenten der Kunst. „Die Kunst kann
man nicht erlernen, nicht wahr, Herr Baron,
Herr Marquis, König aller Könige?“ Ich sitze
neben ihm und bin der Prinz von Theben. Und
zu seiner Linken versteht ein Arzt des Rau-
sches die unbekümmerten Launen des Barons zu
beschwichtigen. Aber der Baron liebt das Gau-
kelspiel des Herzens. Wir müssen mit ihm Cham-
pagner trinken, er will Begleiter zur Vergessen-
heit haben. Aber ich weiss, der Baron kann
nicht vergessen, er kann wohl trunken, doch nicht
betrunken werden. Ich vergiesse den schäumen-
den Luxus, der herrliche Mundschenk zersplit-
tert, mich zu ehren, meinen gläsernen Kelch. Das
hätte Friedrich der Grosse auch in seiner Flö-
tenlaune getan; der Baron stammt aus der Zeit
der Flötenkonzerte. Er hat kein Alter, er ist
wandelbar wie die Zeit, die einmal Lenz und
einmal Herbst zum Zeitvertreib ist. Trägt der
Marquis nicht seine Perücke wie auf der
Schlosslandschaft in der Galerie, so ist sein
Haar aschblond, sein Auge ist aus Merveil-
lieuxseide, und seine Hand bewegt sich immer
wie zum Holen einer Schönen zum Menuett.
Seine Freude und seine Schwermut sind Jüng-
linge, und darum hasst er den Tod und möchte
ihn vergessen im Wein. Sein Esprit erinnert an
Voltaire, lauter Blitze, die treffen und Brände
werden. Wenn der Mond gegangen ist über den
Garten, dann werden wir auch nach Hause gehn,
ich will noch über Friedrich von Schennis ei-
nen Essay dichten. Seine Bilder sind adlig und
blaublütig. Liszt, der Musikpapst, Wagner uud
der Grossherzog von Weimar sind seine stol-
zesten Werke und die vielen Liebeslandschaften
hängen in Nischen minniglicher Schlösser.
Else Lasker-Schüler
Die Inscenierung
Von William Wauer
Die Darstellung eines Dramas ist eine Aus-
legung, eine Interpretation, eine Vergewaltigung,
wie jecle Interpretation und Uebersetzung.
Jedes Kunstwerk ist einfach, einheitlich: so
muss es auch das Bühnenkunstwerk, eine „Dar-
stellung“ sein. Und unsere heutigen Theaterauf-
führungen?
Eine künstlerische Darstellung, in der nicht
alles innere Notwendigkeit ist, verliert ihre
zwingende suggestive Kraft: sie hat die ihr zu-
gehörende organische Form nicht erreicht.
Geht die Darstellung nicht von rein d a r -
stellerischen Gesichtspunkten aus, somuss
der Wert der Darstellung unter den literarischen
des Wortdramas, das aus rein d i-c h t e r i -
s c h e n Gesichtspunkten entstanden ist, herab-
sinken.
Heute sinkt jedes Dichtwerk bei seiner Auffüh-
rung tief unter seinen literarischen Wert in der
Form herab.
Worte sollen in der Darstellung nicht „sa-
gen“ sondern klingen.
Nur der Ausdruck eines Wortes, einer
Gebärde, einer Miene spricht unmittelbar zu uns.
Worte können nur bedeutungsvoll
sein, ausdrucksvoll ist nur der Tonfall,
der Klang, das Mienenspiel, die Gebärde —
kurz alles das, was als Form und Inhalt iden-
tisch ist, wenn es vollendet erscheint. Soweit
nun die Darstellung Ausdruck >st, sind die
Worte (Sinnträger) nur Mittel zum Zweck. Des-
halb sind die Worte nicht die Hauptsache an
einer dramatischen Darstellung, solange sie eine
künstlerisch-theatralische und nicht eine iiterari-
sche sein will. Das Darstellen ist in der Dar-
stellung das Notwendige — der Text ist nur
Wegweiser.
Für die Darstellung ist das dramatische
Kunstwerk das „Motiv“, nicht der „Endzweck“.
Denn ihr Endzweck ist kein dichterischer, son-
dern ein darstellerischer.
Den Sinn eines Dramas im Einzelnen und
im Ganzen sinnfällig zu machen, die logische
Form des Dichters in eine sinnenwirksame auf-
zuiösen: das ist die Aufgabe der B ü h n e n -
kunst.
Es ist möglich', Schillers Tell (wie jedes
Drama) aufzuführen, ohne ein Wort der Schil-
lerschen Diktion zu bringen: so wenig hat eine
Darstellung mit dem rein Literarischen (der
Wortgestaltung) zu iun.
Da die Vorstellung also mit dem literari-
schen Problem nichts zu tun hat, so kann in
ihr auch das Wort als Sinnträger nicht die
Hauptsache sein, denn das Wort ist der Trä-
ger des literarischen Problems. Das Leben im
Tonfall, der Klang der Worte gestaltet Affekte,
Stimmungen und ist deshalb viel wichtiger als
das Wort (der Wortsinn) selbst.
Eine Darstellung muss das Dichtwerk so
bringen, als exfetiere es noch nicht, als ent-
stünde es eben. Schon deshalb darf eine Auf-
fassung einer Rolle nicht hervortreten, oder das
Wori herrschen. Denn die Auffassung bezieht
sich auf Vorhandenes zurück und das Wort
erscheint in jeder Hervorhebung gewollt und
künstlich — beides wendet sich an das Ver-
sfänclnis. Das künstlerische Inslebentreten wen-
det sich an unsere teilnehmenden Sinne.
Das Dichtwerk ist ein Stück durch die Dar-
stellung wiedergegebenes Leben für den Theater-
künstler. Die Darstellung ist die scenische Be-
wältigung eines Lebensausschnittes, wie ein Bild
eine malerische Bewältigung eines Naturaus-
schnittes ist. Wird man deshalb behaupten: die
Malerei sei eine reproduzierende Kunst? Wa-
rum also die Theaterkunst? Denn es kann kei-
nen Unterschied ausmachen, ob das „Motiv“
schon Kunst ist oder nicht — sonst dürfte der
590