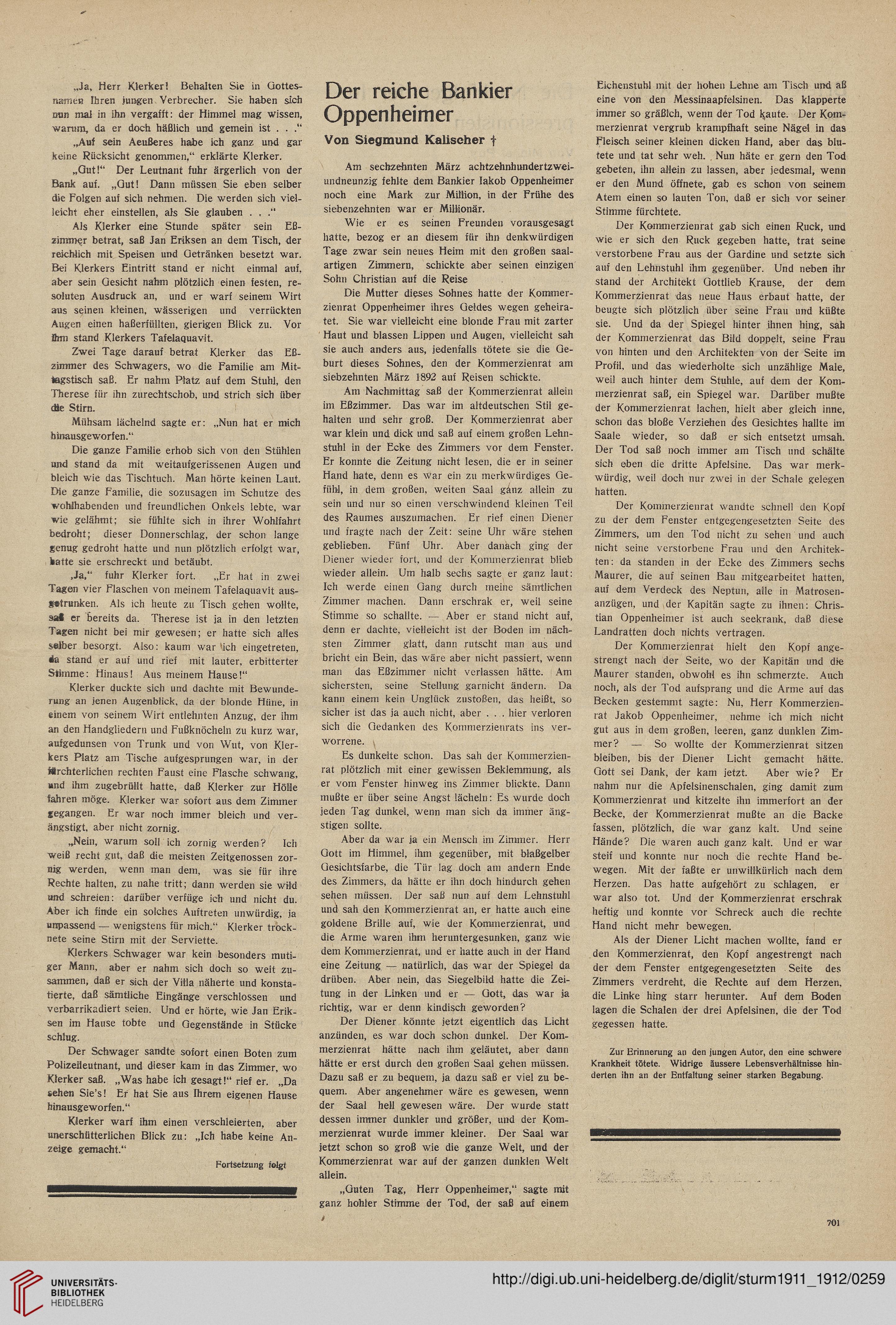„Ja, Herr Klerkerl Behalten Sie in Qottes-
namen Ihren jungen Verbrecher. Sie haben sich
nun maJ in ihn vergafft: der Himmel mag wissen,
wanim, da er doch häßlich und gemein ist . . .“
„Auf sein Aeußeres habe ich ganz und gar
keine Rücksicht genommen,“ erklärte Klerker.
„Qut!“ Der Leutnant fuhr ärgerlich von der
Bank auf. „Qut! Dann müssen Sie eben selber
die Folgen auf sich nehmen. Die werden sich viei-
leicht eher einstellen, ais Sie glauben . . .“
Ais Klerker eine Stunde später sein Eß-
zimmer betrat, saß Jan Eriksen an dem Tisch, der
rekdhlich mit Speisen und Getränken besetzt war.
Bei Klerkers Eintritt stand er nicht einmal auf,
aber sein Gesicht nahrn plötzlich einen festen, re-
soluten Ausdruck an, und er warf seinem Wirt
aus seinen kieinen, wässerigen und verrückten
Augen einen haßerfüllten, gierigen Blick zu. Vor
Ihm stand Klerkers Tafelaquavit.
Zwei Tage darauf betrat Klerker das Eß-
zimmer des Schwagers, wo die Familie am Mit-
tegstisch saß. Er nahin Platz auf dem Stuh], den
Therese fiir ihn zurechtschob, und strich sich über
dle Stirn.
Mühsam lächelnd sagte er: „Nun hat er mich
hinausgeworfen.“
Die ganze Familie erhob sich von den Stühlen
und stand da mit weitaufgerissenen Augen und
bleich wie das Tischtuch. Man hörte keinen Laut.
Die ganze Familie, die sozusagen im Schutze des
wohilhabenden und freundlichen Onkels lebte, war
wie gelähmt; sie fühlte sich in ihrer Wohifahrt
bedroht; dieser Donnerschlag, der schon lange
genug gedroht hatte und nun plötzlich erfolgt war,
hatte sie erschreckt und betäubt.
,Ja,“ fuhr Klerker fort. „Er hat in zwei
Tagen vier Flaschen von meinem Tafelaquavit aus-
gterunken. Als ich heute zu Tisch gehen wollte,
sai er bereits da. Therese ist ja in den letzten
Tagen nicht bei mir gewesen; er hatte sich alles
seiber besorgt. Also: kaum war 'ich eingetreten,
ia stand er auf und rief mit lauter, erbitterter
Stiinme: Hinaus! Aus meinem Hause!“
Klerker duckte sich und dachte mit Bewunde-
rung an jenen Augenblick, da der blonde Hiine, in
einem von seinem Wirt entlehnten Anzug, der ihm
an den Handgliedern und Fußknöcheln zu kurz war,
aufgedunsen von Trunk und von Wut, von Kler-
kers Platz am Tische aufgesprungen war, in der
firchterlichen rechten Faust eine Flasche schwang,
»nd ihm zugebrüllt hatte, daß Klerker zur Höße
fahren möge. Klerker war sofort aus dem Zimmer
gegangen. Er war noch immer bleich und ver-
ängstigt, aber nicht zornig.
„Nein, warum soll ich zornig werden? Ich
weiß recht gut, daß die ineisten Zeitgenossen zor-
nig werden, wenn man dem, was sie für ihre
Rechte halten, zu nahe tritt; dann werden sie wild
und schreien: darüber verfüge ich und nicht du.
Aber ich finde ein solches Auftreten unwürdig, ja
unpassend — wenigstens fiir mich.“ Klerker trock-
nete seine Stirn mit der Serviette.
Klerkers Schwager war kein besonders muti-
ger Mann, aber er nahm sich doch so weit zu-
sammen, daß er sich der Vitla näherte und konsta-
tierte, daß sämtliche Eingänge verschlossen und
verbarrikadiert seien. Und er hörte, wie Jan Erik-
sen im Hause tobte und Gegenstände in Stücke
schlug.
Der Schwager sandte sofort einen Boten zum
Polizeiieutnant, und dieser kam in das Zimmer, wo
Klerker saß. „Was habe ich gesagt!“ rief er. „Da
sehen Sie’s! Er hat Sie aus Ihrem eigenen Hause
hinausgeworfen.“
Klerker warf ihm einen verschleierten, aber
unerschütterlichen Blick zu: „Ich habe keine An-
zeige gemacht.“
Fortsetzung folgt
Der reiche Bankier
Oppenheimer
Von Siegmund Kaliseher f
Am sechzehnten März achtzehnhundertzwei-
undneunzig fehlte dem Bankier Iakob Oppenheimer
noch eine Mark zur Million, in der Frühe des
siebenzehnten war er Millionär.
Wie er es seinen Freunden vorausgesagt
hatte, bezog er an diesem für ihn denkwürdigen
Tage zwar sein neues Heim mit den großen saal-
artigen Zimmern, schickte aber seinen einzigen
Sohn Christian auf die Reise
Die Mutter dieses Sohnes hatte der Komrner-
zienrat Oppenheimer ihres Geldes wegen geheira-
tet. Sie war vielleicht eine blonde Frau mit zarter
Haut und blassen Lippen und Augen, vielleicht sah
sie auch anders aus, jedenfails tötete sie die Ge-
burt dieses Sohnes, den der Kommerzienrat am
siebzehnten März 1892 auf Reisen schickte.
Am Nachmittag saß der Kommerzienrat allein
im Eßzimmer. Das war im altdeutschen Stii ge-
halten und sehr groß. Der Kommerzienrat aber
war kiein und dick und saß auf einem großen Lehn-
stuhl in der Ecke des Zimmers vor dem Fenster.
Er konnte die Zeitung nicht lesen. die er in seiner
Hand hate, denn es war ein zu merkwürdiges Ge-
fühl, in dem großen, weiten Saal gänz allein zu
sein und nur so einen verschwindend kleinen Teil
des Raumes auszumachen. Er rief einen Diener
und fragte nach der Zeit: seine Uhr wäre stehen
geblieben. Fünf Uhr. Aber danäch ging der
Diener wieder fort, und der Konnnerzienrat biieb
wieder allein. Um halb sechs sagte er ganz laut:
Ich werde einen Gang durcli ineine sämtlichen
Zimmer machen. Dann erschrak er, weil seine
Stimme so schallte. — Aber er stand nicht auf,
denn er dachte, vieileicht ist der Boden im näch-
sten Zimmer giatt, dann rutscht man aus und
bricht ein Bein, das wäre aber nicht passiert, wenn
man das Eßzinuner nicht verlassen hätte. Am
sichersten, seine Stellung garnicht ändern. Da
kann einem kein Ungltick zustoßen, das heißt, so
sicher ist das ja auch nicht, aber . . . hier verloren
sich die Gedanken des Kommerzienrats ins ver-
worrene.
Es dunkelte schon. Das sah der Kommerzien-
rat plötzlich mit einer gewissen Beklemmung, als
er vom Fenster hinweg ins Zirnmer blickte. Dann
mußte er über seine Angst lächeln: Es wurde doch
jeden Tag dunkei, wenn man sich da irnrner äng-
stigen sollte.
Aber da war ja ein Mensch im Zimmer. Herr
Gott im Himmel, ihm gegeniiber, mit blaßgeiber
Gesichtsfarbe, die Tür lag doch am andern Ende
des Zimmers, da hätte er ihn doch hindurch gehen
sehen müssen. Der saß nun auf dem Lehnstuhl
und sah den Kommerzienrat an, er hatte aueh eine
goldene Brille auf, wie der Kommerzienrat, und
die Arme waren ihm heruntergesunken, ganz wie
dem Kommerzienrat, und er hatte auch in der Hand
eine Zeitung — natürlich, das war der Spiegel da
drüben. Aber nein, das Siegelbild hatte die Zei-
tung in der Linken und er — Gott, das war ja
richtig, war er denn kindisch geworden?
Der Diener könnte jetzt eigentlich das Licht
anzünden, es war doch schon dunkel. Der Kom-
merzienrat hätte nach ihm geiäutet, aber dann
hätte er erst durch den großen Saal gehen müssen.
Dazu saß er zu bequem, ja dazu saß er viel zu be-
quem. Aber angenehmer wäre es gewesen, wenn
der Saal heil gewesen wäre. Der wurde statt
dessen imrner dunkler und größer, und der Kom-
merzienrat wurde immer kleiner. Der Saal war
jetzt schon so groß wie die ganze Welt, und der
Kommerzienrat war auf der ganzen dunklen Welt
allein.
„Guten Tag, Herr Oppenheimer,“ sagte mit
ganz hohler Stimme der Tod, der saß auf einem
/
Eichenstuhl mit der hohen Lehne am Tisch und aß
eine von den Messinaapfelsinen. Das klapperte
immer so gräßlch, wenn der Tod I$aute. Der Kom-
merzienrat vergrub krampfhaft seine Nägel in das
Fleisch seiner kleinen dicken Hand, aber das blu-
tete und tat sehr weh. Nun häte er gern den Tod
gebeten, ihn allein zu lassen, aber jedesmal, wenn
er den Mund öffnete, gab es schon von seinem
Atem einen so lauten Ton, daß er sich vor seiner
Stimme fürchtete.
Der Kommerzienrat gab sich einen Ruck, und
wie er sich den Ruck gegeben hatte, trat seine
verstorbene Frau aus der Gardine und setzte sich
auf den Lehnstuhl ihm gegenüber. Und neben ihr
stand der Architekt Gottiieb Krause, der dem
Kommerzienrat das neue Haus erbaut hatte, der
beugte sich plötzlich über seine Frau und küßte
sie. Und da der Spiegel hinter ihnen hing, sah
der Kommerzienrat das Bild doppelt, seine Frau
von hinten und den Architekten von der Seite im
Profil, und das wiederholte sich unzählige Male,
weil auch hinter dem Stuhle, auf dem der Kom-
merzienrat saß, ein Spiegel war. Darüber mußte
der Kommerzienrat lachen, hielt aber gleich inne,
schon das bloße Verziehen des Gesichtes hallte im
Saale wieder, so daß er sich entsetzt umsah.
Der Tod saß noch immer am Tisch und schälte
sich eben die dritte Apfelsine. Das war merk-
würdig, weil doch nur zwei in der Schale gelegen
hatten.
Der Kommerzienrat wandte schnell den Kopf
zu der dem Fenster entgegengesetzten Seite des
Zimmers, um den Tod nicht zu sehen und auch
nicht seine verstorbene Frau iind den Architek-
ten: da standen in der Ecke des Zimmers sechs
Maurer, die auf seinen Bau mitgearbeitet hatten,
auf dem Verdeck des Neptun, alle in Matrosen-
anzügen, und der Kapitän sagte zu ihnen: Chris-
tian Oppenheimer ist auch seekrank, daß diese
Landratten doch nichts vertragen.
Der Kommerzienrat hielt den Kopf ange-
strengt nach der Seite, wo der Kapitän und die
Maurer standen, obwohl es ihn schmerzte. Auch
noch, als der Tod aufsprang und die Arme auf das
Becken gestemmt sagte: Nu, Herr Kommerzien-
rat Jakob Oppenheimer, nehme ich mich nicht
gut aus in dem großen, leeren, ganz dunklen Zim-
mer? — So wollte der Koimnerzienrat sitzen
bleiben, bis der Diener Licht gemacht hätte.
Gott sei Dank, der kam jetzt. Aber wie? Er
nahm nur die Apfelsinenschalen, ging damit zum
Kommerzienrat und kitzelte ihn immerfort an der
Becke, der Kommerzienrat mußte an die Backe
fassen, plötzlich, die war ganz kalt. Und seine
Hände? Die waren auch ganz kalt. Und er war
steif und konnte nur noch die rechte Hand be-
wegen. Mit der faßte er unwillkürlich nach dem
Herzen. Das hatte aufgehört zu schlagen, er
war also tot. Und der Kommerzienrat erschrak
heftig und konnte vor Schreck auch die rechte
Hand nicht mehr bewegen.
Als der Diener Licht machen wollte, fand er
den Kommerzienrat, den Kopf angestrengt nach
der dem Fenster entgegengesetzten Seite des
Ziinmers verdreht, die Rechte auf dem Herzen,
die Linke hing starr herunter. Auf dem Boden
lagen die Schalen der drei Apfelsinen, die der Tod
gegessen hatte.
Zur Erinnerung an den jungen Autor, den eine schwere
Krankheit tötete. Widrige äussere Lebensverhältnisse hin-
derten ihn an der Entfaltung seiner starken Begabung.
701
namen Ihren jungen Verbrecher. Sie haben sich
nun maJ in ihn vergafft: der Himmel mag wissen,
wanim, da er doch häßlich und gemein ist . . .“
„Auf sein Aeußeres habe ich ganz und gar
keine Rücksicht genommen,“ erklärte Klerker.
„Qut!“ Der Leutnant fuhr ärgerlich von der
Bank auf. „Qut! Dann müssen Sie eben selber
die Folgen auf sich nehmen. Die werden sich viei-
leicht eher einstellen, ais Sie glauben . . .“
Ais Klerker eine Stunde später sein Eß-
zimmer betrat, saß Jan Eriksen an dem Tisch, der
rekdhlich mit Speisen und Getränken besetzt war.
Bei Klerkers Eintritt stand er nicht einmal auf,
aber sein Gesicht nahrn plötzlich einen festen, re-
soluten Ausdruck an, und er warf seinem Wirt
aus seinen kieinen, wässerigen und verrückten
Augen einen haßerfüllten, gierigen Blick zu. Vor
Ihm stand Klerkers Tafelaquavit.
Zwei Tage darauf betrat Klerker das Eß-
zimmer des Schwagers, wo die Familie am Mit-
tegstisch saß. Er nahin Platz auf dem Stuh], den
Therese fiir ihn zurechtschob, und strich sich über
dle Stirn.
Mühsam lächelnd sagte er: „Nun hat er mich
hinausgeworfen.“
Die ganze Familie erhob sich von den Stühlen
und stand da mit weitaufgerissenen Augen und
bleich wie das Tischtuch. Man hörte keinen Laut.
Die ganze Familie, die sozusagen im Schutze des
wohilhabenden und freundlichen Onkels lebte, war
wie gelähmt; sie fühlte sich in ihrer Wohifahrt
bedroht; dieser Donnerschlag, der schon lange
genug gedroht hatte und nun plötzlich erfolgt war,
hatte sie erschreckt und betäubt.
,Ja,“ fuhr Klerker fort. „Er hat in zwei
Tagen vier Flaschen von meinem Tafelaquavit aus-
gterunken. Als ich heute zu Tisch gehen wollte,
sai er bereits da. Therese ist ja in den letzten
Tagen nicht bei mir gewesen; er hatte sich alles
seiber besorgt. Also: kaum war 'ich eingetreten,
ia stand er auf und rief mit lauter, erbitterter
Stiinme: Hinaus! Aus meinem Hause!“
Klerker duckte sich und dachte mit Bewunde-
rung an jenen Augenblick, da der blonde Hiine, in
einem von seinem Wirt entlehnten Anzug, der ihm
an den Handgliedern und Fußknöcheln zu kurz war,
aufgedunsen von Trunk und von Wut, von Kler-
kers Platz am Tische aufgesprungen war, in der
firchterlichen rechten Faust eine Flasche schwang,
»nd ihm zugebrüllt hatte, daß Klerker zur Höße
fahren möge. Klerker war sofort aus dem Zimmer
gegangen. Er war noch immer bleich und ver-
ängstigt, aber nicht zornig.
„Nein, warum soll ich zornig werden? Ich
weiß recht gut, daß die ineisten Zeitgenossen zor-
nig werden, wenn man dem, was sie für ihre
Rechte halten, zu nahe tritt; dann werden sie wild
und schreien: darüber verfüge ich und nicht du.
Aber ich finde ein solches Auftreten unwürdig, ja
unpassend — wenigstens fiir mich.“ Klerker trock-
nete seine Stirn mit der Serviette.
Klerkers Schwager war kein besonders muti-
ger Mann, aber er nahm sich doch so weit zu-
sammen, daß er sich der Vitla näherte und konsta-
tierte, daß sämtliche Eingänge verschlossen und
verbarrikadiert seien. Und er hörte, wie Jan Erik-
sen im Hause tobte und Gegenstände in Stücke
schlug.
Der Schwager sandte sofort einen Boten zum
Polizeiieutnant, und dieser kam in das Zimmer, wo
Klerker saß. „Was habe ich gesagt!“ rief er. „Da
sehen Sie’s! Er hat Sie aus Ihrem eigenen Hause
hinausgeworfen.“
Klerker warf ihm einen verschleierten, aber
unerschütterlichen Blick zu: „Ich habe keine An-
zeige gemacht.“
Fortsetzung folgt
Der reiche Bankier
Oppenheimer
Von Siegmund Kaliseher f
Am sechzehnten März achtzehnhundertzwei-
undneunzig fehlte dem Bankier Iakob Oppenheimer
noch eine Mark zur Million, in der Frühe des
siebenzehnten war er Millionär.
Wie er es seinen Freunden vorausgesagt
hatte, bezog er an diesem für ihn denkwürdigen
Tage zwar sein neues Heim mit den großen saal-
artigen Zimmern, schickte aber seinen einzigen
Sohn Christian auf die Reise
Die Mutter dieses Sohnes hatte der Komrner-
zienrat Oppenheimer ihres Geldes wegen geheira-
tet. Sie war vielleicht eine blonde Frau mit zarter
Haut und blassen Lippen und Augen, vielleicht sah
sie auch anders aus, jedenfails tötete sie die Ge-
burt dieses Sohnes, den der Kommerzienrat am
siebzehnten März 1892 auf Reisen schickte.
Am Nachmittag saß der Kommerzienrat allein
im Eßzimmer. Das war im altdeutschen Stii ge-
halten und sehr groß. Der Kommerzienrat aber
war kiein und dick und saß auf einem großen Lehn-
stuhl in der Ecke des Zimmers vor dem Fenster.
Er konnte die Zeitung nicht lesen. die er in seiner
Hand hate, denn es war ein zu merkwürdiges Ge-
fühl, in dem großen, weiten Saal gänz allein zu
sein und nur so einen verschwindend kleinen Teil
des Raumes auszumachen. Er rief einen Diener
und fragte nach der Zeit: seine Uhr wäre stehen
geblieben. Fünf Uhr. Aber danäch ging der
Diener wieder fort, und der Konnnerzienrat biieb
wieder allein. Um halb sechs sagte er ganz laut:
Ich werde einen Gang durcli ineine sämtlichen
Zimmer machen. Dann erschrak er, weil seine
Stimme so schallte. — Aber er stand nicht auf,
denn er dachte, vieileicht ist der Boden im näch-
sten Zimmer giatt, dann rutscht man aus und
bricht ein Bein, das wäre aber nicht passiert, wenn
man das Eßzinuner nicht verlassen hätte. Am
sichersten, seine Stellung garnicht ändern. Da
kann einem kein Ungltick zustoßen, das heißt, so
sicher ist das ja auch nicht, aber . . . hier verloren
sich die Gedanken des Kommerzienrats ins ver-
worrene.
Es dunkelte schon. Das sah der Kommerzien-
rat plötzlich mit einer gewissen Beklemmung, als
er vom Fenster hinweg ins Zirnmer blickte. Dann
mußte er über seine Angst lächeln: Es wurde doch
jeden Tag dunkei, wenn man sich da irnrner äng-
stigen sollte.
Aber da war ja ein Mensch im Zimmer. Herr
Gott im Himmel, ihm gegeniiber, mit blaßgeiber
Gesichtsfarbe, die Tür lag doch am andern Ende
des Zimmers, da hätte er ihn doch hindurch gehen
sehen müssen. Der saß nun auf dem Lehnstuhl
und sah den Kommerzienrat an, er hatte aueh eine
goldene Brille auf, wie der Kommerzienrat, und
die Arme waren ihm heruntergesunken, ganz wie
dem Kommerzienrat, und er hatte auch in der Hand
eine Zeitung — natürlich, das war der Spiegel da
drüben. Aber nein, das Siegelbild hatte die Zei-
tung in der Linken und er — Gott, das war ja
richtig, war er denn kindisch geworden?
Der Diener könnte jetzt eigentlich das Licht
anzünden, es war doch schon dunkel. Der Kom-
merzienrat hätte nach ihm geiäutet, aber dann
hätte er erst durch den großen Saal gehen müssen.
Dazu saß er zu bequem, ja dazu saß er viel zu be-
quem. Aber angenehmer wäre es gewesen, wenn
der Saal heil gewesen wäre. Der wurde statt
dessen imrner dunkler und größer, und der Kom-
merzienrat wurde immer kleiner. Der Saal war
jetzt schon so groß wie die ganze Welt, und der
Kommerzienrat war auf der ganzen dunklen Welt
allein.
„Guten Tag, Herr Oppenheimer,“ sagte mit
ganz hohler Stimme der Tod, der saß auf einem
/
Eichenstuhl mit der hohen Lehne am Tisch und aß
eine von den Messinaapfelsinen. Das klapperte
immer so gräßlch, wenn der Tod I$aute. Der Kom-
merzienrat vergrub krampfhaft seine Nägel in das
Fleisch seiner kleinen dicken Hand, aber das blu-
tete und tat sehr weh. Nun häte er gern den Tod
gebeten, ihn allein zu lassen, aber jedesmal, wenn
er den Mund öffnete, gab es schon von seinem
Atem einen so lauten Ton, daß er sich vor seiner
Stimme fürchtete.
Der Kommerzienrat gab sich einen Ruck, und
wie er sich den Ruck gegeben hatte, trat seine
verstorbene Frau aus der Gardine und setzte sich
auf den Lehnstuhl ihm gegenüber. Und neben ihr
stand der Architekt Gottiieb Krause, der dem
Kommerzienrat das neue Haus erbaut hatte, der
beugte sich plötzlich über seine Frau und küßte
sie. Und da der Spiegel hinter ihnen hing, sah
der Kommerzienrat das Bild doppelt, seine Frau
von hinten und den Architekten von der Seite im
Profil, und das wiederholte sich unzählige Male,
weil auch hinter dem Stuhle, auf dem der Kom-
merzienrat saß, ein Spiegel war. Darüber mußte
der Kommerzienrat lachen, hielt aber gleich inne,
schon das bloße Verziehen des Gesichtes hallte im
Saale wieder, so daß er sich entsetzt umsah.
Der Tod saß noch immer am Tisch und schälte
sich eben die dritte Apfelsine. Das war merk-
würdig, weil doch nur zwei in der Schale gelegen
hatten.
Der Kommerzienrat wandte schnell den Kopf
zu der dem Fenster entgegengesetzten Seite des
Zimmers, um den Tod nicht zu sehen und auch
nicht seine verstorbene Frau iind den Architek-
ten: da standen in der Ecke des Zimmers sechs
Maurer, die auf seinen Bau mitgearbeitet hatten,
auf dem Verdeck des Neptun, alle in Matrosen-
anzügen, und der Kapitän sagte zu ihnen: Chris-
tian Oppenheimer ist auch seekrank, daß diese
Landratten doch nichts vertragen.
Der Kommerzienrat hielt den Kopf ange-
strengt nach der Seite, wo der Kapitän und die
Maurer standen, obwohl es ihn schmerzte. Auch
noch, als der Tod aufsprang und die Arme auf das
Becken gestemmt sagte: Nu, Herr Kommerzien-
rat Jakob Oppenheimer, nehme ich mich nicht
gut aus in dem großen, leeren, ganz dunklen Zim-
mer? — So wollte der Koimnerzienrat sitzen
bleiben, bis der Diener Licht gemacht hätte.
Gott sei Dank, der kam jetzt. Aber wie? Er
nahm nur die Apfelsinenschalen, ging damit zum
Kommerzienrat und kitzelte ihn immerfort an der
Becke, der Kommerzienrat mußte an die Backe
fassen, plötzlich, die war ganz kalt. Und seine
Hände? Die waren auch ganz kalt. Und er war
steif und konnte nur noch die rechte Hand be-
wegen. Mit der faßte er unwillkürlich nach dem
Herzen. Das hatte aufgehört zu schlagen, er
war also tot. Und der Kommerzienrat erschrak
heftig und konnte vor Schreck auch die rechte
Hand nicht mehr bewegen.
Als der Diener Licht machen wollte, fand er
den Kommerzienrat, den Kopf angestrengt nach
der dem Fenster entgegengesetzten Seite des
Ziinmers verdreht, die Rechte auf dem Herzen,
die Linke hing starr herunter. Auf dem Boden
lagen die Schalen der drei Apfelsinen, die der Tod
gegessen hatte.
Zur Erinnerung an den jungen Autor, den eine schwere
Krankheit tötete. Widrige äussere Lebensverhältnisse hin-
derten ihn an der Entfaltung seiner starken Begabung.
701