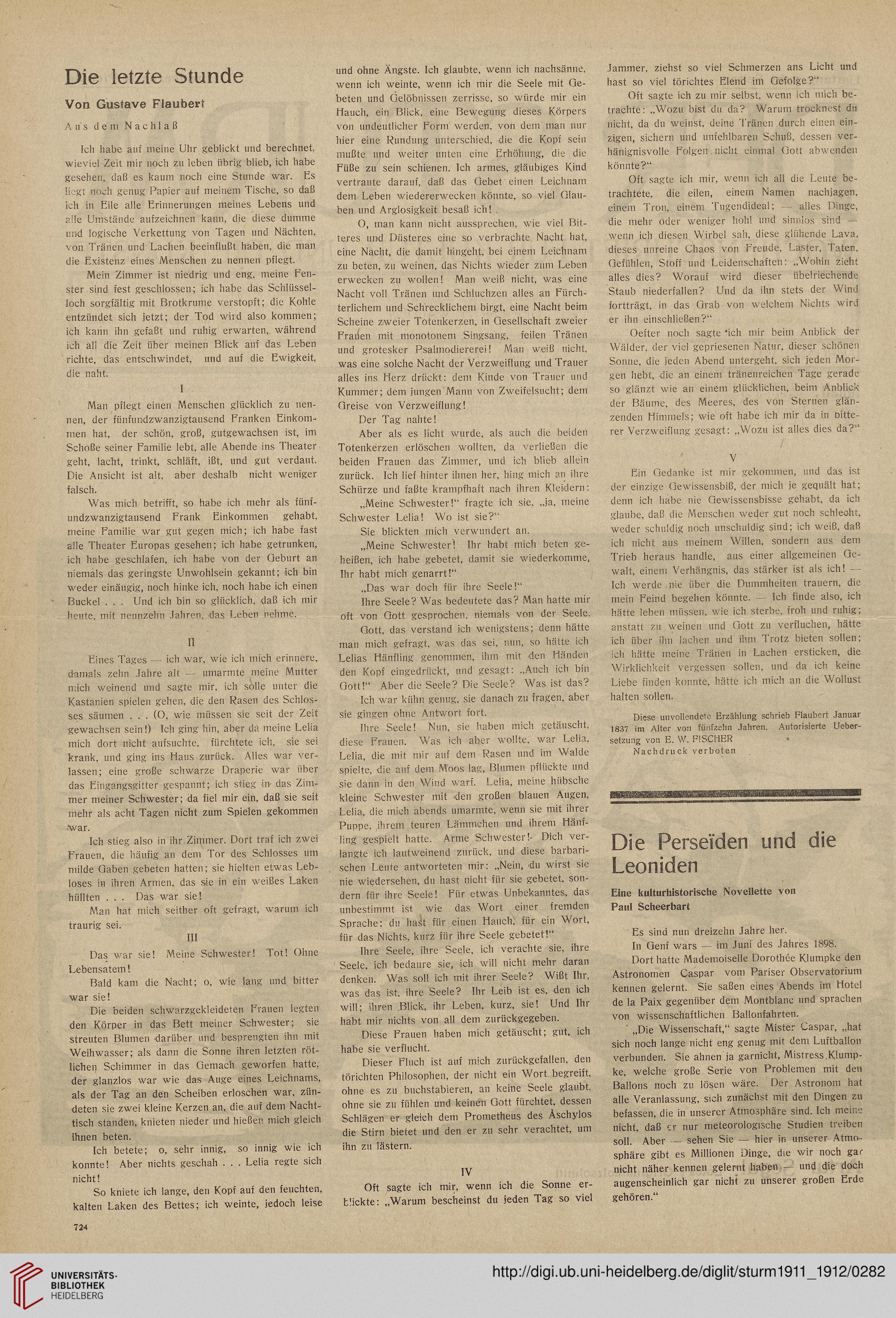Die letzte Stunde
Von Gustave Flaubert
Au's d e m N a c h 1 a ß
Ich habe auf meine Uhr geblickt und berechnet,
wieviel Zeit mir noch zu leben iibrig blieb, ich habe
gesehen, daß es kaum noch eine Stunde war. Es
iiegt noch genug Papier auf meinem Tische, so daß
ich in Eile alle Erinnerungen meines Lebens und
alle Umstände aufzeichnen kann, die diese dumme
und logische Verkettung von Tagen und Nächten,
von Tränen und Lachen beeinflußt haben, die man
die Existenz eines Menschen zu nennen pflegt.
Mein Zimmer ist niedrig und eng. meine Een-
ster sind fest geschlossen; ich habe das Schliissel-
loch sorgfäitig mit Brotkrume verstopft; die Kohle
entziindet sich ietzt; der Tod wiid also kommen;
ich karin ihn gefaßt und ruhig erwarten, während
ich all die Zeit über meinen Blick auf das Leben
richte, das entschwindet, und aui die Ewigkeit,
die naht.
I
Man pflegt einen Menschen giücklich zu nen-
nen, der fünfundzwanzigtausend Franken Einkom-
inen hat, der schön, groß, gutgewachsen ist, im
Schoße seiner Familie lebt, alle Abende ins Theater
geht, lacht, trinkt, schläft, ißt, und gut verdaut.
Die Ansicht ist alt, aber deshalb nicht weniger
falsch.
Was mich betrifft, so habe ich mehr als füni-
undzwanzigtausend Frank Einkomnien gehabt.
meine Familie war gut gegen mich; ich habe fast
alle Theater Europas gesehen; ich habe getrunken,
ich habe geschlafen, ich habe von der Qeburt an
niemals das geringste Unwohisein gekannt; ich bin
weder einäugig, noch hinke ich, noch habe ich einen
Buckel . . . Und ich bin so gliicklich, daß ich mir
heute, mit neunzehn Jahren, das Leben nehme.
II
Eines Tages — ich war, wie ich mich erinnere,
d-amals zehn Jahre alt — umarmte meine Mutter
mich weinend und sagte mir, ich solle unter die
Kastanien spielen gehen, die den Rasen des Schlos-
ses säumen ... (0, wie müssen sje seit der Zeit
gewachsen sein!) Ich ging hin, aber da meine Lelia
mich dort nicht aufsuchte, fiirchtete ich, sie sei
krank, und ging ins Haus zurück. Alles war ver-
lassen; eine große schwarze Draperie war iiber
das Eingangsgitter gespannt; ich stieg iiv das Zim-
mer meiner Schwester; da fiel mir ein, daß sie seit
mehr als acht Tagen nicht zum Spielen gekommen
“war.
Ich stieg also in ihr Zimmer. Dort traf ich zwei
Frauen, die häufig an dem Tor des Schlosses um
milde Qaben gebeten hatten; sie hielten etwas Leb-
loses in ihren Armen, das sie in ein weißes Laken
hüllten . . . Das war sie!
Man hat rnich seither oft gefragt, warum ich
traurig sei.
III
Das war sie! Meine Schwester! Tot! Ohne
Lebcnsatetn!
Bald kam die Nacht; o, wie lang und bitter
war sie!
Die beiden schwarzgekleideten Frauen legten
den Körper in das Bett meiner Schwester; sie
streuten Blumen darüber und besprengten ihn mit
Weihwasser; als dann die Sonne ihren letzten röt-
lichen Schimmer in das Geniach geworfen hatte.
der glanzlos war wie das Auge eines Leichnams,
als der Tag an den Scheiben erloschen war, zün-
deten sie zwei kleine Kerzen an, die auf deni Nacht-
tisch standen, knieten nieder und hießen mich gleich
ihnen beten.
Ich betete; o, sehr innig, so innig wie ich
konnte! Aber nichts geschah . . . Lelia regte sich
nicht!
So kniete ich lange, den Kopf auf den feuchten,
kalten Laken des Bettes; ich weinte, jedoch leise
und ohne Ängste. Ich glaubte, wenn ich nachsänne,
wenn ich weinte, wenn ich mir die Seele mit Qe-
beten und Gelöbnissen zerrisse, so würde mir ein
Hauch, ein Blick, eine Bewegung dieses Körpers
von undeutlicher Form werden, von deiti tnan nur
hier eine Rundung unterschied, die die Kopf sein
mußte und weiter unten eine Erhöhung, die die
Füße zu sein schienen. Ich armes, gläubiges Kind
vertraute darauf, daß das üebet einen Leichnam
dem Leben wiedererwecken könnte, so viel Glau-
ben und Arglosigkeit besaß ich!
O, man kann nicht aussprechen, wie viel Bit-
teres und Diisteres eine so verbrachte Nacht hat,
eine Nacht, die daniit hingeht, bei einem Leichnam
zu beten, zu weinen, das Nichts wieder zum Leben
erwecken zu wollen! Man weiß nicht, was eine
Nacht voll Tränen und Schluchzen alles an Fürch-
terlichem und Schrecklichem birgt, eine Nacht beim
Scheine zweier Totenkerzen, in Qesellschaft zweier
Fraiien mit monotonem Singsang, feilen Tränen
und grotesker Psahnodiererei! Man weiß nicht,
was eine solche Nacht der Verzweiflung und Trauer
alles ins Herz drückt: dem Kinde von Trauer und
Kummer; dem jungen'Mann von Zweifelsucht; dem
Qreise von Verzweiflung!
Der Tag nahte!
Aber als es licht wurde, als auch die beiden
Totenkerzen erlöschen wollten, da verließen die
beiden Frauen das Zimmer, und ich blieb allein
zurück. Ich lief hinter ihnen her, hing niich an ihre
Schürze und faßte krampfhaft nach ihren Kleidern:
„Meine Schwester!“ fragte ich sie, „ja, rneine
Schwester Lelia! Wo ist sie?“
S-ie blickten mich verwundert an.
„Meine Schwester! Ihr habt mich beten ge-
heißen, ich habe gebetet, damit sie wiederkomme,
Ihr habt mich genarrt!“
„Das war doch fiir ihre Seele!“
Ihre Seele? Was bedeutete das? Man hatte mir
oft von Qott gesprochen, niemals von der Seele.
Qott, das verstand ich wenigstens; denn hätte
man niich gefragt, was das sei, nun, so hätte ich
Lelias Hänfling genommen, ihm mit den Händen
den Kopf eingedriickt, und gesagt: „Auch ich bin
Qott!“ Aber die Seele? Die Seele? Was ist das?
Ich war kiihn genug, sie danach zu fragen, aber
sie gingen ohne Antwort fort.
Ihre Seele! Nun, sie liaben mich getäuscht.
diese Frauen. Wäs ich aber wollte, war Lelia,
Lelia, die mit tnir auf detn Rasen und im Walde
spielte, die auf dem Moos lag, Blumen pfliickte und
sie dann in den Wind warf. Lelia, meine hiibsche
kleine Schwester mit den großen blauen Augen,
Lelia, die mich abends umarmte, wenn sie mit ihrer
PuDpe. ihrein teuren Lämmchen und ihrern Hänf-
ling gespielt hatte. Arme SchwesteiT Dicli ver-
langte ich lautweinend zurück, und diese barbari-
schen Leute antworteten mir: „Nein, du wirst sie
nie wiedersehen, du hast nicht fiir sie gebetet, son-
dern fiir ihre Seele! Fiir etwas Unbekanntes, das
unbestirnmt ist wie das Wort einer fremden
Sprache: du hast fiir einen Hauch, fiir ein Wort,
fiir das Nichts, kurz fiir ihre Seele gebetet!“
Ihre Seele, ihre Seele, ich verachte sie, ihre
Seele, ich bedaure sie, ich will nicht mehr daran
denken. Was soll ich mit ihrer Seele? Wißt Ihr,
was das ist, ihre Seele? Ihr Leib ist es. den ich
will; iliren Blick, ihr Leben, kurz, sie! Und Ihr
habt mir nichts von all dem zuriickgegeben.
Diese Frauen haben mich getäuscht; gut, ich
habe sie verflucht.
Dieser Fluch ist auf mich zurückgefallen, den
törichten Philosöphen, der nicht ein Wort begreift,
ohne es zu buchstabieren, an keine Seele glaubt.
ohne sie zu fühlen und keinen Gott fürchtet, dessen
Schlägen er gleich dem Proinetheus des Aschylos
die Stirn bietet und den er zu sehr verachtet, um
ihn zu Iästern.
IV
Oft sagte ich mir, wenn ich die Sonne er-
thckte: „Warum bescheinst du jeden Tag so viel
Jammer, ziehst so viel Schmerzen ans Licht und
hast so viel törichtes Elend im Gefolge?“
Oft sagte ich zu mir selbst, wenn ich mich be-
trachte: „Wozu bist du da? Warurn trocknest du
nicht, da du weinst, deind Tränen durch einen eitt-
zigett, sichern und unfehlbaren Schuß, dessen ver-
hänignisvolle Folgen.nicht einmal Qott abwenden
könnte?“
Oft sagte ich tnir, wenn ich ali die Leute be-
trachtete, die eilen, einetn Namen nachjagen,
einetn Tron, einem Tugendideal; alles Dinge,
die rnehr öder weniger hohl und sinnlos sind —
wenn ich diesen Wirbel sah, diese glühende Lava,
dieses unreine Chaos von Freude, Laster, Taten.
Qeftihlen, Stoff und Leidenschaften: „Wohin zieht
alles dies? Worauf wird dieser iibelriechende
Staub niederfallen? Und da ihn stets der Wind
fortträgt, in das Qrab von welchem Nichts wird
er ihn einschließen?“
Oefter noch sagte ‘ich liiir beinr Anblick der
Walder, der viel gepriesenen Natur, dieser schönen
Sonne, die jeden Abend untergeht, sich jeden Mor-
gen hebt, die an einem tränenreichen Tage gerade
so glänzt wie an einem glücklichen, beim Anblick
der Bäurne, des Meeres, des von Sternen glän-
zenden Himmels; wie oft habe ich mir da in oitte-
rer Verzweiflting gesagt: „Wozu ist alles dies da?“
V
Ein Qedanke ist mir gekommen, und das ist
der einzige Qewissertsbiß, der mich je gequält hat;
denn ich habe nie Gewissensbisse gehabt, da ich
glaube, daß die Menschen weder gut noch schleoht.
weder schuldig noch unschuldig sind; ich weiß, daß
ich nicht aus meinern Willen, sondern aus dem
Trieb heraus handle, aus einer allgetneinen Qe-
walt, einem Verhängnis, das stärker ist als ich! —
Ich werde nie über die Dummheiten trauern, die
mein Feind begehen könnte. — Ich finde also, ich
hätte leben müssen, wie ich sterbe, froh und ruhig;
anstatt zu weitten und Qott zu verfluchen, hätte
ich iiber ihn lachen und ihm Trotz bieten sollen;
ich hätte meine Tränett in Lachen ersticken, die
Wirklichkeit vergessen sollen, und da ich keine
Liebe finden konnte, hätte ich mich an die Wollust
halten sollen.
Diese unvollendete Erzählung schrieb Flaubert Januar
1837 im Alter von fiinfzehn Jahren. Autorisierte Ueber-
setzung von E. W. FISCHER «
Nachdruck verboten
Die Perseiden und die
Leoniden
Eine kulturhistorische Novellette von
Paul Scheerbart
Es sind nttn dreizehn Jahre her.
In Qenf wars — im Juni des Jahres 1898.
Dort hatte Mademoiselle Dorothee Klumpke den
Astronomen Caspar vom Pariser Observatorium
kennen gelernt. Sie saßen eines Abends im Hotel
de la Paix gegeniiber dem Montblanc ttnd sprachen
von wissenschaftlichen Ballonfahrten.
' „Die Wissenschaft,“ sagte Mister Caspar, „hat
sich noch lange nicht eng genug mit dem Luftballon
verbunden. Sie ahnen ja garnicht, Mistress.Klump-
ke, welche große Serie von Probletnen niit den
Ballons noclt zu lösen wäre. Der Astronom hat
alle Veranlassung, sich zunächst mit den Dingen zu
befassen, die itt unserer Atmosphäre sind. Ich meirie
nicht, daß er nur meteorologische Studien treiben
soll. Aber — sehen Sie — hier in unserer Atmo-
sphäre gibt es Millioneti Dinge, die wir noch gar
nicht näher kennen gelernt haben - und die doch
augenscheinlich gar nicht zu unserer großen Erde
gehören.“
724
Von Gustave Flaubert
Au's d e m N a c h 1 a ß
Ich habe auf meine Uhr geblickt und berechnet,
wieviel Zeit mir noch zu leben iibrig blieb, ich habe
gesehen, daß es kaum noch eine Stunde war. Es
iiegt noch genug Papier auf meinem Tische, so daß
ich in Eile alle Erinnerungen meines Lebens und
alle Umstände aufzeichnen kann, die diese dumme
und logische Verkettung von Tagen und Nächten,
von Tränen und Lachen beeinflußt haben, die man
die Existenz eines Menschen zu nennen pflegt.
Mein Zimmer ist niedrig und eng. meine Een-
ster sind fest geschlossen; ich habe das Schliissel-
loch sorgfäitig mit Brotkrume verstopft; die Kohle
entziindet sich ietzt; der Tod wiid also kommen;
ich karin ihn gefaßt und ruhig erwarten, während
ich all die Zeit über meinen Blick auf das Leben
richte, das entschwindet, und aui die Ewigkeit,
die naht.
I
Man pflegt einen Menschen giücklich zu nen-
nen, der fünfundzwanzigtausend Franken Einkom-
inen hat, der schön, groß, gutgewachsen ist, im
Schoße seiner Familie lebt, alle Abende ins Theater
geht, lacht, trinkt, schläft, ißt, und gut verdaut.
Die Ansicht ist alt, aber deshalb nicht weniger
falsch.
Was mich betrifft, so habe ich mehr als füni-
undzwanzigtausend Frank Einkomnien gehabt.
meine Familie war gut gegen mich; ich habe fast
alle Theater Europas gesehen; ich habe getrunken,
ich habe geschlafen, ich habe von der Qeburt an
niemals das geringste Unwohisein gekannt; ich bin
weder einäugig, noch hinke ich, noch habe ich einen
Buckel . . . Und ich bin so gliicklich, daß ich mir
heute, mit neunzehn Jahren, das Leben nehme.
II
Eines Tages — ich war, wie ich mich erinnere,
d-amals zehn Jahre alt — umarmte meine Mutter
mich weinend und sagte mir, ich solle unter die
Kastanien spielen gehen, die den Rasen des Schlos-
ses säumen ... (0, wie müssen sje seit der Zeit
gewachsen sein!) Ich ging hin, aber da meine Lelia
mich dort nicht aufsuchte, fiirchtete ich, sie sei
krank, und ging ins Haus zurück. Alles war ver-
lassen; eine große schwarze Draperie war iiber
das Eingangsgitter gespannt; ich stieg iiv das Zim-
mer meiner Schwester; da fiel mir ein, daß sie seit
mehr als acht Tagen nicht zum Spielen gekommen
“war.
Ich stieg also in ihr Zimmer. Dort traf ich zwei
Frauen, die häufig an dem Tor des Schlosses um
milde Qaben gebeten hatten; sie hielten etwas Leb-
loses in ihren Armen, das sie in ein weißes Laken
hüllten . . . Das war sie!
Man hat rnich seither oft gefragt, warum ich
traurig sei.
III
Das war sie! Meine Schwester! Tot! Ohne
Lebcnsatetn!
Bald kam die Nacht; o, wie lang und bitter
war sie!
Die beiden schwarzgekleideten Frauen legten
den Körper in das Bett meiner Schwester; sie
streuten Blumen darüber und besprengten ihn mit
Weihwasser; als dann die Sonne ihren letzten röt-
lichen Schimmer in das Geniach geworfen hatte.
der glanzlos war wie das Auge eines Leichnams,
als der Tag an den Scheiben erloschen war, zün-
deten sie zwei kleine Kerzen an, die auf deni Nacht-
tisch standen, knieten nieder und hießen mich gleich
ihnen beten.
Ich betete; o, sehr innig, so innig wie ich
konnte! Aber nichts geschah . . . Lelia regte sich
nicht!
So kniete ich lange, den Kopf auf den feuchten,
kalten Laken des Bettes; ich weinte, jedoch leise
und ohne Ängste. Ich glaubte, wenn ich nachsänne,
wenn ich weinte, wenn ich mir die Seele mit Qe-
beten und Gelöbnissen zerrisse, so würde mir ein
Hauch, ein Blick, eine Bewegung dieses Körpers
von undeutlicher Form werden, von deiti tnan nur
hier eine Rundung unterschied, die die Kopf sein
mußte und weiter unten eine Erhöhung, die die
Füße zu sein schienen. Ich armes, gläubiges Kind
vertraute darauf, daß das üebet einen Leichnam
dem Leben wiedererwecken könnte, so viel Glau-
ben und Arglosigkeit besaß ich!
O, man kann nicht aussprechen, wie viel Bit-
teres und Diisteres eine so verbrachte Nacht hat,
eine Nacht, die daniit hingeht, bei einem Leichnam
zu beten, zu weinen, das Nichts wieder zum Leben
erwecken zu wollen! Man weiß nicht, was eine
Nacht voll Tränen und Schluchzen alles an Fürch-
terlichem und Schrecklichem birgt, eine Nacht beim
Scheine zweier Totenkerzen, in Qesellschaft zweier
Fraiien mit monotonem Singsang, feilen Tränen
und grotesker Psahnodiererei! Man weiß nicht,
was eine solche Nacht der Verzweiflung und Trauer
alles ins Herz drückt: dem Kinde von Trauer und
Kummer; dem jungen'Mann von Zweifelsucht; dem
Qreise von Verzweiflung!
Der Tag nahte!
Aber als es licht wurde, als auch die beiden
Totenkerzen erlöschen wollten, da verließen die
beiden Frauen das Zimmer, und ich blieb allein
zurück. Ich lief hinter ihnen her, hing niich an ihre
Schürze und faßte krampfhaft nach ihren Kleidern:
„Meine Schwester!“ fragte ich sie, „ja, rneine
Schwester Lelia! Wo ist sie?“
S-ie blickten mich verwundert an.
„Meine Schwester! Ihr habt mich beten ge-
heißen, ich habe gebetet, damit sie wiederkomme,
Ihr habt mich genarrt!“
„Das war doch fiir ihre Seele!“
Ihre Seele? Was bedeutete das? Man hatte mir
oft von Qott gesprochen, niemals von der Seele.
Qott, das verstand ich wenigstens; denn hätte
man niich gefragt, was das sei, nun, so hätte ich
Lelias Hänfling genommen, ihm mit den Händen
den Kopf eingedriickt, und gesagt: „Auch ich bin
Qott!“ Aber die Seele? Die Seele? Was ist das?
Ich war kiihn genug, sie danach zu fragen, aber
sie gingen ohne Antwort fort.
Ihre Seele! Nun, sie liaben mich getäuscht.
diese Frauen. Wäs ich aber wollte, war Lelia,
Lelia, die mit tnir auf detn Rasen und im Walde
spielte, die auf dem Moos lag, Blumen pfliickte und
sie dann in den Wind warf. Lelia, meine hiibsche
kleine Schwester mit den großen blauen Augen,
Lelia, die mich abends umarmte, wenn sie mit ihrer
PuDpe. ihrein teuren Lämmchen und ihrern Hänf-
ling gespielt hatte. Arme SchwesteiT Dicli ver-
langte ich lautweinend zurück, und diese barbari-
schen Leute antworteten mir: „Nein, du wirst sie
nie wiedersehen, du hast nicht fiir sie gebetet, son-
dern fiir ihre Seele! Fiir etwas Unbekanntes, das
unbestirnmt ist wie das Wort einer fremden
Sprache: du hast fiir einen Hauch, fiir ein Wort,
fiir das Nichts, kurz fiir ihre Seele gebetet!“
Ihre Seele, ihre Seele, ich verachte sie, ihre
Seele, ich bedaure sie, ich will nicht mehr daran
denken. Was soll ich mit ihrer Seele? Wißt Ihr,
was das ist, ihre Seele? Ihr Leib ist es. den ich
will; iliren Blick, ihr Leben, kurz, sie! Und Ihr
habt mir nichts von all dem zuriickgegeben.
Diese Frauen haben mich getäuscht; gut, ich
habe sie verflucht.
Dieser Fluch ist auf mich zurückgefallen, den
törichten Philosöphen, der nicht ein Wort begreift,
ohne es zu buchstabieren, an keine Seele glaubt.
ohne sie zu fühlen und keinen Gott fürchtet, dessen
Schlägen er gleich dem Proinetheus des Aschylos
die Stirn bietet und den er zu sehr verachtet, um
ihn zu Iästern.
IV
Oft sagte ich mir, wenn ich die Sonne er-
thckte: „Warum bescheinst du jeden Tag so viel
Jammer, ziehst so viel Schmerzen ans Licht und
hast so viel törichtes Elend im Gefolge?“
Oft sagte ich zu mir selbst, wenn ich mich be-
trachte: „Wozu bist du da? Warurn trocknest du
nicht, da du weinst, deind Tränen durch einen eitt-
zigett, sichern und unfehlbaren Schuß, dessen ver-
hänignisvolle Folgen.nicht einmal Qott abwenden
könnte?“
Oft sagte ich tnir, wenn ich ali die Leute be-
trachtete, die eilen, einetn Namen nachjagen,
einetn Tron, einem Tugendideal; alles Dinge,
die rnehr öder weniger hohl und sinnlos sind —
wenn ich diesen Wirbel sah, diese glühende Lava,
dieses unreine Chaos von Freude, Laster, Taten.
Qeftihlen, Stoff und Leidenschaften: „Wohin zieht
alles dies? Worauf wird dieser iibelriechende
Staub niederfallen? Und da ihn stets der Wind
fortträgt, in das Qrab von welchem Nichts wird
er ihn einschließen?“
Oefter noch sagte ‘ich liiir beinr Anblick der
Walder, der viel gepriesenen Natur, dieser schönen
Sonne, die jeden Abend untergeht, sich jeden Mor-
gen hebt, die an einem tränenreichen Tage gerade
so glänzt wie an einem glücklichen, beim Anblick
der Bäurne, des Meeres, des von Sternen glän-
zenden Himmels; wie oft habe ich mir da in oitte-
rer Verzweiflting gesagt: „Wozu ist alles dies da?“
V
Ein Qedanke ist mir gekommen, und das ist
der einzige Qewissertsbiß, der mich je gequält hat;
denn ich habe nie Gewissensbisse gehabt, da ich
glaube, daß die Menschen weder gut noch schleoht.
weder schuldig noch unschuldig sind; ich weiß, daß
ich nicht aus meinern Willen, sondern aus dem
Trieb heraus handle, aus einer allgetneinen Qe-
walt, einem Verhängnis, das stärker ist als ich! —
Ich werde nie über die Dummheiten trauern, die
mein Feind begehen könnte. — Ich finde also, ich
hätte leben müssen, wie ich sterbe, froh und ruhig;
anstatt zu weitten und Qott zu verfluchen, hätte
ich iiber ihn lachen und ihm Trotz bieten sollen;
ich hätte meine Tränett in Lachen ersticken, die
Wirklichkeit vergessen sollen, und da ich keine
Liebe finden konnte, hätte ich mich an die Wollust
halten sollen.
Diese unvollendete Erzählung schrieb Flaubert Januar
1837 im Alter von fiinfzehn Jahren. Autorisierte Ueber-
setzung von E. W. FISCHER «
Nachdruck verboten
Die Perseiden und die
Leoniden
Eine kulturhistorische Novellette von
Paul Scheerbart
Es sind nttn dreizehn Jahre her.
In Qenf wars — im Juni des Jahres 1898.
Dort hatte Mademoiselle Dorothee Klumpke den
Astronomen Caspar vom Pariser Observatorium
kennen gelernt. Sie saßen eines Abends im Hotel
de la Paix gegeniiber dem Montblanc ttnd sprachen
von wissenschaftlichen Ballonfahrten.
' „Die Wissenschaft,“ sagte Mister Caspar, „hat
sich noch lange nicht eng genug mit dem Luftballon
verbunden. Sie ahnen ja garnicht, Mistress.Klump-
ke, welche große Serie von Probletnen niit den
Ballons noclt zu lösen wäre. Der Astronom hat
alle Veranlassung, sich zunächst mit den Dingen zu
befassen, die itt unserer Atmosphäre sind. Ich meirie
nicht, daß er nur meteorologische Studien treiben
soll. Aber — sehen Sie — hier in unserer Atmo-
sphäre gibt es Millioneti Dinge, die wir noch gar
nicht näher kennen gelernt haben - und die doch
augenscheinlich gar nicht zu unserer großen Erde
gehören.“
724