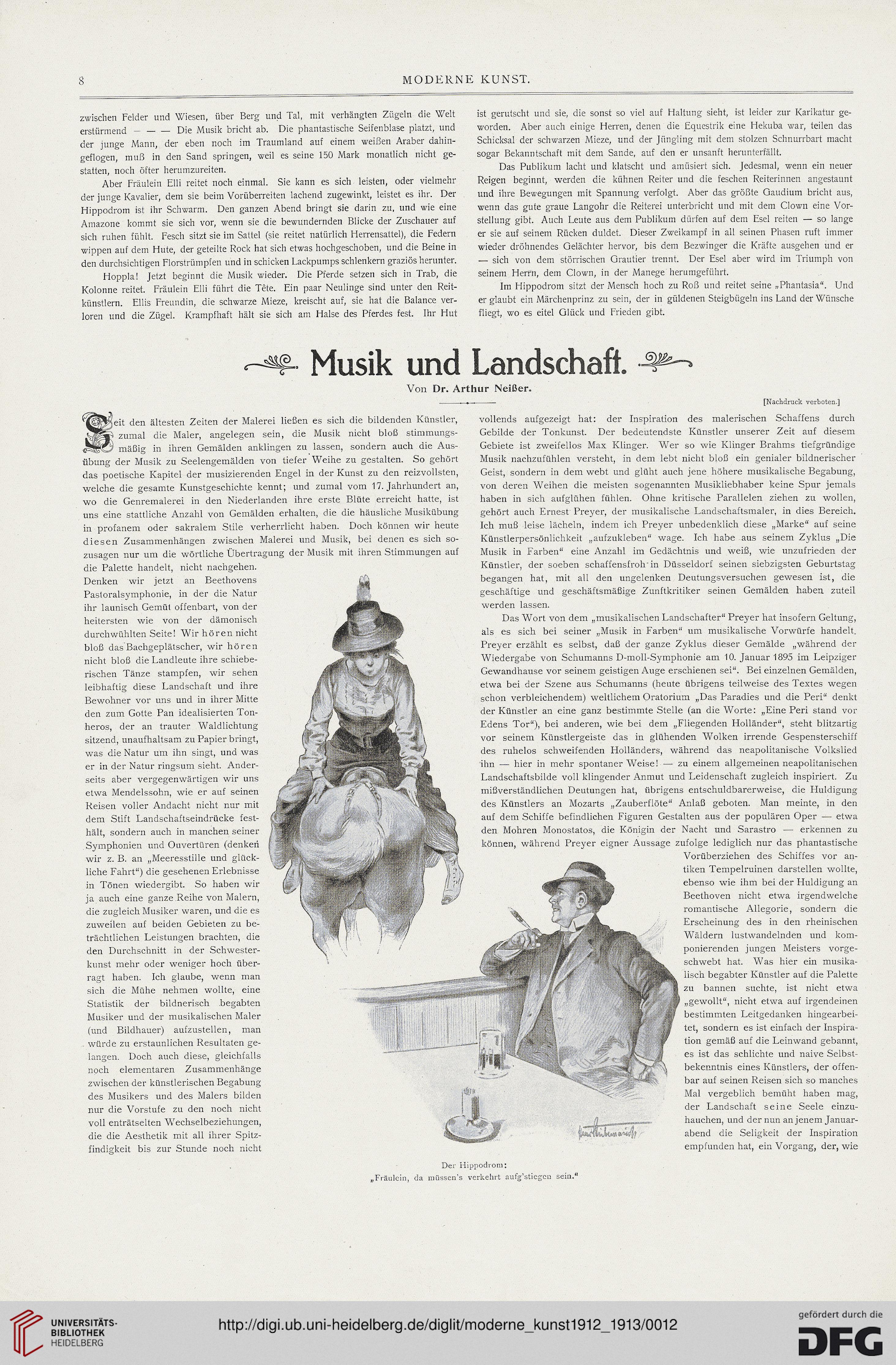8
MODERNE KUNST.
zwischen Felder und Wiesen, über Berg und Tal, mit verhängten Zügeln die Welt
erstürmend —-Die Musik bricht ab. Die phantastische Seifenblase piatzt, und
der junge Mann, der eben noch im Traumland auf einem weißen Araber dahin-
geflogen, muß in den Sand springen, weil es seine 150 Mark monatlich nicht ge-
statten, noch öfter herumzureiten.
Aber Fräulein Elli reitet noch einmal. Sie kann es sich leisten, oder vielmehr
der junge Kavalier, dem sie beim Vorüberreiten lachend zugewinkt, leistet es ihr. Der
Hippodrom ist ihr Schwarm. Den ganzen Abend bringt sie darin zu, und wie eine
Amazone kommt sie sich vor, wenn sie die bewundernden Blicke der Zuschauer auf
sich ruhen fühlt. Fesch sitzt sie im Sattel (sie reitet natürlich Herrensattel), die Federn
wippen auf dem Hute, der geteilte Rock hat sich etwas hochgeschoben, und die Beine in
den durchsichtigen Florstrümpfen und in schicken Lackpumps schlenkern graziös herunter.
Hoppla! jetzt beginnt die Musik wieder. Die Pferde setzen sich in Trab, die
Kolonne reitet. Fräulein Elli führt die Tete. Ein paar Neulinge sind unter den Reit-
künstlern. Ellis Freundin, die schwarze Mieze, kreischt auf, sie hat die Balance ver-
loren und die Zügel. Krampfhaft hält sie sich am Halse des Pferdes fest. Ihr Hut
ist gerutscht und sie, die sonst so viel auf Haltung sieht, ist leider zur Karikatur ge-
worden. Aber auch einige Herren, denen die Equestrik eine Hekuba war, teilen das
Schicksal der schwarzen Mieze, und der Jiingling mit dem stolzen Schnurrbart macht
sogar Bekanntschaft mit dem Sande, auf den er unsanft herunterfällt.
Das Publikum lacht und klatscht und amüsiert sich. Jedesmal, wenn ein neuer
Reigen beginnt, werden die kühnen Reiter und die feschen Reiterinnen angestaunt
und ihre Bewegungen mit Spannung verfolgt. Aber das größte Oaudium bricht aus,
wenn das gute graue Langohr die Reiterei unterbricht und mit dem Clown eine Vor-
stellung gibt. Auch Leute aus dem Publikum dürfen auf dem Esel reiten — so lange
er sie auf seinem Rücken duldet. Dieser Zweikampf in all seinen Phasen ruft immer
wieder dröhnendes Gelächter hervor, bis dem Bezwinger die Kräfte ausgehen und er
— sich von dem störrischen Grautier trennt. Der Esel aber wird im Triumph von
seinem Herrn, dem Clown, in der Manege herumgeführt.
Im Hippodrom sitzt der Mensch hoch zu Roß und reitet seine „Phantasia“. Und
er glaubt ein Märchenprinz zu sein, der in güldenen Steigbügeln ins Land der Wünsche
fliegt, wo es eitel Glück und Frieden gibt.
Musik und Landschaft.
Von Dr. Arthur Neißer.
den ältesten Zeiten der Malerei ließen es sich die bildenden Künstler,
AJp® zumal die Maler, angelegen sein, die Musik nicht bloß stimmungs-
mäßig in ihren Gemälden anklingen zu lassen, sondern auch die Aus-
übung der Musik zu Seelengemälden von tiefer Weihe zu gestalten. So gehört
das poetische Kapitel der musizierenden Engel in der Kunst zu den reizvollsten,
welche die gesamte Kunstgeschichte kennt; und zumal vom 17. Jahrhundert an,
wo die Genremalerei in den Niederlanden ihre erste Blüte erreicht hatte, ist
uns eine stattliche Anzahl von Gemälden erhalten, die die häusliche Musikübung
in profanem oder sakralem Stile verherrlicht haben. Doch können wir heute
diesen Zusammenhängen zwischen Malerei und Musik, bei denen es sich so-
zusagen nur um die wörtliche Übertragung der Musik mit ihren Stimmungen auf
die Palette handelt, nicht nachgehen.
Denken wir jetzt an Beethovens
Pastoralsymphonie, in der die Natur
ihr launisch Gemüt offenbart, von der
heitersten wie von der dämonisch
durchwühlten Seite! Wir hören nicht
bloß das Bachgeplätscher, wir hören
nicht bloß die Landleute ihre schiebe-
rischen Tänze stampfen, wir sehen
leibhaftig diese Landschaft und ihre
Bewohner vor uns und in ihrer Mitte
den zum Gotte Pan idealisierten Ton-
heros, der an trauter Waldlichtung
sitzend, unaufhaltsam zu Papier bringt,
was die Natur um ihn singt, und was
er in der Natur ringsum sieht. Ander-
seits aber vergegenwärtigen wir uns
etwa Mendelssohn, wie er auf seinen
Reisen voller Andacht nicht nur mit
dem Stift Landschaftseindrücke fest-
hält, sondern auch in manchen seiner
Symphonien und Ouvertüren (denkeii
wir z. B. an „Meeresstille und glück-
liche Fahrt“) die gesehenen Erlebnisse
in Tönen wiedergibt. So haben wir
ja auch eine ganze Reihe von Malern,
die zugleich Musiker waren, und die es
zuweilen auf beiden Gebieten zu be-
trächtlichen Leistungen brachten, die
den Durchschnitt in der Schwester-
kunst mehr oder weniger hoch über-
ragt haben. Ich glaube, wenn man
sich die Mühe nehmen wollte, eine
Statistik der bildnerisch begabten
Musiker und der musikalischen Maler
(und Bildhauer) aufzustellen, man
würde zu erstaunlichen Resultaten ge-
langen. Doch auch diese, gleichfalls
noch elementaren Zusammenhänge
zwischen der künstlerischen Begabung
des Musikers und des Malers bilden
nur die Vorstufe zu den noch nicht
voll enträtselten Wechselbeziehungen,
die die Aesthetik mit all ihrer Spitz-
findigkeit bis zur Stunde noch nicht
[Nachdmck verboten.]
vollends aufgezeigt hat: der Inspiration des malerischen Schaffens durch
Gebilde der Tonkunst. Der bedeutendste Künstler unserer Zeit auf diesem
Gebiete ist zweifellos Max Klinger. Wer so wie Klinger Bra’nms tiefgründige
Musik nachzufühlen versteht, in dem lebt nicht bloß ein genialer bildnerischer
Geist, sondern in dem webt und glüht auch jene höhere musikalische Begabung,
von deren Weihen die meisten sogenannten Musikliebhaber keine Spur jemals
haben in sich aufglühen fühlen. Ohne kritische Parallelen ziehen zu wollen,
gehört auch Ernest Preyer, der musikalische Landschaftsmaler, in dies Bereich.
Ich muß leise lächeln, indem ich Preyer unbedenklich diese „Marke“ auf seine
Künstlerpersönlichkeit „aufzukleben“ wage. Ich habe aus seinem Zyklus „Die
Musik in Farben“ eine Anzahl im Gedächtnis und weiß, wie unzufrieden der
Künstler, der soeben schaffensfroh in Düsseldorf seinen siebzigsten Geburtstag
begangen hat, mit all den ungelenken Deutungsversuchen gewesen ist, die
geschäftige und geschäftsmäßige Zunftkritiker seinen Gemälden haben zuteil
werden lassen.
Das Wort von dem „musikalischen Landschafter“ Preyer hat insofern Geltung,
als es sich bei seiner „Musik in Farben“ um musikalische Vorwürfe handelt.
Preyer erzählt es selbst, daß der ganze Zyklus dieser Gemälde „während der
Wiedergabe von Schumanns D-moll-Symphonie am 10. Januar 1895 im Leipziger
Gewandhause vor seinem geistigen Auge erschienen sei“. Bei einzelnen Gemälden,
etwa bei der Szene aus Schumanns (heute übrigens teilweise des Textes wegen
schon verbleichendem) weltlichem Oratorium „Das Paradies und die Peri“ denkt
der Künstler an eine ganz bestimmte Stelle (an die Worte: „Eine Peri stand vor
Edens Tor“), bei anderen, wie bei dem „Fliegenden Holländer“, steht blitzartig
vor seinem Künstlergeiste das in glühenden Wolken irrende Gespensterschiff
des ruhelos schweifenden Holländers, während das neapolitanische Volkslied
ihn — hier in mehr spontaner Weise! — zu einem allgemeinen neapolitanischen
Landschaftsbilde voll klingender Anmut und Leidenschaft zugleich inspiriert. Zu
mißverständlichen Deutungen hat, übrigens entschuldbarerweise, die Huldigung
des Künstlers an Mozarts „Zauberflöte“ Anlaß geboten. Man meinte, in den
auf dem Schiffe befindlichen Figuren Gestalten aus der populären Oper — etwa
den Mohren Monostatos, die Königin der Nacht und Sarastro — erkennen zu
können, während Preyer eigner Aussage zufolge lediglich nur das phantastische
Vorüberziehen des Schiffes vor an-
tiken Tempelruinen darstellen wollte,
ebenso wie ihm bei der Huldigung an
Beethoven nicht etwa irgendwelche
romantische Allegorie, sondern die
Erscheinung des in den rheinischen
Wäldern lustwandelnden und kom-
ponierenden jungen Meisters vorge-
schwebt hat. Was hier ein musika-
lisch begabter Künstler auf die Palette
zu bannen suchte, ist nicht etwa
„gewollt“, nicht etwa auf irgendeinen
bestimmten Leitgedanken hingearbei-
tet, sondern es ist einfach der Inspira-
tion gemäß auf die Leinwand gebannt,
es ist das schlichte und naive Selbst-
bekenntnis eines Künstlers, der offen-
bar auf seinen Reisen sich so manches
Mal vergeblich bemüht haben mag,
der Landschaft seine Seele einzu-
hauchen, und der nun an jenem Januar-
abend die Seligkeit der Inspiration
empfunden hat, ein Vorgang, der, wie
Der Hippodrom;
Fi'äulein, da niüssen’s verkehrt aufg’stiegcn sein. 1
MODERNE KUNST.
zwischen Felder und Wiesen, über Berg und Tal, mit verhängten Zügeln die Welt
erstürmend —-Die Musik bricht ab. Die phantastische Seifenblase piatzt, und
der junge Mann, der eben noch im Traumland auf einem weißen Araber dahin-
geflogen, muß in den Sand springen, weil es seine 150 Mark monatlich nicht ge-
statten, noch öfter herumzureiten.
Aber Fräulein Elli reitet noch einmal. Sie kann es sich leisten, oder vielmehr
der junge Kavalier, dem sie beim Vorüberreiten lachend zugewinkt, leistet es ihr. Der
Hippodrom ist ihr Schwarm. Den ganzen Abend bringt sie darin zu, und wie eine
Amazone kommt sie sich vor, wenn sie die bewundernden Blicke der Zuschauer auf
sich ruhen fühlt. Fesch sitzt sie im Sattel (sie reitet natürlich Herrensattel), die Federn
wippen auf dem Hute, der geteilte Rock hat sich etwas hochgeschoben, und die Beine in
den durchsichtigen Florstrümpfen und in schicken Lackpumps schlenkern graziös herunter.
Hoppla! jetzt beginnt die Musik wieder. Die Pferde setzen sich in Trab, die
Kolonne reitet. Fräulein Elli führt die Tete. Ein paar Neulinge sind unter den Reit-
künstlern. Ellis Freundin, die schwarze Mieze, kreischt auf, sie hat die Balance ver-
loren und die Zügel. Krampfhaft hält sie sich am Halse des Pferdes fest. Ihr Hut
ist gerutscht und sie, die sonst so viel auf Haltung sieht, ist leider zur Karikatur ge-
worden. Aber auch einige Herren, denen die Equestrik eine Hekuba war, teilen das
Schicksal der schwarzen Mieze, und der Jiingling mit dem stolzen Schnurrbart macht
sogar Bekanntschaft mit dem Sande, auf den er unsanft herunterfällt.
Das Publikum lacht und klatscht und amüsiert sich. Jedesmal, wenn ein neuer
Reigen beginnt, werden die kühnen Reiter und die feschen Reiterinnen angestaunt
und ihre Bewegungen mit Spannung verfolgt. Aber das größte Oaudium bricht aus,
wenn das gute graue Langohr die Reiterei unterbricht und mit dem Clown eine Vor-
stellung gibt. Auch Leute aus dem Publikum dürfen auf dem Esel reiten — so lange
er sie auf seinem Rücken duldet. Dieser Zweikampf in all seinen Phasen ruft immer
wieder dröhnendes Gelächter hervor, bis dem Bezwinger die Kräfte ausgehen und er
— sich von dem störrischen Grautier trennt. Der Esel aber wird im Triumph von
seinem Herrn, dem Clown, in der Manege herumgeführt.
Im Hippodrom sitzt der Mensch hoch zu Roß und reitet seine „Phantasia“. Und
er glaubt ein Märchenprinz zu sein, der in güldenen Steigbügeln ins Land der Wünsche
fliegt, wo es eitel Glück und Frieden gibt.
Musik und Landschaft.
Von Dr. Arthur Neißer.
den ältesten Zeiten der Malerei ließen es sich die bildenden Künstler,
AJp® zumal die Maler, angelegen sein, die Musik nicht bloß stimmungs-
mäßig in ihren Gemälden anklingen zu lassen, sondern auch die Aus-
übung der Musik zu Seelengemälden von tiefer Weihe zu gestalten. So gehört
das poetische Kapitel der musizierenden Engel in der Kunst zu den reizvollsten,
welche die gesamte Kunstgeschichte kennt; und zumal vom 17. Jahrhundert an,
wo die Genremalerei in den Niederlanden ihre erste Blüte erreicht hatte, ist
uns eine stattliche Anzahl von Gemälden erhalten, die die häusliche Musikübung
in profanem oder sakralem Stile verherrlicht haben. Doch können wir heute
diesen Zusammenhängen zwischen Malerei und Musik, bei denen es sich so-
zusagen nur um die wörtliche Übertragung der Musik mit ihren Stimmungen auf
die Palette handelt, nicht nachgehen.
Denken wir jetzt an Beethovens
Pastoralsymphonie, in der die Natur
ihr launisch Gemüt offenbart, von der
heitersten wie von der dämonisch
durchwühlten Seite! Wir hören nicht
bloß das Bachgeplätscher, wir hören
nicht bloß die Landleute ihre schiebe-
rischen Tänze stampfen, wir sehen
leibhaftig diese Landschaft und ihre
Bewohner vor uns und in ihrer Mitte
den zum Gotte Pan idealisierten Ton-
heros, der an trauter Waldlichtung
sitzend, unaufhaltsam zu Papier bringt,
was die Natur um ihn singt, und was
er in der Natur ringsum sieht. Ander-
seits aber vergegenwärtigen wir uns
etwa Mendelssohn, wie er auf seinen
Reisen voller Andacht nicht nur mit
dem Stift Landschaftseindrücke fest-
hält, sondern auch in manchen seiner
Symphonien und Ouvertüren (denkeii
wir z. B. an „Meeresstille und glück-
liche Fahrt“) die gesehenen Erlebnisse
in Tönen wiedergibt. So haben wir
ja auch eine ganze Reihe von Malern,
die zugleich Musiker waren, und die es
zuweilen auf beiden Gebieten zu be-
trächtlichen Leistungen brachten, die
den Durchschnitt in der Schwester-
kunst mehr oder weniger hoch über-
ragt haben. Ich glaube, wenn man
sich die Mühe nehmen wollte, eine
Statistik der bildnerisch begabten
Musiker und der musikalischen Maler
(und Bildhauer) aufzustellen, man
würde zu erstaunlichen Resultaten ge-
langen. Doch auch diese, gleichfalls
noch elementaren Zusammenhänge
zwischen der künstlerischen Begabung
des Musikers und des Malers bilden
nur die Vorstufe zu den noch nicht
voll enträtselten Wechselbeziehungen,
die die Aesthetik mit all ihrer Spitz-
findigkeit bis zur Stunde noch nicht
[Nachdmck verboten.]
vollends aufgezeigt hat: der Inspiration des malerischen Schaffens durch
Gebilde der Tonkunst. Der bedeutendste Künstler unserer Zeit auf diesem
Gebiete ist zweifellos Max Klinger. Wer so wie Klinger Bra’nms tiefgründige
Musik nachzufühlen versteht, in dem lebt nicht bloß ein genialer bildnerischer
Geist, sondern in dem webt und glüht auch jene höhere musikalische Begabung,
von deren Weihen die meisten sogenannten Musikliebhaber keine Spur jemals
haben in sich aufglühen fühlen. Ohne kritische Parallelen ziehen zu wollen,
gehört auch Ernest Preyer, der musikalische Landschaftsmaler, in dies Bereich.
Ich muß leise lächeln, indem ich Preyer unbedenklich diese „Marke“ auf seine
Künstlerpersönlichkeit „aufzukleben“ wage. Ich habe aus seinem Zyklus „Die
Musik in Farben“ eine Anzahl im Gedächtnis und weiß, wie unzufrieden der
Künstler, der soeben schaffensfroh in Düsseldorf seinen siebzigsten Geburtstag
begangen hat, mit all den ungelenken Deutungsversuchen gewesen ist, die
geschäftige und geschäftsmäßige Zunftkritiker seinen Gemälden haben zuteil
werden lassen.
Das Wort von dem „musikalischen Landschafter“ Preyer hat insofern Geltung,
als es sich bei seiner „Musik in Farben“ um musikalische Vorwürfe handelt.
Preyer erzählt es selbst, daß der ganze Zyklus dieser Gemälde „während der
Wiedergabe von Schumanns D-moll-Symphonie am 10. Januar 1895 im Leipziger
Gewandhause vor seinem geistigen Auge erschienen sei“. Bei einzelnen Gemälden,
etwa bei der Szene aus Schumanns (heute übrigens teilweise des Textes wegen
schon verbleichendem) weltlichem Oratorium „Das Paradies und die Peri“ denkt
der Künstler an eine ganz bestimmte Stelle (an die Worte: „Eine Peri stand vor
Edens Tor“), bei anderen, wie bei dem „Fliegenden Holländer“, steht blitzartig
vor seinem Künstlergeiste das in glühenden Wolken irrende Gespensterschiff
des ruhelos schweifenden Holländers, während das neapolitanische Volkslied
ihn — hier in mehr spontaner Weise! — zu einem allgemeinen neapolitanischen
Landschaftsbilde voll klingender Anmut und Leidenschaft zugleich inspiriert. Zu
mißverständlichen Deutungen hat, übrigens entschuldbarerweise, die Huldigung
des Künstlers an Mozarts „Zauberflöte“ Anlaß geboten. Man meinte, in den
auf dem Schiffe befindlichen Figuren Gestalten aus der populären Oper — etwa
den Mohren Monostatos, die Königin der Nacht und Sarastro — erkennen zu
können, während Preyer eigner Aussage zufolge lediglich nur das phantastische
Vorüberziehen des Schiffes vor an-
tiken Tempelruinen darstellen wollte,
ebenso wie ihm bei der Huldigung an
Beethoven nicht etwa irgendwelche
romantische Allegorie, sondern die
Erscheinung des in den rheinischen
Wäldern lustwandelnden und kom-
ponierenden jungen Meisters vorge-
schwebt hat. Was hier ein musika-
lisch begabter Künstler auf die Palette
zu bannen suchte, ist nicht etwa
„gewollt“, nicht etwa auf irgendeinen
bestimmten Leitgedanken hingearbei-
tet, sondern es ist einfach der Inspira-
tion gemäß auf die Leinwand gebannt,
es ist das schlichte und naive Selbst-
bekenntnis eines Künstlers, der offen-
bar auf seinen Reisen sich so manches
Mal vergeblich bemüht haben mag,
der Landschaft seine Seele einzu-
hauchen, und der nun an jenem Januar-
abend die Seligkeit der Inspiration
empfunden hat, ein Vorgang, der, wie
Der Hippodrom;
Fi'äulein, da niüssen’s verkehrt aufg’stiegcn sein. 1