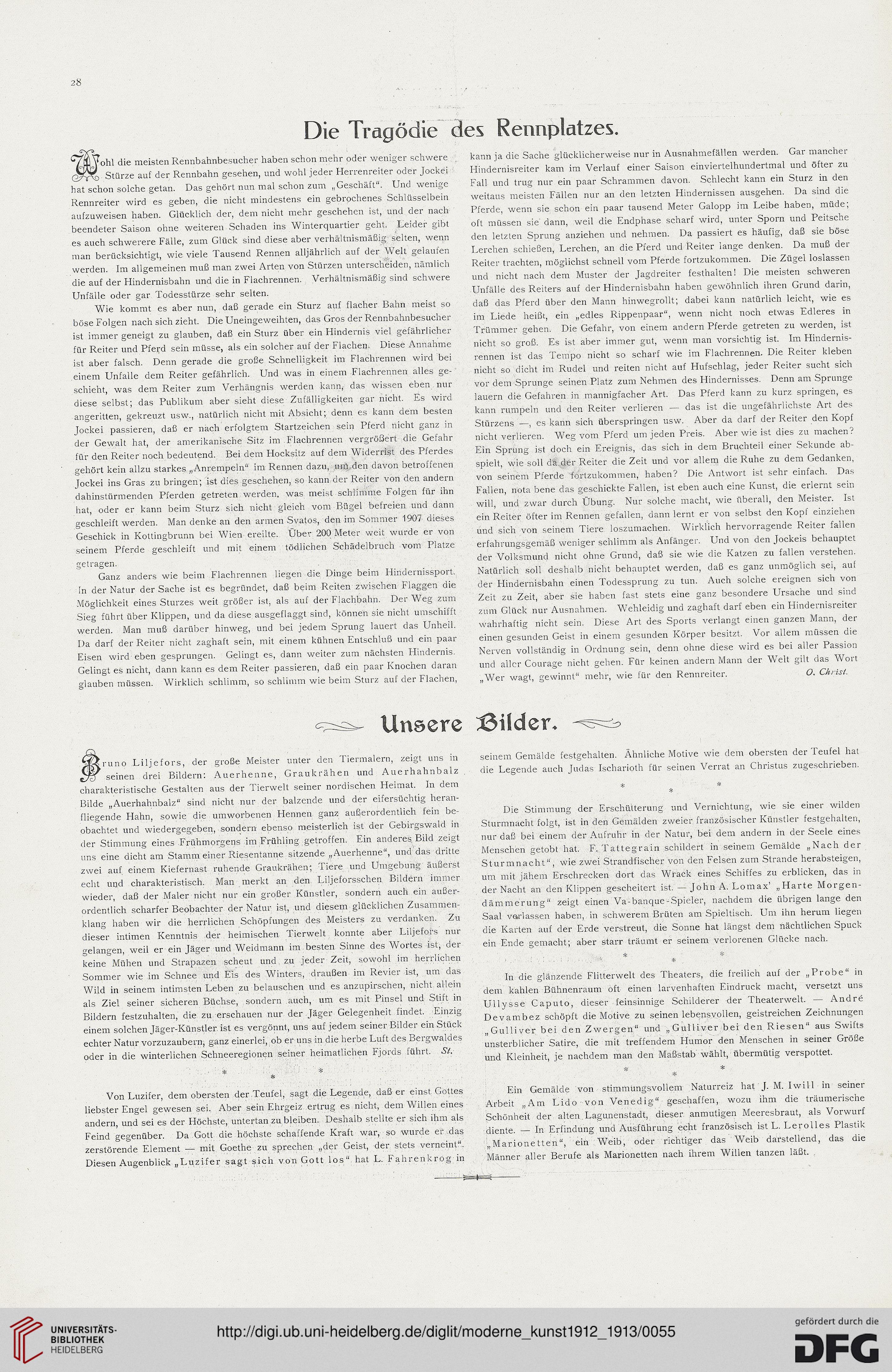28
Die Tragödie des Rennplatzes.
ohl die meisten Rennbahnbesucher haben schon mehr oder weniger schwere
Stürze auf der Rennbahn gesehen, und wohl jeder Herrenreiter oder Jockei :
hat schon solche getan. Das gehört nun mal schon zum „Geschäft“. Und wenige
Rennreiter wird es geben, die nicht mindestens ein gebrochenes Schlüsselbein
aufzuweisen haben. Glücklich der, dem nicht mehr geschehen ist, und der nach
beendeter Saison ohne weiteren Schaden ins Winterquartier geht. Leider gibt
es auch schwerere Fälle, zum Glück sind diese aber verhältnismäßig; selten, wenn
man berücksichtigt, wie viele Tausend Rennen alljährlich auf der Welt gelaufen
werden. Im allgemeinen muß man zwei Arten von Stürzen unterscheiden, nämlich
die auf der Hindernisbahn und die in Fiachrennen. Verhältnismäßig sincl schwere
Unfälle oder gar, Todesstürze sehr selten.
Wie kommt es aber nun, daß gerade ein Sturz auf flacher Bahn meist so
böseFolgen nach sich zieht. Die Uneingeweihten, das Gros der Rennbahnbesucher
ist immer geneigt zu glauben, daß ein Sturz über ein Hindernis viel gefährlicher
für Reiter und Pferd sein müsse, als ein solcher auf der Flachen. Diese Annahme
ist aber falsch. Denn gerade die große Schnelligkeit im Flachrennen wird bei
einem Unfalle dem Reiter gefährlich. Und was in einem Flachrennen alles ge-
schieht, was dem Reiter zum Verhängnis werden kann, das wissen eben nur
diese selbst; das Publikum aber sieht diese Zufälligkeiten gar nicht. Es wird
angeritten, gekreuzt usw,, natürlich nicht mit Absicht; denn: es ■ kann dem besten
Jockei passieren, daß er nkch erfolgtem Startzeichen sein Pferd nicht ganz in
der Gewalt hat, der amerikanische Sitz im Flachrennen vergrößert die Gefahr
für den Reiter noch bedeutend. Bei dem Plocksitz auf dem Widerrist des Pferdes
gehört kein allzu starkes „Anrempeln“ im Rennen dazu, urri den davon betroffenen
Jockei ins Gras zu bringen; ist dies geschehen, so kann der Reiter von den andern
dahinstürmenden Pferden getreten werden, was meist schlimme Folgen für ihn
hat, oder er kann beim Sturz sich nicht gleich vom Bügel befreien und dann
geschleift werden. Man denke an den armen Svatos, den im Sommer 1907 dieses
Geschick in Kottingbrunn bei Wien ereilte. Uber 200 Meter weit wurde er von
seinern Pferde geschleift und mit einern tödlichen Schädelbruch vom Platze
getragen.
Ganz anders wie beim Fiachrennen liegen die Dinge beim Ilindernissport.
In der Natur der Sache ist es begründet, daß beim Reiten zwischen Fiaggen die
Möglichkeit eines Sturzes weit größer ist, als auf der Flachbahn. Der Weg zum
Sieg führt über Klippen, und da diese ausgeflaggt sind, könne'n sie nicht umschifft
werden. Man muß darüber hinweg, und bei jedern Sprung lauert das Unheil.
Da darf der Reiter nicht zaghaft sein, mit einem kühnen Entschiuß und ein paar
Eisen wird eben gesprungen. G.elingt es, dann weiter zum nächsten Hindernis.
Gelingt es nicht, dann kann es dem Reiter passieren, daß ein paar Knochen daran
glauben müssen. Wirklich schlimm, so schlimm wie beirn Sturz auf der Flachen,
Unsere
fruno Liljefors, der große Meister unter den Tiermalern, zeigt uns in
seinen drei Bildern: Auerhenne, Graukrähen und Auerhahnbalz
charakteristische Gestalten aus der Tierwelt seiner nordischen Fleimat. In dem
Bilde „Auerhahnbalz“ sincl nicht nur der balzende und der eifersüchtig heran-
fliegende Flahn, sowie die umworbenen Hennen ganz außerordentlich fein be-
obachtet und wiedergegeben, sondern ebenso meisterlich ist der Gebirgswaid in
der Stimmung eines Frühmorgens im Frühling getroffen. Ein anderes, Bild zeigt
uns eine dicht am Stamm einer Riesentanne sitzende „Auerhenne“, und das dritte
zwei auf einem Kiefernast ruhende Graukrähen; Tiere und Umgebung äußerst
eclit und charakterist'isch. Man merkt an den Liljeforsschen Bildern immer
wieder, daß der Maler nicht nur ein großer Künstler, sondern auch ein außer-
ordentlich scharfer Beobachter der Natur ist, und diesem glücklichen Zusammen-
klang haben wir die herrlichen Schöpfungen des Meisters zu verdanken. Zu
dieser intimen Kenntnis der, heimischen Tierwelt konnte aber Liljefoi’s nur
gelangen, weil er ein Jäger und Weidmann im besten Sinne des Wortes ist, der
keine Mühen und Strapazen scheut und, zu jeder Zeit, sowohl im herrlichen
Sommer wie im Schnee und Eis des Winters, draußen im Revier ist, um das
Wild in seinem intimsten Leben zu belauschen und es anzupirschen, nicht. allein
als Ziel seiner sicheren Büchse, sondern auch, um es mit Pinsel und Stift in
Bildern festzuhalten, die zu erschauen nur der Jäger Gelegenheit findet. E.inzig
einem solchen Jäger-Künstler ist es vergönnt, uns auf jedem seiner Bilder ein Stück
echter Natur vorzuzaubern, g.anz einerlei, ob er uns in dje herbe Luft des Bergwaldes
oder in die winterlichen Schneeregionen seiner heimatlichen Fjords führt. Si.
* *
*
Von Luzifer, dem obersten der Teufel, sagt die Legende, daß er einst Gottes
liebster Engel gewesen sei. Aber sein Ehrgeiz ertrug es nicht, dem Willen eines
andern, und sei es der ILöchste, untertan zu bleiben. Deshalb stellte er sich ihm als
Feind gegenüber. Da Gott die höchste schaffende Kraft war, so wurde er das
zerstörende Element — mit Goethe zu sprechen „der Geist, der stets verneint“.
Diesen Augenblick „Luzifer sagt sich von Gott los“ hat L. Fahrenkrog in
kann ja die Sache glücklicherweise nur in Ausnahmefällen werden. Gar mancher
Hindernisreiter kam im Verlauf einer Saison einviertelhundertmal und öfter zu
Fall und trug nur ein paar Schrammen davon. Schlecht kann ein Sturz in den
weitaus meisten Fällen nur an den letzten Hindernissen ausgehen. Da sind die
Pferde, wenn sie schon ein paar tausend Meter Galopp im Leibe haben, müde;
oft müssen sie’ dann, weil die Endphase scharf wird, unter Sporn und Peitsche
den letzten Sprung anziehen und nehmen. Da passiert es häufig, daß sie böse
Lerchen schießen, Lerchen, an die Pferd und Reiter iange denken. Da muß der
Reiter trachten, möglichst schnell vom Pferde fortzukommen. Die Zügel loslassen
und nicht nach dem Muster der Jagdreiter festhalten! Die meisten schweren
Unfälle des Reiters auf der Hindernisbahn haben gewöhnlich ihren Grund darin,
daß das Pferd über den Mann hinwegrollt; dabei kann natürlich leicht, wie es
irn Liede heißt, ein „edles Rippenpaar“, wenn nicht noch etwas Edleres in
Trümmer gehen. Die Gefahr, von einem andern Pferde getreten zu werden, ist
nicht so groß. Es ist aber immer gut, wenn man vorsichtig ist. Im Hindernis-
rennen ist das Tempo nicht so scharf wie irn Flachrennen. Die Reiter kleben
nicht so dicht im Rudel und reiten nicht auf Hufschlag, jeder Reiter sucht sich
vor dem Sprunge seinen Platz zum Nehmen des Ilindernisses. Denn am Sprunge
lauern die Gefahren in mannigfacher Art. Das Pferd kann zu kurz springen, es
kann rumpeln und den Reiter verlieren — das ist die ungefährlichste Art des
StürzÖhsft—, es kann sich überspringen usw. Aber da darf der Reiter den Kopf
nicht vefiieren. Weg vom Pferd um jeden Preis. Aber wie ist dies zu machen?
Ein Sprung ist doch ein Ereignis, das sich in dem Bruchteil einer Sekunde ab-
spielt, wie soll dä.der Reiter die Zeit und vor allem die Ruhe zu dem Gedanken,
von seinern Pferde Törtzukommen, haben? Die Antwört ist sehr einfach. Das
Fallen, nota bene das geschickte Fallen, ist eben auch eine Kunst, die erlernt sein
wil), und zwar durch Übung. Nur solche macht, wie überall, den Meister. Ist
ein Reiter öfter im Rennen gefallen, dann lernt er von selbst den Kopf einziehen
und sich von seinern Tiere loszumachen. Wirklich hervorragende Reiter fallen
erfahrungsgemäß weniger sehlimm als Anfänger. Und von den Jockeis behauptet
der Voiksmund nicht ohne Grund, daß sie wie die Katzen zu fallen verstehen.
Natürlich soll deshalb nicht behauptet werden, daß es ganz unmöglich sei, auf
der Hindernisbahn einen Todessprung zu tun. Auch solche ereignen sich von
Zeit zu Zeit, aber sie haben fast stets eine ganz besondere Ursache und sind
zum Glück nur Ausnahmen. Wehieidig und zaghaft darf eben ein Flindernisreiter
wahrhaftig nicht sein. Diese Art des Sports verlangt einen ganzen Mann, der
einen gesunden Geist in einem gesunden Körper besitzt. Vor allem müssen die
Nerven vollständig in Ordnung sein, denn ohne diese wird es bei aller Passion
und allcr Courage nicht gehen. Für keinen andern Mann der Welt gilt das Wort
„Wer wagt, gewinnt“ mehr, wie für den Rennreiter. O. Chrisl.
ÖÜder.
seinem Gemälde festgehalten. Ähnliche Motive wie dem obersten der Teufel hat
die Legende auch Judas'Ischarioth für seinen Verrat an Christus zugeschrieben.
* *
Die -Stimmung der Erschittterung und Vernichtung, wie sie einer wilden
Sturmnacht folgt, ist in den Gemälden zweier französischer Ivüustler festgehalten,
nur daß bei einem der Aufruhr in der Natur, bei dem andern in der Seele eines
Menschen getobt hat. F. Tattegrain schildert in seinem Gemälde „Nach der
Sturmnacht“, wie zwei Strandfischer von den Felsen zum Strande herabsteigen,
um mit jähem Erschrecken dort das Wrack eines Schiffes zu erblicken, das in
der Nacht an den Klippen gescheitert ist. — John A. Lomax’ „Harte Morgen-
dämmerung“ zeigt eineri Va-banque-Spieler, nachdem die übrigen lange den
Saal varlassen haben, in schwerem Brüten am Spieltisch. Um ihn herum liegen
die Karten auf der Erde verstreut, die Sonne hat längst dem nächtlichen Spuck
ein Ende gemacht; aber starr träumt er seinern verlorenen Glücke nach.
i S:
- • • .., ' ' ■'•■ .
In die glänzende Flitterwelt des Theaters, die freilich auf der „Probe“ in
dem kahlen Bühnenraum oft einen larvenhaften Eindruck macht, versetzt uns
Ullysse Gaputo, dieser feinsinnige Schilderer der Theaterwelt. — Andre
Devambez schöpft die Motive zu seinen lebensvollen, geistreichen Zeichnungen
„Gulliver bei den Zwergen“ und „Gülliver bei den Riesen“ aus Swifts
unsterblicher Satire, die mit treffendem Flumor den Menschen in seiner Größe
und Kleinheit, je nachdem man den Maßstab wählt, übermütig verspottet.
* *
*
Ein Gemälde von stimmüngsvollem Naturreiz hat J. M. Iwill in seiner
Arbeit „Am Lido von Venedig“ geschaffen, wozu ihm die träumerische
Schönheit der alten. Lagunenstadt, dieser anmutigen Meeresbraut, als Vorwurf
diente. — In Erfindung und Ausführung echt französisch ist L. Lerolles Plastik
„Marionetten“, ein Weib, oder richtiger das Weib darstellend, das die
Männer aller Berufe als Marionetten nach ihrem Willen tanzen läßt.
Die Tragödie des Rennplatzes.
ohl die meisten Rennbahnbesucher haben schon mehr oder weniger schwere
Stürze auf der Rennbahn gesehen, und wohl jeder Herrenreiter oder Jockei :
hat schon solche getan. Das gehört nun mal schon zum „Geschäft“. Und wenige
Rennreiter wird es geben, die nicht mindestens ein gebrochenes Schlüsselbein
aufzuweisen haben. Glücklich der, dem nicht mehr geschehen ist, und der nach
beendeter Saison ohne weiteren Schaden ins Winterquartier geht. Leider gibt
es auch schwerere Fälle, zum Glück sind diese aber verhältnismäßig; selten, wenn
man berücksichtigt, wie viele Tausend Rennen alljährlich auf der Welt gelaufen
werden. Im allgemeinen muß man zwei Arten von Stürzen unterscheiden, nämlich
die auf der Hindernisbahn und die in Fiachrennen. Verhältnismäßig sincl schwere
Unfälle oder gar, Todesstürze sehr selten.
Wie kommt es aber nun, daß gerade ein Sturz auf flacher Bahn meist so
böseFolgen nach sich zieht. Die Uneingeweihten, das Gros der Rennbahnbesucher
ist immer geneigt zu glauben, daß ein Sturz über ein Hindernis viel gefährlicher
für Reiter und Pferd sein müsse, als ein solcher auf der Flachen. Diese Annahme
ist aber falsch. Denn gerade die große Schnelligkeit im Flachrennen wird bei
einem Unfalle dem Reiter gefährlich. Und was in einem Flachrennen alles ge-
schieht, was dem Reiter zum Verhängnis werden kann, das wissen eben nur
diese selbst; das Publikum aber sieht diese Zufälligkeiten gar nicht. Es wird
angeritten, gekreuzt usw,, natürlich nicht mit Absicht; denn: es ■ kann dem besten
Jockei passieren, daß er nkch erfolgtem Startzeichen sein Pferd nicht ganz in
der Gewalt hat, der amerikanische Sitz im Flachrennen vergrößert die Gefahr
für den Reiter noch bedeutend. Bei dem Plocksitz auf dem Widerrist des Pferdes
gehört kein allzu starkes „Anrempeln“ im Rennen dazu, urri den davon betroffenen
Jockei ins Gras zu bringen; ist dies geschehen, so kann der Reiter von den andern
dahinstürmenden Pferden getreten werden, was meist schlimme Folgen für ihn
hat, oder er kann beim Sturz sich nicht gleich vom Bügel befreien und dann
geschleift werden. Man denke an den armen Svatos, den im Sommer 1907 dieses
Geschick in Kottingbrunn bei Wien ereilte. Uber 200 Meter weit wurde er von
seinern Pferde geschleift und mit einern tödlichen Schädelbruch vom Platze
getragen.
Ganz anders wie beim Fiachrennen liegen die Dinge beim Ilindernissport.
In der Natur der Sache ist es begründet, daß beim Reiten zwischen Fiaggen die
Möglichkeit eines Sturzes weit größer ist, als auf der Flachbahn. Der Weg zum
Sieg führt über Klippen, und da diese ausgeflaggt sind, könne'n sie nicht umschifft
werden. Man muß darüber hinweg, und bei jedern Sprung lauert das Unheil.
Da darf der Reiter nicht zaghaft sein, mit einem kühnen Entschiuß und ein paar
Eisen wird eben gesprungen. G.elingt es, dann weiter zum nächsten Hindernis.
Gelingt es nicht, dann kann es dem Reiter passieren, daß ein paar Knochen daran
glauben müssen. Wirklich schlimm, so schlimm wie beirn Sturz auf der Flachen,
Unsere
fruno Liljefors, der große Meister unter den Tiermalern, zeigt uns in
seinen drei Bildern: Auerhenne, Graukrähen und Auerhahnbalz
charakteristische Gestalten aus der Tierwelt seiner nordischen Fleimat. In dem
Bilde „Auerhahnbalz“ sincl nicht nur der balzende und der eifersüchtig heran-
fliegende Flahn, sowie die umworbenen Hennen ganz außerordentlich fein be-
obachtet und wiedergegeben, sondern ebenso meisterlich ist der Gebirgswaid in
der Stimmung eines Frühmorgens im Frühling getroffen. Ein anderes, Bild zeigt
uns eine dicht am Stamm einer Riesentanne sitzende „Auerhenne“, und das dritte
zwei auf einem Kiefernast ruhende Graukrähen; Tiere und Umgebung äußerst
eclit und charakterist'isch. Man merkt an den Liljeforsschen Bildern immer
wieder, daß der Maler nicht nur ein großer Künstler, sondern auch ein außer-
ordentlich scharfer Beobachter der Natur ist, und diesem glücklichen Zusammen-
klang haben wir die herrlichen Schöpfungen des Meisters zu verdanken. Zu
dieser intimen Kenntnis der, heimischen Tierwelt konnte aber Liljefoi’s nur
gelangen, weil er ein Jäger und Weidmann im besten Sinne des Wortes ist, der
keine Mühen und Strapazen scheut und, zu jeder Zeit, sowohl im herrlichen
Sommer wie im Schnee und Eis des Winters, draußen im Revier ist, um das
Wild in seinem intimsten Leben zu belauschen und es anzupirschen, nicht. allein
als Ziel seiner sicheren Büchse, sondern auch, um es mit Pinsel und Stift in
Bildern festzuhalten, die zu erschauen nur der Jäger Gelegenheit findet. E.inzig
einem solchen Jäger-Künstler ist es vergönnt, uns auf jedem seiner Bilder ein Stück
echter Natur vorzuzaubern, g.anz einerlei, ob er uns in dje herbe Luft des Bergwaldes
oder in die winterlichen Schneeregionen seiner heimatlichen Fjords führt. Si.
* *
*
Von Luzifer, dem obersten der Teufel, sagt die Legende, daß er einst Gottes
liebster Engel gewesen sei. Aber sein Ehrgeiz ertrug es nicht, dem Willen eines
andern, und sei es der ILöchste, untertan zu bleiben. Deshalb stellte er sich ihm als
Feind gegenüber. Da Gott die höchste schaffende Kraft war, so wurde er das
zerstörende Element — mit Goethe zu sprechen „der Geist, der stets verneint“.
Diesen Augenblick „Luzifer sagt sich von Gott los“ hat L. Fahrenkrog in
kann ja die Sache glücklicherweise nur in Ausnahmefällen werden. Gar mancher
Hindernisreiter kam im Verlauf einer Saison einviertelhundertmal und öfter zu
Fall und trug nur ein paar Schrammen davon. Schlecht kann ein Sturz in den
weitaus meisten Fällen nur an den letzten Hindernissen ausgehen. Da sind die
Pferde, wenn sie schon ein paar tausend Meter Galopp im Leibe haben, müde;
oft müssen sie’ dann, weil die Endphase scharf wird, unter Sporn und Peitsche
den letzten Sprung anziehen und nehmen. Da passiert es häufig, daß sie böse
Lerchen schießen, Lerchen, an die Pferd und Reiter iange denken. Da muß der
Reiter trachten, möglichst schnell vom Pferde fortzukommen. Die Zügel loslassen
und nicht nach dem Muster der Jagdreiter festhalten! Die meisten schweren
Unfälle des Reiters auf der Hindernisbahn haben gewöhnlich ihren Grund darin,
daß das Pferd über den Mann hinwegrollt; dabei kann natürlich leicht, wie es
irn Liede heißt, ein „edles Rippenpaar“, wenn nicht noch etwas Edleres in
Trümmer gehen. Die Gefahr, von einem andern Pferde getreten zu werden, ist
nicht so groß. Es ist aber immer gut, wenn man vorsichtig ist. Im Hindernis-
rennen ist das Tempo nicht so scharf wie irn Flachrennen. Die Reiter kleben
nicht so dicht im Rudel und reiten nicht auf Hufschlag, jeder Reiter sucht sich
vor dem Sprunge seinen Platz zum Nehmen des Ilindernisses. Denn am Sprunge
lauern die Gefahren in mannigfacher Art. Das Pferd kann zu kurz springen, es
kann rumpeln und den Reiter verlieren — das ist die ungefährlichste Art des
StürzÖhsft—, es kann sich überspringen usw. Aber da darf der Reiter den Kopf
nicht vefiieren. Weg vom Pferd um jeden Preis. Aber wie ist dies zu machen?
Ein Sprung ist doch ein Ereignis, das sich in dem Bruchteil einer Sekunde ab-
spielt, wie soll dä.der Reiter die Zeit und vor allem die Ruhe zu dem Gedanken,
von seinern Pferde Törtzukommen, haben? Die Antwört ist sehr einfach. Das
Fallen, nota bene das geschickte Fallen, ist eben auch eine Kunst, die erlernt sein
wil), und zwar durch Übung. Nur solche macht, wie überall, den Meister. Ist
ein Reiter öfter im Rennen gefallen, dann lernt er von selbst den Kopf einziehen
und sich von seinern Tiere loszumachen. Wirklich hervorragende Reiter fallen
erfahrungsgemäß weniger sehlimm als Anfänger. Und von den Jockeis behauptet
der Voiksmund nicht ohne Grund, daß sie wie die Katzen zu fallen verstehen.
Natürlich soll deshalb nicht behauptet werden, daß es ganz unmöglich sei, auf
der Hindernisbahn einen Todessprung zu tun. Auch solche ereignen sich von
Zeit zu Zeit, aber sie haben fast stets eine ganz besondere Ursache und sind
zum Glück nur Ausnahmen. Wehieidig und zaghaft darf eben ein Flindernisreiter
wahrhaftig nicht sein. Diese Art des Sports verlangt einen ganzen Mann, der
einen gesunden Geist in einem gesunden Körper besitzt. Vor allem müssen die
Nerven vollständig in Ordnung sein, denn ohne diese wird es bei aller Passion
und allcr Courage nicht gehen. Für keinen andern Mann der Welt gilt das Wort
„Wer wagt, gewinnt“ mehr, wie für den Rennreiter. O. Chrisl.
ÖÜder.
seinem Gemälde festgehalten. Ähnliche Motive wie dem obersten der Teufel hat
die Legende auch Judas'Ischarioth für seinen Verrat an Christus zugeschrieben.
* *
Die -Stimmung der Erschittterung und Vernichtung, wie sie einer wilden
Sturmnacht folgt, ist in den Gemälden zweier französischer Ivüustler festgehalten,
nur daß bei einem der Aufruhr in der Natur, bei dem andern in der Seele eines
Menschen getobt hat. F. Tattegrain schildert in seinem Gemälde „Nach der
Sturmnacht“, wie zwei Strandfischer von den Felsen zum Strande herabsteigen,
um mit jähem Erschrecken dort das Wrack eines Schiffes zu erblicken, das in
der Nacht an den Klippen gescheitert ist. — John A. Lomax’ „Harte Morgen-
dämmerung“ zeigt eineri Va-banque-Spieler, nachdem die übrigen lange den
Saal varlassen haben, in schwerem Brüten am Spieltisch. Um ihn herum liegen
die Karten auf der Erde verstreut, die Sonne hat längst dem nächtlichen Spuck
ein Ende gemacht; aber starr träumt er seinern verlorenen Glücke nach.
i S:
- • • .., ' ' ■'•■ .
In die glänzende Flitterwelt des Theaters, die freilich auf der „Probe“ in
dem kahlen Bühnenraum oft einen larvenhaften Eindruck macht, versetzt uns
Ullysse Gaputo, dieser feinsinnige Schilderer der Theaterwelt. — Andre
Devambez schöpft die Motive zu seinen lebensvollen, geistreichen Zeichnungen
„Gulliver bei den Zwergen“ und „Gülliver bei den Riesen“ aus Swifts
unsterblicher Satire, die mit treffendem Flumor den Menschen in seiner Größe
und Kleinheit, je nachdem man den Maßstab wählt, übermütig verspottet.
* *
*
Ein Gemälde von stimmüngsvollem Naturreiz hat J. M. Iwill in seiner
Arbeit „Am Lido von Venedig“ geschaffen, wozu ihm die träumerische
Schönheit der alten. Lagunenstadt, dieser anmutigen Meeresbraut, als Vorwurf
diente. — In Erfindung und Ausführung echt französisch ist L. Lerolles Plastik
„Marionetten“, ein Weib, oder richtiger das Weib darstellend, das die
Männer aller Berufe als Marionetten nach ihrem Willen tanzen läßt.