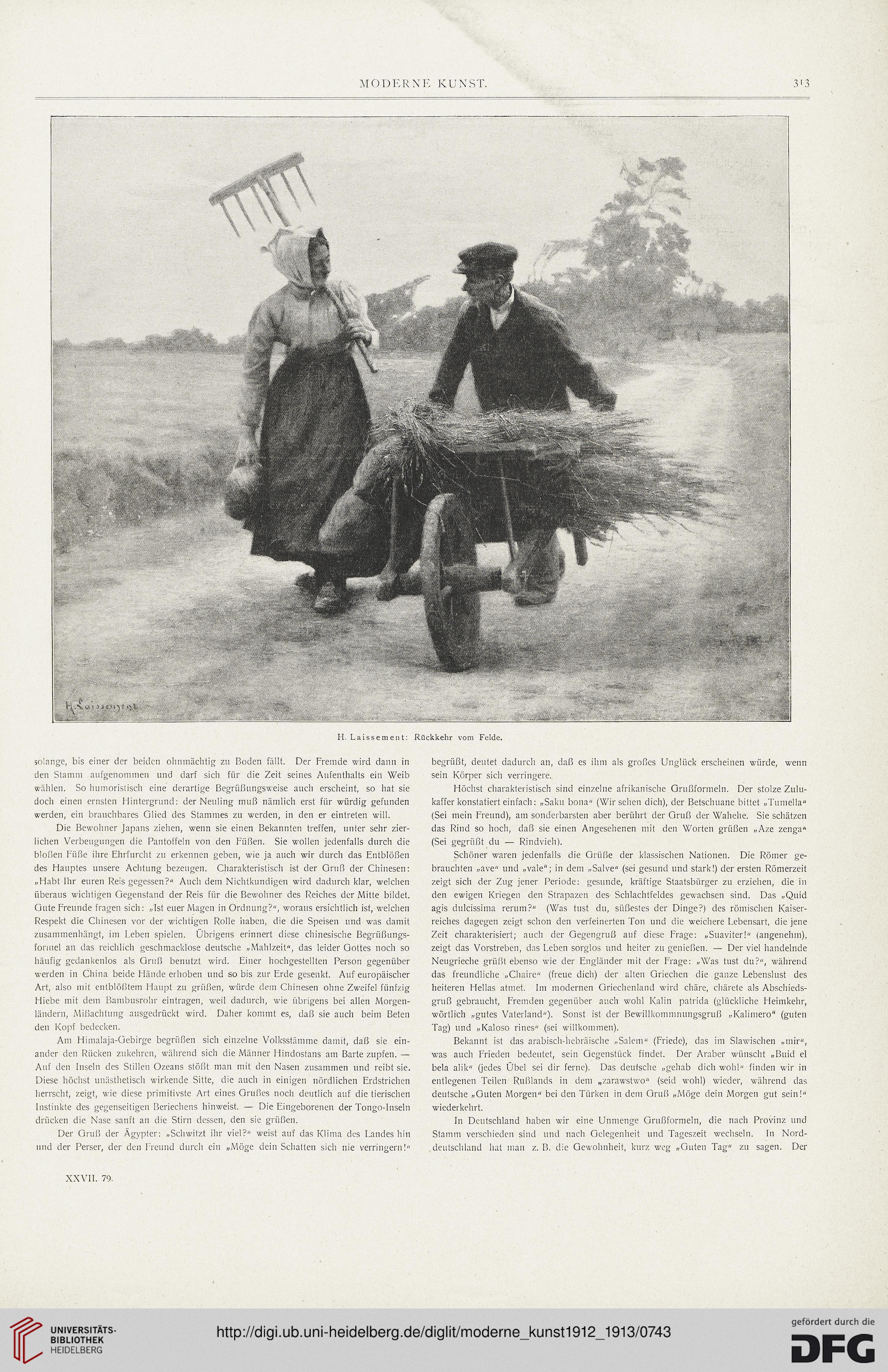Moderne Kunst: illustrierte Zeitschrift — 27.1912/1913
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.31170#0743
DOI Heft:
24. Heft
DOI Artikel:Thielemann, Paul: Allerlei vom Gruß: kunsthistorische Plauderei
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.31170#0743
MODERNE KUNST.
3 13
H. Laissement: Rückkehr vom Felde.
solange, bis einer der beidcn ohmnächtig zu Boden fällt. Der Fremde wird dann in
den Stamni aufgenommen und darf sich für die Zeit seines Aufenthalts ein Weib
wählen. So humoristisch eine derartige Begrüßungsweise auch erscheint, so hat sie
doch einen ernsten Hintergrund: der Neuling muß nämlich erst für würdig gefunden
werden, ein brauchbares Glied des Stammes zu werden, in den er eintreten will.
Die Bewohner Japans ziehen, wenn sie einen Bekannten treffen, unter sehr zier-
iichen Verbeugungen die Pantoffeln von den Füßen. Sie wollen jedenfalls durch die
bioßen Fiiße ihre Ehrfurcht zu erkennen geben, wie ja auch wir durch das Entblößen
des Hauptes unsere Achtung bezeugen. Charakteristisch ist der Gruß der Chinesen:
»Habt Ihr euren Reis gegessen?“ Auch dem Nichtkundigen wird dadurch klar, welchen
iiberaus wichtigen Gegenstand der Reis fiir die Bewohner des Reiches der Mitte bildet.
Gute Freunde fragen sich: „Ist euer Magen in Ordnung?", woraus ersichtlich ist, welchen
Respekt die Chinesen vor der wichtigen Rolle haben, die die Speisen und was damit
z'usammenhängt, im Leben spielen. Übrigens erinnert diese chinesische Begrüßungs-
formel an das reichlich geschmacklose deutsche „Mahlzeit“, das leider Gottes noch so
häufig gedankenlos als Gruß benutzt wird. Einer hochgestellten Person gegenüber
werden in China beide Hände erhoben und so bis zur Erde gesenkt. Auf europäischer
Art, also mit entblößtem Haupt zu griißen, würde dem Chinesen ohne Zweifel fünfzig
Hiebe mit dem Bambusrohr eintragen, weil dadurch, wie iibrigens bei allen Morgen-
Iändern, Mißachtung ausgedrückt wird. Daher kommt es, daß sie auch beim Beten
den Kopf bedecken.
Am Himalaja-Gebirge begriißen sicli einzelne Volksstämme daniit, daß sie ein-
ander den Rücken zukehren, während sich die Männer Hindostans am Barte zupfen. —
Auf den Inseln des Stillen Ozeans stößt man mit den Nasen zusammen und reibt sie.
Diese höchst unästhetisch wirkende Sitte, die auch in einigen nördlichen Erdstrichen
herrscht, zeigt, wie diese primitivste Art eines Grußes noch deutlich auf die tierischen
Instinkte des gegenseitigen Beriechens hinweist. — Die Eingeborenen der Tongo-Inseln
drücken die Nase sanft an die Stirn dessen, den sie grüßen.
Der Gruß der Ägypter: „Schwitzt ihr viel?" weist auf das Klima des Landes hin
und der Perser, der den Freund ditrch ein „Möge dein Schatten sich nie verrjngern!“
begrüßt, deutet dadurch an, daß es ihm als großes Unglück erscheinen würde, wenn
sein Körper sich verringere.
Höchst charakteristisch sind einzelne afrikanische Grußformeln. Der stolze Zulu-
kaffer konstatiert einfach: „Saku bona" (Wirsehen dich), der Betschuane bittet „Tumella“
(Sei mein Freund), am sonderbarsten aber berührt der Gruß der Wahehe. Sie schätzen
das Rind so hoch, daß sie einen Angesehenen mit den Worten grüßen „Aze zenga“
(Sei gegrüßt du — Rindvieh).
Schöner waren jedenfalls die Grüße der klassischen Nationen. Die Römer ge-
brauchten „ave" und „vale“; in dem „Salve" (sei gesund und stark!) der ersten Römerzeit
zeigt sich der Zug jener Periode: gesunde, kräftige Staatsbürger zu erziehen, die in
den ewigen Kriegen den Strapazen des Schlachtfeldes gewachsen sind. Das „Quid
agis dulcissima rerum?“ (Was tust du, süßestes der Dinge?) des römischen Kaiser-
reiches dagegen zeigt schon den verfeinerten Ton und die weichere Lebensart, die jene
Zeit charakterisiert; auch der Gegengruß auf diese Frage: „Suaviter!" (angenehm),
zeigt das Vorstreben, das Leben sorgios und heiter zu genießen. — Der viel handelnde
Neugrieche griißt ebenso wie der Engländer mit der Frage: „Was tust du?", während
das freundliche „Chaire" (freue dich) der alten Griechen die ganze Lebenslust des
heiteren Hellas atmet. Im modernen Griechenland wird chäre, chärete als Abschieds-
gruß gebraucht, Fremden gegenüber auch wohl Kalin patrida (glückliche Heimkehr,
wörtlich „gutes Vaterland"). Sonst ist der Bewillkommnungsgruß „Kalimero“ (guten
Tag) und „Kaloso rines" (sei willkommen).
Bekannt ist das arabisch-hebräische „Salem“ (Friede), das im Slawischen „mir",
was auch Frieden bedeutet, sein Gegenstück findet. Der Araber wünscht „Buid el
bela alik" (jedes Übel sei dir ferne). Das deutsche „gehab dich wohl“ finden wir in
entlegenen Teilen Rußlands in dem „zarawstwo" (seid wohl) wieder, während das
deutsche „Guten Morgen" bei den Türken in dera Gruß „Möge dein Morgen gut sein!“
wiederkehrt.
In Deutschland haben wir eine Unmenge Grußformeln, die nach Provinz und
Stamm verschieden sind und nach Gelegenheit und Tageszeit wechseln. In Nord-
deutschland hat man z. B. die Gewohnheit, kurz weg „Guten Tag" zu sagen. Der
XXVII. 79.
3 13
H. Laissement: Rückkehr vom Felde.
solange, bis einer der beidcn ohmnächtig zu Boden fällt. Der Fremde wird dann in
den Stamni aufgenommen und darf sich für die Zeit seines Aufenthalts ein Weib
wählen. So humoristisch eine derartige Begrüßungsweise auch erscheint, so hat sie
doch einen ernsten Hintergrund: der Neuling muß nämlich erst für würdig gefunden
werden, ein brauchbares Glied des Stammes zu werden, in den er eintreten will.
Die Bewohner Japans ziehen, wenn sie einen Bekannten treffen, unter sehr zier-
iichen Verbeugungen die Pantoffeln von den Füßen. Sie wollen jedenfalls durch die
bioßen Fiiße ihre Ehrfurcht zu erkennen geben, wie ja auch wir durch das Entblößen
des Hauptes unsere Achtung bezeugen. Charakteristisch ist der Gruß der Chinesen:
»Habt Ihr euren Reis gegessen?“ Auch dem Nichtkundigen wird dadurch klar, welchen
iiberaus wichtigen Gegenstand der Reis fiir die Bewohner des Reiches der Mitte bildet.
Gute Freunde fragen sich: „Ist euer Magen in Ordnung?", woraus ersichtlich ist, welchen
Respekt die Chinesen vor der wichtigen Rolle haben, die die Speisen und was damit
z'usammenhängt, im Leben spielen. Übrigens erinnert diese chinesische Begrüßungs-
formel an das reichlich geschmacklose deutsche „Mahlzeit“, das leider Gottes noch so
häufig gedankenlos als Gruß benutzt wird. Einer hochgestellten Person gegenüber
werden in China beide Hände erhoben und so bis zur Erde gesenkt. Auf europäischer
Art, also mit entblößtem Haupt zu griißen, würde dem Chinesen ohne Zweifel fünfzig
Hiebe mit dem Bambusrohr eintragen, weil dadurch, wie iibrigens bei allen Morgen-
Iändern, Mißachtung ausgedrückt wird. Daher kommt es, daß sie auch beim Beten
den Kopf bedecken.
Am Himalaja-Gebirge begriißen sicli einzelne Volksstämme daniit, daß sie ein-
ander den Rücken zukehren, während sich die Männer Hindostans am Barte zupfen. —
Auf den Inseln des Stillen Ozeans stößt man mit den Nasen zusammen und reibt sie.
Diese höchst unästhetisch wirkende Sitte, die auch in einigen nördlichen Erdstrichen
herrscht, zeigt, wie diese primitivste Art eines Grußes noch deutlich auf die tierischen
Instinkte des gegenseitigen Beriechens hinweist. — Die Eingeborenen der Tongo-Inseln
drücken die Nase sanft an die Stirn dessen, den sie grüßen.
Der Gruß der Ägypter: „Schwitzt ihr viel?" weist auf das Klima des Landes hin
und der Perser, der den Freund ditrch ein „Möge dein Schatten sich nie verrjngern!“
begrüßt, deutet dadurch an, daß es ihm als großes Unglück erscheinen würde, wenn
sein Körper sich verringere.
Höchst charakteristisch sind einzelne afrikanische Grußformeln. Der stolze Zulu-
kaffer konstatiert einfach: „Saku bona" (Wirsehen dich), der Betschuane bittet „Tumella“
(Sei mein Freund), am sonderbarsten aber berührt der Gruß der Wahehe. Sie schätzen
das Rind so hoch, daß sie einen Angesehenen mit den Worten grüßen „Aze zenga“
(Sei gegrüßt du — Rindvieh).
Schöner waren jedenfalls die Grüße der klassischen Nationen. Die Römer ge-
brauchten „ave" und „vale“; in dem „Salve" (sei gesund und stark!) der ersten Römerzeit
zeigt sich der Zug jener Periode: gesunde, kräftige Staatsbürger zu erziehen, die in
den ewigen Kriegen den Strapazen des Schlachtfeldes gewachsen sind. Das „Quid
agis dulcissima rerum?“ (Was tust du, süßestes der Dinge?) des römischen Kaiser-
reiches dagegen zeigt schon den verfeinerten Ton und die weichere Lebensart, die jene
Zeit charakterisiert; auch der Gegengruß auf diese Frage: „Suaviter!" (angenehm),
zeigt das Vorstreben, das Leben sorgios und heiter zu genießen. — Der viel handelnde
Neugrieche griißt ebenso wie der Engländer mit der Frage: „Was tust du?", während
das freundliche „Chaire" (freue dich) der alten Griechen die ganze Lebenslust des
heiteren Hellas atmet. Im modernen Griechenland wird chäre, chärete als Abschieds-
gruß gebraucht, Fremden gegenüber auch wohl Kalin patrida (glückliche Heimkehr,
wörtlich „gutes Vaterland"). Sonst ist der Bewillkommnungsgruß „Kalimero“ (guten
Tag) und „Kaloso rines" (sei willkommen).
Bekannt ist das arabisch-hebräische „Salem“ (Friede), das im Slawischen „mir",
was auch Frieden bedeutet, sein Gegenstück findet. Der Araber wünscht „Buid el
bela alik" (jedes Übel sei dir ferne). Das deutsche „gehab dich wohl“ finden wir in
entlegenen Teilen Rußlands in dem „zarawstwo" (seid wohl) wieder, während das
deutsche „Guten Morgen" bei den Türken in dera Gruß „Möge dein Morgen gut sein!“
wiederkehrt.
In Deutschland haben wir eine Unmenge Grußformeln, die nach Provinz und
Stamm verschieden sind und nach Gelegenheit und Tageszeit wechseln. In Nord-
deutschland hat man z. B. die Gewohnheit, kurz weg „Guten Tag" zu sagen. Der
XXVII. 79.