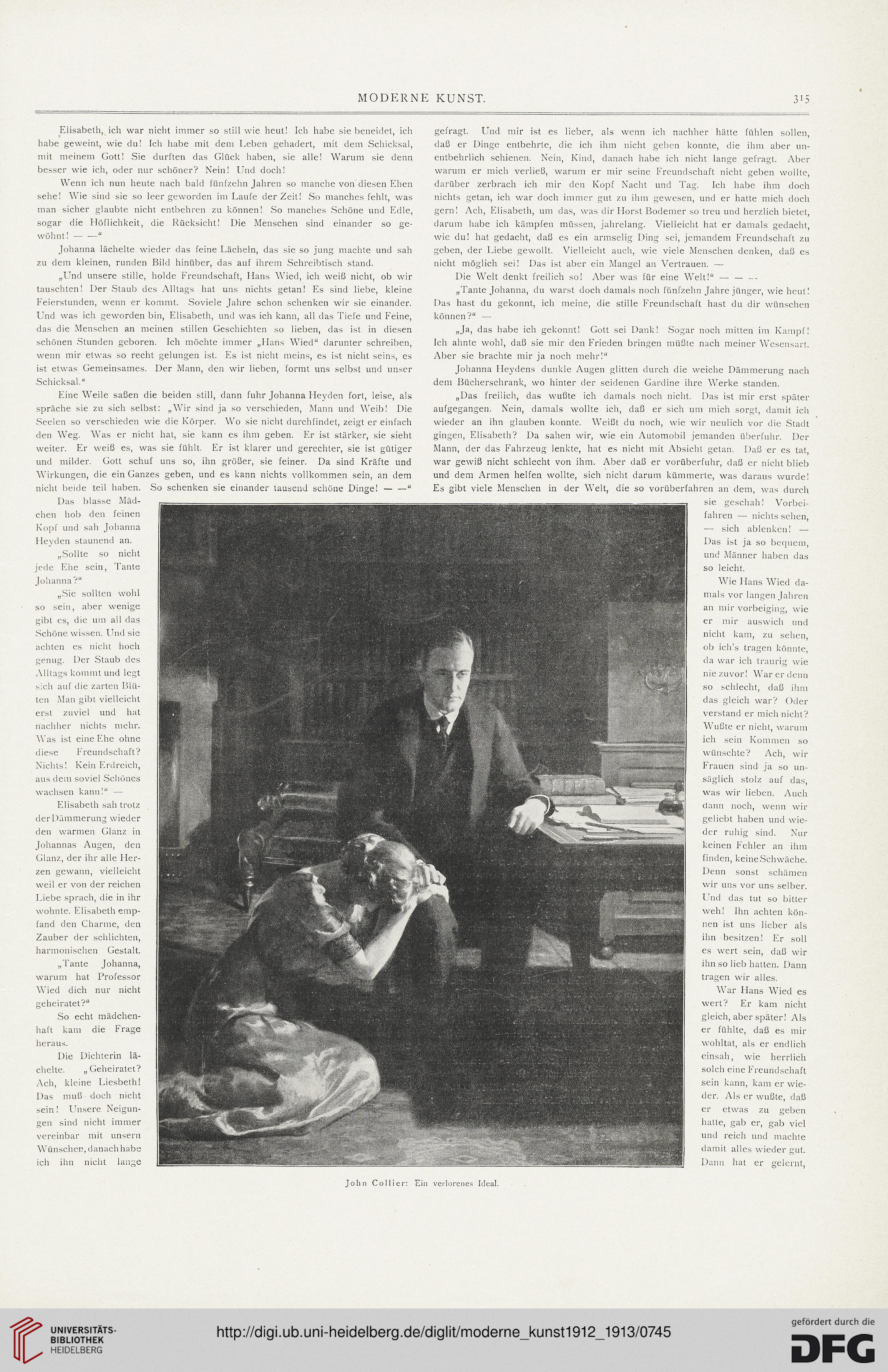MODERNE KUNST.
3U
Elisabeth, ich war nicht immer so still wie heut! Ich habe sie beneidet, ich
habe geweint, wie du! Ich habe mit dem Leben gehadert, mit dem Schicksal,
mit meinem Gott! Sie durften das Glück haben, sie alle! Warum sie denn
besser wie ich, oder nur schöner? Nein! Und doch!
Wenn ich nun heute nach bald ftinfzehn Jahren so manche von diesen Ehen
sehe! Wie sind sie so leer geworden im Laufe derZeit! So manches fehlt, was
man sicher glaubte nicht entbehren zu können! So manches Sc.höne und Edle,
sogar die Höflichkeit, die Rücksicht! Die Menschen sind einander so ge-
wöhnt!-“
Johanna lächelte wieder das feine Lächeln, das sie so jung machte und sah
zu dem kleinen, runden Bild hinüber, das auf ihrem Schreibtisch stand.
„Und unsere stille, holde Freundschaft, Hans Wied, ich weiß nicht, ob wir
tauschten! Der Staub des Alltags hat uns nichts getan! Es sind liebe, kleine
Feierstunden, w'enn er komnit. Soviele Jahre schon schenken wir sie einander.
Und was ich geworden bin, Elisabeth, und was ich kann, all das Tiefe und Feine,
das die Menschen an meinen stillen Geschichten so lieben, das ist in diesen
schönen Stunden geboren. Ich möchte immer „Hans Wied“ darunter schreiben,
wenn mir etwas so recht gelungen ist. Es ist nicht meins, es ist nicht seins, es
ist etwas Gemeinsames. Der Mann, den wir lieben, formt uns selbst und unser
Schicksal.“
Eine Weile saßen die beiden still, dann fuhr Johanna Heyden fort, leise, als
spräche sie zu sich selbst: „Wir sind ja so verschieden, Mann und Weib! Die
Seelen so verschieden wie die Körper. Wo sie nicht durchfindet, zeigt er einfach
den Weg. Was er nicht hat, sie kann es ihm geben. Er ist stärker, sie sieht
weiter. Er weiß es, was sie fühlt. Er ist ldarer und gerechter, sie ist gütiger
und milder. Gott schuf uns so, ihn größer, sie feiner. Da sind Kräfte und
Wirkungen, die ein Ganzes geben, und es kann nichts vollkommen sein, an dem
nicht beide teil haben. So schenken sie einander tausend schöne Dinge!-“
Das blasse Mäd-
chen hob den feinen
Kopf und sah Johanna
Heyden staunend an.
„Sollte so nicht
jede E’ne sein, Tante
Johanna?“
„Sie sollten wohl
so sein, aber wenige
gibt es, die um all das
Schöne wissen. Und sie
achten es nicht hoch
genug. Der Staub des
Alltags kommt und legt
sicli auf die zarten Blü-
ten Man gibt vielleicht
erst zuviel und hat
nachher nichts mehr.
Was ist eine Ehe ohne
diese Freundschaft?
Nichts! Kein Erdreich,
aus dem soviel Schönes
wachsen kann!“ —
ELisabeth sah trotz
derDämmerung wieder
den warmen Glanz in
Johannas Augen, den
Glanz, der ihr alle Her-
zen gewann, vielleicht
weil er von der reichen
Liebe spräch, die in ihr
wohnte. Elisabeth emp-
fand den Charme, den
Zauber der schlichten,
harmonischen Gestalt.
„Tante Johanna,
warum hat Professor
Wied dich nur nicht
geheiratet?“
So echt mädchen-
haft kam die Frage
heraus.
Die Dichterin lä-
chelte. „ Geheiratet?
Ach, kleine Liesbeth!
Das muß doch nicht
sein! Unsere Neigun-
gen sind nicht immer
vereinbar mit unsern
Wünschen, danachhabe
ich ihn nicht lange
gefragt. Und mir ist es lieber, als wenn ich nachher hätte fühlen sollen,
daß er Dinge entbehrte, die ich ihm nicht geben konnte, die ihm aber un-
entbehrlich schienen. Nein, Kind, danach habe ich nicht lange gefragt. Aber
warum er mich verließ, warum er mir seine Freundschaft nicht geben wollte,
darüber zerbrach ich mir den Kopf Nacht und Tag. Ich habe ihm doch
nichts getan, ich war doch immer gut zu ihm gewesen, und er hatte mich doch
gern! Ach, Elisabeth, um das, was dir Iiorst Bodemer so treu und herzlich bietet,
daruin habe ich kämpfen müssen, jahrelang. Vielleicht hat er damals gedacht,
wie du! hat gedacht, daß es ein armselig Ding sei, jemandem Freundschaft zu
geben, der Liebe gewollt. Vielleicht auch, wie viele Menschen denken, daß es
nicht möglich sei! Das ist aber ein Mangel an Vertrauen. —
Die Welt denkt freilich so! Aber was für eine Welt!“ — — ---
„Tante Johanna, du warst doch damals noch fünfzehn Jahre jünger, wie heut!
Das hast du gekonnt, ich meine, die stille Freundschaft hast du dir wünschen
können?“ —
„Ja, das habe ich gekonnt! Gott sei Dank! Sogar noch mitten im Kampf !
Ich ahnte wohl, daß sie mir den Frieden bringen müßte nach meiner Wesensart.
Aber sie brachte mir ja noch mehr!“
Johanna Heydens dunkle Augen glitten durch die weiche Dämmerung nach
dem Bücherschrank, wo hinter der seidenen Gardine ihre Werke standen.
„Das freilich, das wußte ich damals noch nicht. Das ist mir erst später
aufgegangen. Nein, damals wollte ich, daß er sich um mich sorgt, damit ich
wieder an ihn glauben konnte. Weißt du noch, wie wir neulich vor die Stadt
gingen, Elisabeth? Da sahen wir, wie ein Automobil jemanden überfuhr. Der
Mann, der das Fahrzeug lenkte, hat es nicht mit Absicht getan. Daß er es tat,
war gewiß nicht schlecht von ihm. Aber daß er vorüberfuhr, daß er nicht blieb
und dem Armen helfen wollte, sich nicht darum kümmerte, was daraus wurde!
Es gibt viele Menschen in der Welt, die so vorüberfahren an dem, was durch
sie geschah! Vorbei-
fahren — nichts sehen,
— sich ablenken! —
Das ist ja so bequem,
und Männer haben das
so leicht.
Wie Hans Wied da-
mals vor langen Jaliren
an mir vorbeiging, wie
er mir auswich und
nicht kam, zu sehen,
ob ich’s tragen könnte,
da war ich traurig wie
niezuvor! Warerdenn
so schlecht, daß ihm
das gleich war? Oder
verstand er michnicht?
Wußte er nicht, warum
ich sein Kommen so
wünschte? Ach, wir
Frauen sind ja so un-
säglich stolz auf das,
was wir lieben. Auch
dann noch, wenn wir
geüebt haben und wie-
der ruhig sind. Nur
keinen Fehler an ihm
finden, keineSchwäche.
Denn sonst schämen
wir uns vor uns selber.
Und das tut so bitter
weh! Ihn achten kön-
nen ist uns lieber als
ihn besitzen! Er soll
es wert sein, daß wir
ihn so lieb hatten. Dann
tragen wir alles.
War Hans Wied es
wert? Er kam nicht
gleich, aber später! Als
er fühlte, daß es mir
wohltat, als er endlich
einsah, wie herrlich
solch eine Freundschaft
sein kann, kam er wie-
der. Als er wußte, daß
er etwas zu geben
hatte, gab er, gab viel
und reich und machte
damit alles wieder gut.
Dann hat er gelernt,
John Collier: Ein verlorenes Ideal.
3U
Elisabeth, ich war nicht immer so still wie heut! Ich habe sie beneidet, ich
habe geweint, wie du! Ich habe mit dem Leben gehadert, mit dem Schicksal,
mit meinem Gott! Sie durften das Glück haben, sie alle! Warum sie denn
besser wie ich, oder nur schöner? Nein! Und doch!
Wenn ich nun heute nach bald ftinfzehn Jahren so manche von diesen Ehen
sehe! Wie sind sie so leer geworden im Laufe derZeit! So manches fehlt, was
man sicher glaubte nicht entbehren zu können! So manches Sc.höne und Edle,
sogar die Höflichkeit, die Rücksicht! Die Menschen sind einander so ge-
wöhnt!-“
Johanna lächelte wieder das feine Lächeln, das sie so jung machte und sah
zu dem kleinen, runden Bild hinüber, das auf ihrem Schreibtisch stand.
„Und unsere stille, holde Freundschaft, Hans Wied, ich weiß nicht, ob wir
tauschten! Der Staub des Alltags hat uns nichts getan! Es sind liebe, kleine
Feierstunden, w'enn er komnit. Soviele Jahre schon schenken wir sie einander.
Und was ich geworden bin, Elisabeth, und was ich kann, all das Tiefe und Feine,
das die Menschen an meinen stillen Geschichten so lieben, das ist in diesen
schönen Stunden geboren. Ich möchte immer „Hans Wied“ darunter schreiben,
wenn mir etwas so recht gelungen ist. Es ist nicht meins, es ist nicht seins, es
ist etwas Gemeinsames. Der Mann, den wir lieben, formt uns selbst und unser
Schicksal.“
Eine Weile saßen die beiden still, dann fuhr Johanna Heyden fort, leise, als
spräche sie zu sich selbst: „Wir sind ja so verschieden, Mann und Weib! Die
Seelen so verschieden wie die Körper. Wo sie nicht durchfindet, zeigt er einfach
den Weg. Was er nicht hat, sie kann es ihm geben. Er ist stärker, sie sieht
weiter. Er weiß es, was sie fühlt. Er ist ldarer und gerechter, sie ist gütiger
und milder. Gott schuf uns so, ihn größer, sie feiner. Da sind Kräfte und
Wirkungen, die ein Ganzes geben, und es kann nichts vollkommen sein, an dem
nicht beide teil haben. So schenken sie einander tausend schöne Dinge!-“
Das blasse Mäd-
chen hob den feinen
Kopf und sah Johanna
Heyden staunend an.
„Sollte so nicht
jede E’ne sein, Tante
Johanna?“
„Sie sollten wohl
so sein, aber wenige
gibt es, die um all das
Schöne wissen. Und sie
achten es nicht hoch
genug. Der Staub des
Alltags kommt und legt
sicli auf die zarten Blü-
ten Man gibt vielleicht
erst zuviel und hat
nachher nichts mehr.
Was ist eine Ehe ohne
diese Freundschaft?
Nichts! Kein Erdreich,
aus dem soviel Schönes
wachsen kann!“ —
ELisabeth sah trotz
derDämmerung wieder
den warmen Glanz in
Johannas Augen, den
Glanz, der ihr alle Her-
zen gewann, vielleicht
weil er von der reichen
Liebe spräch, die in ihr
wohnte. Elisabeth emp-
fand den Charme, den
Zauber der schlichten,
harmonischen Gestalt.
„Tante Johanna,
warum hat Professor
Wied dich nur nicht
geheiratet?“
So echt mädchen-
haft kam die Frage
heraus.
Die Dichterin lä-
chelte. „ Geheiratet?
Ach, kleine Liesbeth!
Das muß doch nicht
sein! Unsere Neigun-
gen sind nicht immer
vereinbar mit unsern
Wünschen, danachhabe
ich ihn nicht lange
gefragt. Und mir ist es lieber, als wenn ich nachher hätte fühlen sollen,
daß er Dinge entbehrte, die ich ihm nicht geben konnte, die ihm aber un-
entbehrlich schienen. Nein, Kind, danach habe ich nicht lange gefragt. Aber
warum er mich verließ, warum er mir seine Freundschaft nicht geben wollte,
darüber zerbrach ich mir den Kopf Nacht und Tag. Ich habe ihm doch
nichts getan, ich war doch immer gut zu ihm gewesen, und er hatte mich doch
gern! Ach, Elisabeth, um das, was dir Iiorst Bodemer so treu und herzlich bietet,
daruin habe ich kämpfen müssen, jahrelang. Vielleicht hat er damals gedacht,
wie du! hat gedacht, daß es ein armselig Ding sei, jemandem Freundschaft zu
geben, der Liebe gewollt. Vielleicht auch, wie viele Menschen denken, daß es
nicht möglich sei! Das ist aber ein Mangel an Vertrauen. —
Die Welt denkt freilich so! Aber was für eine Welt!“ — — ---
„Tante Johanna, du warst doch damals noch fünfzehn Jahre jünger, wie heut!
Das hast du gekonnt, ich meine, die stille Freundschaft hast du dir wünschen
können?“ —
„Ja, das habe ich gekonnt! Gott sei Dank! Sogar noch mitten im Kampf !
Ich ahnte wohl, daß sie mir den Frieden bringen müßte nach meiner Wesensart.
Aber sie brachte mir ja noch mehr!“
Johanna Heydens dunkle Augen glitten durch die weiche Dämmerung nach
dem Bücherschrank, wo hinter der seidenen Gardine ihre Werke standen.
„Das freilich, das wußte ich damals noch nicht. Das ist mir erst später
aufgegangen. Nein, damals wollte ich, daß er sich um mich sorgt, damit ich
wieder an ihn glauben konnte. Weißt du noch, wie wir neulich vor die Stadt
gingen, Elisabeth? Da sahen wir, wie ein Automobil jemanden überfuhr. Der
Mann, der das Fahrzeug lenkte, hat es nicht mit Absicht getan. Daß er es tat,
war gewiß nicht schlecht von ihm. Aber daß er vorüberfuhr, daß er nicht blieb
und dem Armen helfen wollte, sich nicht darum kümmerte, was daraus wurde!
Es gibt viele Menschen in der Welt, die so vorüberfahren an dem, was durch
sie geschah! Vorbei-
fahren — nichts sehen,
— sich ablenken! —
Das ist ja so bequem,
und Männer haben das
so leicht.
Wie Hans Wied da-
mals vor langen Jaliren
an mir vorbeiging, wie
er mir auswich und
nicht kam, zu sehen,
ob ich’s tragen könnte,
da war ich traurig wie
niezuvor! Warerdenn
so schlecht, daß ihm
das gleich war? Oder
verstand er michnicht?
Wußte er nicht, warum
ich sein Kommen so
wünschte? Ach, wir
Frauen sind ja so un-
säglich stolz auf das,
was wir lieben. Auch
dann noch, wenn wir
geüebt haben und wie-
der ruhig sind. Nur
keinen Fehler an ihm
finden, keineSchwäche.
Denn sonst schämen
wir uns vor uns selber.
Und das tut so bitter
weh! Ihn achten kön-
nen ist uns lieber als
ihn besitzen! Er soll
es wert sein, daß wir
ihn so lieb hatten. Dann
tragen wir alles.
War Hans Wied es
wert? Er kam nicht
gleich, aber später! Als
er fühlte, daß es mir
wohltat, als er endlich
einsah, wie herrlich
solch eine Freundschaft
sein kann, kam er wie-
der. Als er wußte, daß
er etwas zu geben
hatte, gab er, gab viel
und reich und machte
damit alles wieder gut.
Dann hat er gelernt,
John Collier: Ein verlorenes Ideal.