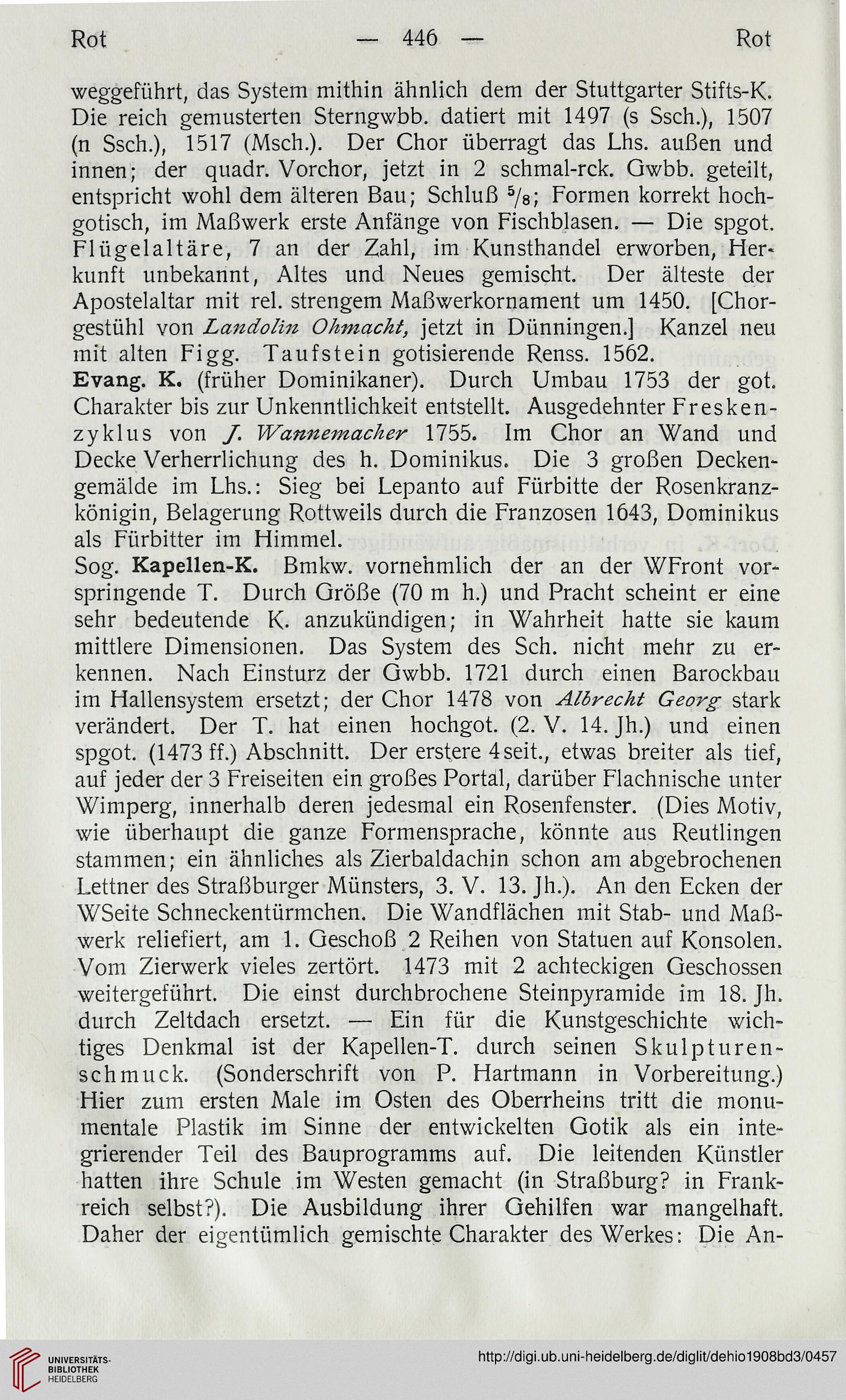- Einband
- Karte
- Titelblatt
- III-V Vorwort
- VI-VII Verzeichnis der Abkürzungen
-
1-46
Aalen – Aying
- Aalen
- Abenberg
- Abensberg
- Abstatt
- Abtsdorf
- Abtsgmünd
- Achalm
- Achberg
- Achstetten
- Adelberg
- Seubersdorf
- Adelmannsfelden
- Adelsheim
- Adldorf
- Adlersberg
- Adolzhausen
- Adolzfurt
- Äpfingen
- Affalterbach
- Agatharied
- Aggenhausen
- Aglasterhausen
- Ahausen
- Bad Aibling
- Aich
- Aichach
- Riedenburg
- Peißenberg
- Aidenbach
- Aidlingen
- Aign
- Ailringen
- Ainau
- Airischwand
- Aising
- Alterhofen
- Altmannstein
- Aitrach
- Albaching
- Albershausen
- Albertaich
- Aldersbach
- Aldingen
- Alfeld (Leine)
- Algertshausen
- Allensbach
- Allerheiligen
- Allersberg
- Allersdorf
- Alling
- Allmannshausen
- Allmendingen
- Alpirsbach
- Altburg
- Altbulach
- Altdorf
- Altdorf
- Altdorf
- Altdürnbuch
- Alteglofsheim
- Altenburg
- Altenerding
- Altessing
- Altenfurt
- Altenhohenau
- Altenmuhr (Muhr am See)
- Altenschwand
- Altenstadt an der Waldnaab
- Altenstadt
- Altenstadt bei Vohenstrauß
- Altenstadt
- Altensteig
- Altensteig
- Altentreswitz
- Altenveldorf
- Vilseck
- Altfalter
- Altfalterbach
- Donaualtheim
- Altheim
- Altheim
- Althengstett
- Altkrautheim
- Altmannshofen
- Altmühldorf
- Altomünster
- Altötting
- Altshausen
- Alzgern
- Amberg
- Ammelbruch
- Amerang
- Ammerthal
- Amperpettenbach
- Ampermoching
- Ampfing
- Amrichshausen
- Amstetten
- Amtzell
- Kloster Andechs
- Anger
- Anhäuser Mauer
- Anhausen
- Ansbach
- Antdorf
- Antwort
- Anzenberg
- Appersdorf
- Arberg
- Arbing
- Archshofen
- Arget
- Arlen
- Arnach
- Arnbach
- Arnbruck
- Arnhofen
- Arrach
- Artelshofen
- Arth
- Arzbach
- Asbach
- Asbach
- Asch
- Aschau im Chiemgau
- Asperg
- Aspertsham
- Asselfingen
- Aßmannshardt
- Ast
- Asten
- Attaching
- Attel
- Attenfeld
- Attenhausen
- Attenhofen
- Atzlricht
- Au
- Aubing
- Auburg
- Auchsesheim
- Auerbach
- Auerberg
- Aufham
- Aufhausen
- Aufkirchen
- Aufkirchen
- Augsburg
- Auhausen
- Aulendorf
- Alzhausen
- Aunberg
- Autenried
- Aying
-
47-83
Babenhausen – Buxheim
- Babenhausen
- Bachhaupten
- Bächlingen
- Backnang
- Baierbach
- Baiersbronn
- Baiersdorf
- Baindt
- Baitenhausen
- Baldern
- Balgheim
- Balingen
- Ballenberg
- Ballendorf
- Ballmertshofen
- Baltringen
- Bartenstein
- Bartholomä
- Batzenhofen
- Baumburg
- Baumerlenbach
- Bayrischzell
- Bebenhausen
- Bechthal
- Beckstetten
- Beyharting
- Beihingen
- Beihingen
- Beilngries
- Beilstein
- Beimerstetten
- Beinberg
- Bellamont
- Belsen
- Benediktbeuern
- Benningen am Neckar
- Beratzhausen
- Berbling
- Berching
- Berchtesgaden
- Berg im Gau
- Berg am Laim
- Berg am Starnberger See
- Bad Griesbach im Rottal
- Ravensburg
- Berganger
- Bergen
- Bergertshofen
- Bergfelden
- Bergham
- Berghaselbach
- Bergheim
- Bergheim
- Berghofen
- Berghofen
- Berghülen
- Bergkirchen
- Berkheim
- Berlichingen
- Bermaringen
- Bidingen
- Berneck
- Bernhardsweiler
- Bernhausen
- Bernried am Starnberger See
- Bernstadt
- Bernstein
- Bernstein
- Bertoldsheim
- Bertoldshofen
- Besigheim
- Bettbrunn
- Betzingen
- Beuerberg
- Beuern
- Beuren
- Beuron
- Biberach an der Riß
- Biberbach
- Biberbach, Markt
- Biburg
- Bichl
- Bickelsberg
- Bidingen
- Bierdorf
- Bierlingen
- Bieselbach
- Biesenhard
- Bildechingen
- Billigheim
- Binabiburg
- Binau
- Bingen
- Binningen
- Birenbach
- Birkach
- Birkenfeld
- Birkenstein
- Bad Birnbach
- Bietigheim-Bissingen
- Bissingen
- Bittelschieß
- Bittenfeld
- Bitz
- Ruine Blankenhorn
- Blaubeuren
- Blaufelden
- Blienshofen
- Blumenfeld
- Blumental
- Schloß Blutenburg
- Bobingen
- Böblingen
- Bodenmais
- Bodenstein
- Bödigheim
- Bodman-Ludwigshafen
- Bogen
- Böhmischbruck
- Boll
- Bad Boll
- Bollstadt
- Bondorf
- Bonfeld
- Bonlanden auf den Fildern
- Bonndorf
- Bönnigheim
- Bopfingen
- Botenheim
- Böttingen
- Boxberg
- Boxtal
- Brackenheim
- Seeon
- Bräunlingen
- Braunsbach
- Breitenau
- Breitenbrunn
- Breitenegg
- Breitenholz
- Brennberg
- Heidenheim an der Brenz
- Brettach
- Brochenzell
- Bronnbach
- Waal
- Bronnweiler
- Bruck
- Bruck
- Bruck
- Bruck i.d. OPf.
- Bruckberg
- Bubach
- Bubenorbis
- Buch
- Heubach
- Bad Buchau
- Buchbach
- Buchen in Odenwald
- Buchenbach
- Buchenberg
- Buchenberg
- Buggenhofen
- Bühl
- Buoch
- Laufen (Salzach)
- Burgau
- Bürgberg
- Burgberg
- Burgfarrnbach
- Burgfelden
- Burghausen
- Burglengenfeld
- Burgbernheim
- Burggen
- Burghaslach
- Burgheim
- Burghof
- Burgkirchen am Wald
- Burgoberbach
- Burgstall
- Burgweiler
-
83-100
Dachau – Duttenstein
- Burleswagen
- Büsingen am Hochrhein
- Burtenbach
- Buttenhausen
- Buxheim
- Dachau
- Dagersheim
- Dainbach
- Dallau
- Danketsweiler
- Dasing
- Daßwang
- Ruine Dauchstein
- Daugendorf
- Dautmergen
- Dechantsreit
- Degenfeld
- Degerndorf
- Deggendorf
- Mönchsdeggingen
- Deggingen
- Deilingen
- Deiningen
- Deinting
- Deisenhofen
- Deißlingen
- Deizisau
- Dellmensingen
- Dengling
- Denkendorf
- Denklingen
- Derdingen
- Derendingen
- Schloß Derneck
- Dertingen
- Dettendorf
- Dettensee
- Dettingen unter Teck
- Dettingen an der Erms
- Dettingen
- Dettingen
- Dettingen
- Detwang
- Deubach
- Deubach
- Deuchelried
- Deusmauer
- Deutenhausen
- Deutenkofen
- Dewangen
- Diefenbach
- Diepoldsberg
- Dießen
- Dießen am Ammersee
- Dießfurt
- Dietelskirchen
- Dietenheim
- Dietenhofen
- Dietersburg
- Dietfurt
- Unterdietfurt
- Dietingen
- Dietingen
- Dietldorf
- Dietramszell
- Dietring
- Dillingen an der Donau
- Dinau
- Dingelsdorf
- Dingolfing
- Dinkelsbühl
- Dinkelscherben
- Dirgenheim
- Dischingen
- Distelhausen
- Dittigheim
- Dittwar
- Ditzingen
- Döffingen
- Dollnstein
- Donaualtheim
- Donaueschingen
- Donaustauf
- Donaustetten
- Donauwörth
- Donzdorf
- Döpshofen
- Dorfen
- Dörfling
- Dörlesberg
- Dornach
- Dörndorf
- Dornhan
- Dornstadt
- Dornstetten
- Dörzbach
- Dösingen
- Döttenberg
- Drackenstein
- Vilsbiburg
- Druisheim
- Dunningen
- Dunstelkingen
- Düren
- Dürnau
- Dürrenmungenau
- Dürrlauingen
- Dürrmenz
- Dürrwangen
- Dußlingen
-
100-125
Ebenhofen – Eybach
- Duttenberg
- Dischingen
- Ebenhofen
- Eberdingen
- Eberhardzell
- Eberharting
- Ebering
- Ebermannsdorf
- Ebermergen
- Ebersberg
- Ebersberg
- Eberstadt
- Eberswang
- Ebingen
- Ebrach
- Eching
- Eching
- Echterdingen
- Ecksberg
- Edelstetten
- Effringen
- Efrizweiler
- Egenhofen
- Egern
- Egesheim
- Eggenfelden
- Eggingen
- Egglfing
- Eggmannsried
- Egling
- Egling
- Eglosheim
- Egmating
- Ehingen an der Donau
- Ehingen
- Eholfing
- Ruine Alt Ehrenfels
- Ruine Ehrenfels
- Eibensbach
- Eich
- Eichel
- Eichlberg
- Eichstätt
- Eichstätt
- Einharting
- Einsbach
- Einsingen
- Eisenburg
- Pfreimd
- Elbach
- Elchingen
- Eldratshofen
- Ellingen
- Ellwangen
- Elpersheim
- Elsenbach
- Eltershofen
- Eltingen
- Emerfeld
- Emertsham
- Emhof
- Emmenhausen
- Emmingen ab Egg
- Emskirchen
- Weinstadt-Endersbach
- Engelbrechtsmünster
- Engelhardshausen
- Englmeng
- Engelsberg
- Engelsried
- Engen
- Engertsham
- Englschalling
- Engstlatt
- Eningen
- Ennetach
- Ensdorf
- Ensingen
- Parsberg
- Rednitz
- Entringen
- Enzelhausen
- Enzweihingen
- Eppisburg
- Erbach
- Erbendorf
- Erding
- Erdmannhausen
- Ergolding
- Erharting
- Ering
- Eriskirch
- Erlach
- Erlangen
- Erlstätt
- Erolzheim
- Ersingen
- Eschach
- Eschlbach
- Wolframs-Eschenbach
- Eschenbach in der Oberpfalz
- Eschenlohe
- Eslarn
- Esseratsweiler
- Essingen
- Esslingen am Neckar
- Ettal
- Ettelried
- Ettenberg
- Ettenbeuren
- Ettendorf
- Ettlenschieß
- Ettling
- Ettmannsdorf
- Ettringen
- Etzenricht
- Euernbach
- Eulenried
- Gamburg
-
125-139
Fachsenfeld – Füssen
- Eurasburg
- Eurishofen
- Eutingen
- Eybach
- Fachsenfeld
- Fahrenberg
- Faistenhaar
- Falkenberg
- Falkenstein
- Faurndau
- Feichten
- Feldkirchen
- Feldkirchen
- Laufen (Salzach)
- Wasserburg am Inn
- Vilsbiburg
- Feldmoching
- Fellbach
- Felldorf
- Feuerbach
- Feuchtwangen
- Finsing
- Finsterlohr
- Fischach
- Fischbach
- Fischbach
- Fischbachau
- Fischhausen
- Flachslanden
- Flein
- Flochberg
- Floß
- Flossenbürg
- Fluorn
- Föching
- Forchtenberg
- München
- Frankenbach
- Schloss Frankenberg
- Fränkendorf
- Frauenaurach
- Frauenberg
- Frauenbründl
- Frauenchiemsee
- Frauenhaarbach
- Frauenried
- Frauensattling
- Frauental
- Frauentödling
- Frauenzell
- Frauenzimmern
- Fraunberg
- München-Freimann
- Freising
- Freystadt
- Freudenberg
- Freudenstadt
- Freudental
- Freudental
- Frickenhausen
- Frickingen
- Fridingen an der Donau
- Fridolfing
- Friedberg
- Friedersried
- Friedrichshafen
- Friesheim
- Frischeck
- Fronau
- Fronberg
- Frontenhausen
- Froschhausen
- Fuhrn
- Fürfeld
- Fürstenfeldbruck
- Fürstenzell
- Fürth
- Fürth
- Füssen
-
140-167
Gabelbach – Guttenburg
- Gabelbach
- Gabelbachergreut
- Gachenbach
- Gaden
- Gaildorf
- Gailenkirchen
- Gaindorf
- Gaisbeuren
- Gambach
- Gamburg
- Gammesfeld
- Grampersdorf
- Ganacker
- Gannertshofen
- Garmisch-Partenkirchen
- Gärtringen
- Gasseltshausen
- Gauting
- Gebelkofen
- Gechingen
- Pfarrkirchen
- Geibenstetten
- Deggendorf
- Ruine Wachtenburg
- Geilertshausen
- Geisenfeld
- Geisenfeldwinden
- Geisenhausen
- Geisenhausen
- Geisingen
- Geislingen
- Geislingen an der Steige
- Gelbersdorf
- Gelting
- Geltolfing
- Gemmrigheim
- Georgenberg
- Georgenried
- Gerabronn
- Geradstetten
- Geratskirchen
- Eggenfelden
- Gerlachsheim
- Gerlingen
- Geroldseck
- Gerstetten
- Oberdorf
- Gerzen
- Schloss Gessenberg
- Gestratz
- Geyern
- Giengen an der Brenz
- Giggenhausen
- Gilching
- Gingen an der Fils
- Glashütte
- Glatt
- Glatten
- Glon
- Glött
- Schwäbisch Gmünd
- Gmund am Tegernsee
- Gnadenberg
- Gnadental
- Bad Gögging
- Göggingen
- Goldbach
- Goldbach
- Goldburghausen
- Gollenshausen am Chiemsee
- Gollhofen
- Gommersdorf
- Göppingen
- Gosheim
- Gossenhofen
- Gößlingen
- Gotteszell
- Gottfrieding
- Göttingen
- Gottmadingen
- Gottsdorf
- Götzingen
- Grabenstetten
- Grafenau
- Gräfenberg
- Grafentraubach
- Grafertshofen
- Grafing
- Grafing Bahnhof
- Grafing bei München
- Grafrath
- Grassau
- Grattersdorf
- Greding
- Bad Griesbach im Rottal
- Untergriesbach
- Griesstetten
- Grimmelfingen
- Grimoldsried
- Bad Grönenbach
- Gröningen
- Großaitingen
- Großaltdorf
- Großanhausen
- Großbottwar
- Großeicholzheim
- Großenried
- Großgartach
- Großglattbach
- Großgründlach
- Großhabersdorf
- Großheppach
- Großingersheim
- Bad Griesbach im Rottal
- Großkitzighofen
- Schloß Comburg
- Großkötz
- Großlellenfeld
- Großohrenbronn
- Großsachsenheim
- Großschönbrunn
- Großschwindau
- Grünau
- Grunbach
- Gründelhardt
- Grüningen
- Grünsfeld
- Grünsfeldhausen
- Grünsink
- Grünthal
- Grüntal
- Grüntegernbach
- Grünwald
- Gruorn
- Gültlingen
- Gültstein
- Gummering
- Gumpersdorf
- Günching
- Gundelfingen
- Gundelsheim
- Gundhöring
- Guntersberg
- Günzburg
- Günzlhofen
-
167-201
Haag – Hüttisheim
- Gunzenhausen
- Guteneck
- Gutenzell
- Guttenburg
- Haag in Oberbayern
- Haag an der Amper
- Haag
- Haar
- Habach
- Haberschlacht
- Habsberg
- Habsthal
- Hagenbüchach
- Hagenheim
- Hagnau
- Hahnbach
- Haid
- Haidstein
- Haigerloch
- Hailfingen
- Hailing
- Haimhausen
- Haiming
- Haimpertshofen
- Haindling
- Hainsbach
- Hainhof
- Hainhofen
- Haisterkirch
- Deggendorf
- Halfing
- Happing
- Haldenwang
- Schwäbisch Hall
- Hallthurm
- Halsbach
- Hangenham
- Harburg
- Harthausen auf der Scheer
- Hartheim
- Hartkirchen
- Haselbach
- Haselbach
- Haselbach
- Haselbach
- Haslach
- Hatzelsdorf
- Haubersbronn
- Haunertsholzen
- Haunsbach
- Haunshofen
- Haunstetten
- Haunwang
- Hausbach
- Hausen im Tal
- Hausen an der Zaber
- Hausen
- Neumarkt in der Oberpfalz
- Hausen ob Lontal
- Hausheim
- Haunzenbergersöll
- Hayingen
- Hebrontshausen
- Hebsack
- Hechendorf
- Hechingen
- Hedelfingen
- Heerberg
- Hegnach
- Hegne
- Heidenheim
- Heidenheim an der Brenz
- Heilbronn
- Heilbrünnl
- Heilig Blut
- Heiligenberg
- Fürstenzell
- Heiligenstadt
- Gangkofen
- Heiligenstadt
- Altötting
- Traunstein
- Heiligkreuz
- Heiligkreuztal
- Ruine Heilsberg
- Heilsbronn
- Haimburg
- Heimen
- Heimsheim
- Heiningen
- Heinsheim
- Heinstetten
- Heimsheim
- Helfenberg
- Hellring
- Hellsberg
- Hallwangen
- Hemau
- Hemmendorf
- Hemmingen
- Henfenfeld
- Hengersberg
- Hepberg
- Herbertingen
- Herbertshofen
- Herbolzheim
- Herbrechtingen
- Herdwangen-Schönach
- Heretshausen
- Heroldsberg
- Bad Herrenalb
- Herrenberg
- Schloss Herrenchiemsee
- Herrenzimmern
- Herrieden
- Hersbruck
- Herzogau
- Herzogenaurach
- Heselbach
- Hessellohe
- Hessental
- Hessigheim
- Hettingen
- Hetzenbach
- Heubach
- Heuchlingen
- Heuchlingen
- Heudorf am Bussen
- Heudorf bei Mengen
- Heutingsheim
- Heuwinkl
- Schloss Hexenagger
- Hildrizhausen
- Hilgartsberg
- Hilgartshausen
- Hilgertshausen-Tandern
- Hilpoltstein
- Hiltenfingen
- Hiltensweiler
- Bad Hindelang
- Hirblingen
- Hirnsberg
- Hirsau
- Eichstätt
- Hirschau
- Hirschlatt
- Hirschzell
- Hochhausen
- Höchstädt an der Donau
- Hof
- Hof am Regen
- Hofhegnenberg
- Hoflach
- Högling
- Höglwörth
- Schloss Hohenaschau
- Hohenberg
- Höhenberg
- Höhenberg
- Hohenburg
- Hohenfels
- Hohenfels
- Hohenfreyberg
- Hohenfurch
- Ruine Hohengundelfingen
- Hohenheim
- Hohenhewen
- Hohenkammer
- Hohenlinden
- Hohennagold
- Hohenpeißenberg
- Hohenrechberg
- Hohenschäftlarn
- Hohenschambach
- Hohenstadt
- Bad Höhenstadt
- Hohentann
- Hohentengen
- Singen (Hohentwiel)
- Ruine Hohenwaldeck
- Hohenwart
- Hohenwart
- Hohenzell
- Hohenzollern
- Höherskirchen
- Holzen
- Holzgerlingen
- Holzgünz
- Holzheim
- Holzkirch
- Holzkirchen
- Holztraubach
- Homburg
- Hondingen
- Honhardt
- Höpfingen
- Hoppingen
- Horb am Neckar
- Hörgersdorf
- Hörmanshofen
- Horn
- Hornberg
- Horrheim
- Höselhurst
- Huckenham
- Hüfingen
- Huglfing
-
201-213
Jagstberg – Jungingen
- Hundheim
- Hurlach
- Hittenkirchen
- Hüttisheim
- Jagstberg
- Jagsthausen
- Jagstheim
- Jagstzell
- Ichenhausen
- Icking
- Jebenhausen
- Jengen
- Jettenstetten
- Jettingen-Scheppach
- Iggensbach
- Ilbling
- Ilgen
- Ilmendorf
- Illerrieden
- Illertissen
- Illkofen
- Ilmmünster
- Ilmspan
- Ilsenbach
- Ilsfeld
- Imberg
- Immenhausen
- Immenstaad am Bodensee
- Imming
- Impfingen
- Inchenhofen
- Markt Indersdorf
- Pocking
- Ingelfingen
- Ingenried
- Ingersheim
- Ingolstadt
- Inkofen
- Innerthann
- Inning am Ammersee
- Inningen
- Inzigkofen
- Johannesbergham
- Johannishögl
- Johanneskirchen
- Iphofen
- Ippesheim
- Irfersdorf
- Irschenhausen
- Irsee
- Ischl
- Isen
- Isingen
- Ismaning
- Isny im Allgäu
- Ittelsburg
- Ittendorf
-
213-246
Kaisheim – Kusterdingen
- Itzling
- Jungingen
- Kaisheim
- Kalbensteinberg
- Kalchreuth
- Kallmünz
- Calw
- Kammern
- Bad Cannstatt
- Kapfenburg
- Kappl
- Kastl
- Karlstein
- Karpfham
- Kastl
- Katharinenberg
- Katzenstein
- Katzdorf
- Katzwang
- Kaufbeuren
- Kaufering
- Laufen (Salzach)
- Kay
- Keferloh
- Kelheim
- Kellberg
- Kemnat
- Kemnath
- Kempfenhausen
- Kempfing
- Kempten
- Kentheim
- Kerkingen
- Ketterschwang
- Cham
- Chamerau
- Chameregg
- Chammünster
- Christgarten
- Kiebingen
- Kiefer
- Kilchberg
- Kinding
- Kinsau
- Schloß Kirchberg
- Kirchberg
- Kirchberg an der Jagst
- Kirchberg
- Kirchberg
- Kirchberg (Hunsrück)
- Heldenstein
- Kirchdorf
- Kirchdorf am Inn
- Kirchdorf an der Amper
- Kirchdorf
- Eiselfing
- Kirchenbuch
- Kirchendemenreuth
- Hohenfels
- Kirchentellinsfurt
- Kirchhalling
- Kirchham
- Kirchhaslach
- Kirchhausen
- Kirchheim
- Kirchheim bei München
- Kirchheim am Ries
- Kirchheim am Neckar
- Kirchheim unter Teck
- Kirchloibersdorf
- Kirchseeon
- Kirchensittenbach
- Kirchstätt
- Kirchstetten
- Kirchweidach
- Kipfenberg
- Kissing
- Kißlegg
- Klapfenberg
- Klardorf
- Cleebronn
- Kleinberghofen
- Kleinbottwar
- Eislingen/Fils
- Kleingartach
- Kleingundertshausen
- Kleinhelfendorf
- Kleiningersheim
- Kleincomburg
- Kleinmehring
- Cleversulzbach
- Klimmach
- Klosterbeuren
- Walchensee
- Klosterlechfeld
- Klosterwald
- Klosterzimmern
- Knittlingen
- Knöringen
- Kobel
- Kochendorf
- Kocherstetten
- Kochel
- Köfering
- Kolbing
- Kollnburg
- Colmberg
- Schloß Comburg
- Köngen
- Königheim
- Königsdorf
- Bahnhof Hoßkirch-Königsegg
- Königseggwald
- Lauda-Königshofen
- Königshofen auf der Heide
- Konstanz
- Koppenwall
- Kornburg
- Kornwestheim
- Korona
- Kösingen
- Kößlarn, Markt
- Kottingwörth
- Kötzing
- Kraiburg am Inn
- Krailing
- Crailsheim
- Kranzberg
- Krautheim
- Kreenheinstetten
- Creglingen
- Kreuth
- Ebersberg
- Berlin-Kreuzberg
- Kreuzhof
- Kreuzpullach
- Kronburg
- Krumbach
- Krumbach
- Krumbach
- Kuchen
- Kühbach
- Külsheim
- Ramsau
- Künzelsau
- Kupferzell
- Kuppingen
- Kürnbach
- Roding
- Küssaberg
-
246-266
Laaber – Lutzingen
- Kusterdingen
- Kutzenhausen
- Laaber
- Laaber
- Laim
- Laimnau
- Laiz
- Landau an der Isar
- Landershofen
- Landsberg am Lech
- Landsham
- Landshut
- Landstetten
- Langenargen
- Langenau
- Langenbeutingen
- Langenburg
- Langerringen
- Langenenslingen
- Langenstein
- Langweid am Lech
- Langwinkl
- Lanzing
- Lappach
- Laubach
- Lauda-Königshofen
- Laudenbach
- Lauffen am Neckar
- Laufen (Salzach)
- Parsberg
- Lauingen
- Laupheim
- Lausheim
- Lauterbach
- Ruine Lauterburg
- Lautern
- Lautlingen
- Lechbruck
- Leidling
- Leidringen
- Leinroden
- Leinstetten
- Leipheim
- Leipferdingen
- Leitheim
- Gerabronn
- Lengdorf
- Lengenbach
- Lengenfeld
- Lengenwang
- Lenggries
- Lennesrieth
- Leofels
- Leonberg
- Leonberg
- Leonberg
- Leoprechting
- Leuchtenberg
- Leukershausen
- Leuterschach
- Leutershausen
- Leutstetten
- Leuzendorf
- Lichtenstern
- Liebenstein
- Schloß Liebenstein
- Bad Liebenzell
- Lienzingen
- Lierheim
- Lindach
- Lindach
- Lindau
- Lindelbach
- Linden
- Linden
- Lindenberg im Allgäu
- Lintach
- Litzelsdorf
- Lobenhausen
- Loffenau
- Lohe
- Lohkirchen
- Lohrbach
- Loiching
- Loitersdorf
- Lomersheim
- Lonsee
- Löpsingen
- Lorch
- Luckenpaint
- Ludwigsburg
- Ludwigsruhe
- Luhe-Wildenau
-
266-312
Magenbuch – Murrhardt
- Lupburg
- Marktlustenau
- Schloss Lustheim
- Lustnau
- Lützelburg
- Lutzingen
- Magenbuch
- Magstadt
- Maichingen
- Steinhöring
- Schloß Mainau
- Maiselsberg
- Maisenberg
- Malching
- Malgersdorf
- Mallersdorf-Pfaffenberg
- Oberschleißheim
- Manching
- Mantel
- Marbach am Neckar
- Obermarchtal
- Untermarchtal
- Margarethenberg
- Margertshausen
- Margrethausen
- Maria Birnbaum
- Mariabrunn
- Traunstein
- Mariäkappel
- Maria Elend
- Mariakirchen
- Maria Rain
- Maria Thalheim
- Mariazell
- Marienberg
- Schwabach
- Marienstein
- Markdorf
- Markelsheim
- Markgröningen
- Markt Bibart
- Marktoberdorf
- Marquartstein
- Martinskirchen
- Martinsmoos
- Martinsneukirchen
- Marzoll
- Massenbach
- Mauern
- Mauern
- Maurach
- Mauren
- Maxlrain
- Meersburg
- Laufen (Salzach)
- Mehring (Oberbayern)
- Mehring
- Meilham
- Meimsheim
- Meistershofen
- Memmingen
- Mengen
- Menning
- Merchingen
- Bad Mergentheim
- Mering
- Merkendorf
- Merklingen
- Merklingen
- München
- Mertingen
- Messelhausen
- Meßkirch
- Metten
- Mettenberg
- Mettingen
- Metzingen
- Michaelsbuch
- Michelsneukirchen
- Michelbach
- Michelbach an der Bilz
- Michelbach an der Heide
- Michelfeld
- Michelfeld
- Schönberg
- Michaelsberg
- Mickhausen
- Miesbach
- Milbertshofen
- Mindelheim
- Mindelheim
- Mindelzell
- Minneburg
- Mistlau
- Mittelrot
- Nittenau
- Mittenkirchen
- Mittenwald
- Mitteraschau
- Mitterauerbach
- Mitterbach
- Mittich
- Mockersdorf
- Möckmühl
- Mödingen
- Möglingen
- Möhringen
- Monakam
- Mönchberg
- Mönchsroth
- Monheim
- Monrepos
- Mönsheim
- Mosbach
- Morsbach
- Moosburg
- Moosen
- Moorenweis
- Moritzbrunn
- Mörsach
- Mörslingen
- Schloß Morstein
- Mörtelstein
- Mosbach
- Möschenfeld
- Motting
- Mudau
- Mühldorf
- Mühldorf
- Mühlhausen-Ehingen
- Mühlhausen an der Enz
- Stuttgart Mühlhausen
- Mühlheim an der Donau
- Mühringen
- Mulfingen
- Münchaurach
- München
- Münchingen
- Münchnerau
- Münchsdorf
- Münchshofen
- Münchsmünster
- Mundelsheim
- Munderkingen
- Münsingen
- Münster
- Münster
- Gaildorf
- Münsterhausen
- Murnau am Staffelsee
- Murrhardt
-
312-358
Nabburg – Nymphenburg
- Nabburg
- Nagold
- Nähermemmingen
- Nantwein
- Nassau
- Nassenbeuren
- Nassenfels
- Neckarelz
- Neckargartach
- Neckargröningen
- Neckarmühlbach
- Neckarsulm
- Neckartenzlingen
- Neckartailfingen
- Neckarweihingen
- Neckarwestheim
- Neckarzimmern
- Neenstetten
- Neidenfels
- Neidhardswinden
- Neidingen
- Neipperg
- Nellenburg
- Nellingen auf den Fildern
- Nenningen
- Neresheim
- Neubeuern
- Salem
- Neubronn
- Neubulach
- Neuburg
- Neuburg
- Neuburg an der Kammel
- Neuburg an der Donau
- Neudenau
- Neuenbürg
- Neuenhammer
- Neuenstadt am Kocher
- Neuenstein
- Neufahrn bei Freising
- Neufarn
- Neufahrn in Niederbayern
- Neuffen
- Neufra
- Neufrach
- Neuhaus
- Neuhaus
- Neuhausen
- Neuhausen
- Neuhausen auf den Fildern
- Neuhausen an der Erms
- Neuhof an der Zenn
- Neuhofen
- Neukirchen
- Neukirchen b.Hl.Blut
- Neukirchen am Inn
- Neuler
- Neumarkt in der Oberpfalz
- Neumarkt-Sankt Veit
- Neunburg vorm Wald
- Neunkirchen am Brand
- Neunkirchen am Sand
- Neunstetten
- Neuötting
- Neuried
- Neustadt an der Aisch
- Neustadt an der Donau
- Neustadt an der Waldnaab
- Neustift
- Neustift
- Niederachdorf
- Niederalfingen
- Niederalteich
- Niederarnbach
- Aschau im Chiemgau
- Niederbergkirchen
- Unterzeitldorn
- Niederhausen
- Niederhummel
- Niedermurach
- Niedernhall
- Niederraunau
- Niederroth
- Niederschönenfeld
- Niederseeon
- Niedersonthofen
- Niederstotzingen
- Niederstetten
- Niederthann
- Niklashausen
- Vilsbiburg
- Nippenburg
- Nöham
- Nonn
- Nonnberg
- Nordhausen
- Nördlingen
- Notzing
- Nufringen
- Nürnberg
- Nürtingen
- Nusplingen
- Nußdorf
- Nußdorf (Chiemgau)
- Nußdorf a. Inn
- Nussdorf
- Nymphenburg
-
358-375
Oberaltaich – Oxenhausen
- Oberalteich
- Oberammergau
- Oberampfrach
- Oberaudorf
- Oberbechingen
- Oberbergkirchen
- Oberbeuern
- Beutelsbach
- Oberböbingen
- Oberbruck
- Oberdarching
- Oberdigisheim
- Oberdingolfing
- Oberdischingen
- Oberdorfen
- Obereberfing
- Oberehring
- Obereichstätt
- Oberelchingen
- Oberfischach
- Obergeislbach
- Obergermaringen
- Obergrafendorf
- Oberharthausen
- Oberhaselbach
- Oberhausen
- Oberhausen
- Oberhöcking
- Oberiflingen
- Oberköblitz
- Oberlenningen
- Oberliezheim
- Obermarchtal
- Obermässing
- Obermedlingen
- Obermiethnach
- Obermurach
- Obernbach
- Oberndorf
- Oberndorf
- Oberndorf am Neckar
- Oberneuching
- Oberneustetten
- Obernheim
- Oberniebelsbach
- Obernzell
- Oberornau
- Oberostendorf
- Oberpfraundorf
- Oberranning
- Oberreit
- Oberriexingen
- Oberrot
- Oberscheinfeld
- Mosbach
- Oberschüpf
- Rottenburg a.d.Laaber
- Obersontheim
- Oberstadion
- Staudach
- Oberstenfeld
- Oberstetten
- Oberstotzingen
- Obertaufkirchen
- Obertrübenbach
- Oberuhldingen
- Oberurbach
- Oberviechtach
- Oberwälden
- Oberweiling
- Oberwittelsbach
- Oberwittighausen
- Obing
- Botenheim
- Ochsenhausen
- Odelzhausen
- Oedheim
- Öhringen
- Öllingen
- Öpfingen
- Oettingen in Bayern
- Oferdingen
- Offenau
- Offenhausen
- Offingen
- Offingen
- Ofterdingen
- Ohlstadt
- Olching
- Oppelsbohm
- Oppenweiler
- Oppolding
- Ornbau
- Ortenburg
- Oßweil
- Ostdorf
- Osterbuch
- Osterhofen
- Ostermünchen
- Osternohe
- Osterwaal
- Osterzell
- Ostheim
- Ostrach
- Ottenhofen
- Ottensoos
- Otterfing
- Otting
- Ottobeuren
- Owen
- Owingen
- Owingen
-
375-390
Paar – Pyrbaum
- Ichenhausen
- Paar
- Pähl
- Palsweis
- Pappelau
- Pappenheim
- Paring
- Parsberg
- Garmisch-Partenkirchen
- Pasenbach
- Passau
- Paulsdorf
- Pavelsbach
- Peiß
- Urspring
- Peiting
- Pelchenhofen
- Pemfling
- Penting
- Perbing
- Peretshofen
- Perlach
- Perschen
- Traunreut
- Pertolzhofen
- Pesenlern
- Petersberg
- Petersberg
- Peterskirchen
- Peterzell
- Pettendorf
- Pettendorf
- Petting
- Peutenhausen
- Pfaffenhofen an der Ilm
- Pfaffenhofen
- Buttenwiesen
- Pfaffenhofen
- Pfaffenmünster
- Pfaffing
- Pfärrich
- Pfarrkirchen
- Pfedelbach
- Pflaumloch
- Pfohren
- Pförring
- Pforzen
- Pfronten
- Pfullendorf
- Pfullingen
- Pichl
- Piding
- Pielenhofen
- Piesenkofen
- Piesing
- Pildenau
- Pilgramsberg
- Pilsach
- Pilsting
- Pipping
- Pirkensee
- Plankstetten
- Plattling
- Pleinfeld
- Pliening
- Plieningen
- Plochingen
- Pöcking
- Poing
- Polling
- Poltringen
- Pondorf
- Poppenhausen
- Schloss Pöring
- Pörndorf
- Postbauer-Heng
- Postmünster
- Pottenstetten
- Pöttmes
- Praßberg
- Preith
- Prem
- Preying
- Prien
- Prittriching
- Regensburg-Prüfening
- Prül
- Pullach im Isartal
- Pullenhofen
- Pullenreuth
- Pürgl
- Pürten
-
390-448
Rabenden – Ruprechtsburg
- Pyrbaum
- Rabenden
- Rabenstein
- Radolfzell am Bodensee
- Raisting
- Rottenbuch
- Raitenbuch
- Raitenhaslach
- Ramsau bei Berchtesgaden
- Schloß Ramsberg
- Rannertshofen
- Hohenburg
- Rappach
- Rasch
- Rast
- Rathsmannsdorf
- Ratzenried
- Ravensburg
- Parsberg
- Rechberghausen
- Stimpfach
- Rechentshofen
- Rechtmehring
- Regelsbach
- Regen
- Regenpeilstein
- Regensburg
- Rehling
- Reichardsroth
- Reichenau
- Reichenbach an der Fils
- Reichenbach am Heuberg
- Reichenbach unterm Rechberg
- Reichenbach bei Oberstdorf
- Reichenbach
- Reichenbach
- Reichenberg
- Reicheneibach
- Bad Reichenhall
- Reichersbeuern
- Reichersdorf
- Reichertshausen
- Reichertshofen
- Reicholzried
- Reimlingen
- Reinhardsachsen
- Rothenberg
- Reinsbronn
- Reinstetten
- Reisach
- Reisbach
- Reisensburg
- Reistingen
- Renfrizhausen
- Rennertshofen
- Renningen
- Renzenhof
- Rettenbach
- Reuth bei Kastl
- Reutern
- Reutlingen
- Rieden am Forggensee
- Rieden
- Rieden
- Riedhausen
- Riedheim
- Riedlingen
- Riegsee
- Rietenau
- Riet
- Rimpach
- Rinderfeld
- Rinkam
- Rippberg
- Rißtissen
- Ritzisried
- Roding
- Rodt
- Roggenburg
- Rogglfing
- Röhlingen
- Rohr
- Rohracker
- Rohrbach
- Rohrdorf
- Rohrdorf
- Rosenberg
- Rosenberg
- Rosenfeld
- Rosenheim
- Rosenstein
- Rosna
- Roßwag
- Rot am See
- Rot bei Laupheim
- Kloster Rot an der Rot
- Rötenbach
- Rötenberg
- Rothenburg ob der Tauber
- Rottbach
- Rottenbuch
- Rottenbuch
- Rottenburg am Neckar
- Rottendorf
- Rottenmünster
- Rottersdorf
- Röttingen
- Rottum
- Rottweil
- Rötz
-
448-493
Saaldorf – Süssenbach
- Rübgarten
- Ruderatshofen
- Ruhpolding
- Rumeltshausen
- Runding
- Rupertsbuch
- Ruppertskirchen
- Ruprechtsberg
- Saaldorf
- Sachrang
- Sachsenried
- Bad Säckingen
- Salach
- Salem
- Salmannskirchen
- Salem
- Salzburghofen
- Sandbach
- Sandelzhausen
- Sandizell
- Mittersendling
- Sankt Alban
- Mühldorf
- Altheim
- Sankt Anna
- Sankt Bartholomä
- Sankt Blasien
- Ravensburg
- Fridolfing
- Taching am See, St. Coloman bei Tengling
- Elsbeth
- Neustadt an der Waldnaab
- Frasdorf
- Traunstein
- Peißenberg
- Sankt Georgen
- Gern
- Sankt Georgen im Schwarzwald
- Dietramszell
- Sankt Leonhard
- Sankt Leonhard
- Margarethen
- Friedberg
- Püchersreuth
- St. Salvator
- Neumarkt-Sankt Veit
- Landshut
- Sankt Veit
- Sankt Wolfgang
- Sankt Wolfgang
- Sankt Wolfgang
- Satteldorf
- Sattelpeilnstein
- Saulburg
- Saulgau
- Saxenkam
- Schabringen
- Schäftersheim
- Schaftlach
- Schäftlarn
- Schainbach
- Schalkhausen
- Ruine Schalksburg
- Schambach
- Scharenstetten
- Ruine Scharfenberg
- Scharnhausen
- Scharten
- Schechingen
- Scheer
- Schelklingen
- Marktschellenberg
- Schemmerberg
- Jettingen-Scheppach
- Scheuer
- Scheuring
- Scheyern
- Schienen
- Schierling
- Schießen
- Schiltberg
- Schildthurn
- Hayingen
- Schlaitdorf
- Schlehdorf
- Schlossanlage Schleißheim
- Schliersee
- Schlierstadt
- Schmähingen
- Schmalfelden
- Schmiedelfeld
- Schmidham
- Schmiechen
- Schnait
- Schnaittenbach
- Schnaitsee
- Schnuttenbach
- Schöckingen
- Schöffau
- Schönach
- Schönbrunn
- Schönebürg
- Schönenberg
- Schönfeld
- Schongau
- Schönkirch
- Schönthal
- Kloster Schönthal
- Schornbach
- Schorndorf
- Schorndorf
- Schramberg
- Schrezheim
- Schrobenhausen
- Schrotzburg
- Schrotzhofen
- Schrozberg
- Oberschüpf
- Bad Schussenried
- Schützingen
- Schwabach
- Schwabbruck
- Markt Schwaben
- Schwäbishofen
- Schwabmühlhausen
- Schwabmünchen
- Schwabsoien
- Schwaig
- Schwaigern
- Schwandorf
- Schwaningen
- Schwarzach
- Schwarzenberg/Erzgeb.
- Schwärzenberg
- Schwarzenburg
- Schwarzenfeld
- Schwarzenthonhausen
- Schwarzhofen
- Schwarzlack
- Schwärzloch
- Schweinberg
- Schweindorf
- Schweitenkirchen
- Schwendi
- Schwennenbach
- Schwieberdingen
- Schwindegg
- Schwindkirchen
- Sechtenhausen
- Sedlhof
- See
- Seebarn
- Seefelden
- Seeg
- Seeon
- Seeshaupt
- Segringen
- Seibersdorf
- Seitingen
- Landshut
- Seligental
- Sennfeld
- Siebnach
- Siegenstein
- Höhenkirchen-Siegertsbrunn
- Siegsdorf
- Sießen
- Sigmaringen
- Sigmertshausen
- Sillersdorf
- Sinbronn
- Simmerberg
- Sindlbach
- Sindelfingen
- Sindolsheim
- Sipplingen
- Sirnau
- Sittelsdorf
- Sixthaselbach
- Söflingen
- Solitude
- Solln
- Sommersdorf
- Sontheim
- Sossau
- Soyen
- Spaichingen
- Spalt
- Speiden
- Speinshart
- Stachesried
- Stadlern
- Steinbühl
- Stammheim
- Stammheim
- Standorf
- Starnberg
- Stätzling
- Sauerlach
- Staudach-Egerndach
- Staufen
- Schloss Staufeneck
- Staufeneck
- Stefling
- Stein am Kocher
- Stein an der Traun
- Stein im Allgäu
- Maria Steinbach
- Steinbach
- Steinbach
- Steinbrünning
- Steinekirch
- Steingaden
- Steingau
- Steinhausen an der Rottum
- Steinhausen
- Steinheim
- Steinheim am der Murr
- Steinkirchen
- Steinkirchen
- Steinsfeld
- Steißlingen
- Bergham
- Stefansfeld
- Stetten am Kalten Markt
- Stetten im Remstal
- Stetten ob Rottweil
- Stetten ob Lontal
- Stetten
- Adertshausen
- Stillern
- Stimpfach
- Stockach
- Stöckenburg
- Ruine Stockenfels
- Stockheim
- Ruine Stolzeneck
- Stötten am Auerberg
- Stöttwang
- Straß b. Nersingen
- Straß
- Straßberg
- Straßdorf
- Straßkirchen
- Strauben
- Streichen
- Strümpfelbach
- Stubersheim
- Stühlingen
- Stulln
- Stuppach
- Stuttgart
- Sulz
- Sulz
- Sulzbach am Inn
- Sülzbach
- Sulzberg
- Sulzbürg
- Sulzemoos
- Sünching
- Surberg
-
493-506
Tabeckendorf – Tyrlaching
- Surheim
- Süß
- Süssenbach
- Tabeckendorf
- Tacherting
- Tading
- Täfertingen
- Taglaching
- Taiting
- Thalfingen
- Hilgertshausen-Tandern
- Tann
- Tännesberg
- Tannerl
- Tapfheim
- Taubenbach
- Tauberbischofsheim
- Taxis
- Taxöldern
- Tegernbach
- Tegernbach
- Tegernsee
- Bad Teinach-Zavelstein
- Teisendorf
- Tettenweis
- Tettnang
- Teublitz
- Thaining
- Thal
- Thal
- Talheim
- Thalhofen
- Thalkirchen
- Thamm
- Tanau
- Tannenburg
- Thannhausen
- Tannhausen
- Tannheim
- Thanstein
- Theinselberg
- Tengen
- Tennenbronn
- Waldshut-Tiengen
- Thierhaupten
- Tieringen
- Thomasbach
- Thumsenreuth
- Tüngental
- Thurmansbang
- Thurnstein
- Thyrnau
- Tiefenbach
- Tiefenbach
- Tiefenthal
- Schloß Tierberg
- Konstanz
- Tirschenreuth
- Titting
- Tittmoning
- Todtmoos
- Tholbath
- Bad Tölz
- Tomerdingen
- Törring
- Traunstein
- Trautmannshofen
- Traxl
- Treffelstein
- Treuchtlingen
- Triebenbach
- Triensbach
- Triesdorf
- Triftern
- Trochtelfingen
- Trochtelfingen
- Trostberg an der Alz
- Truchtlaching
- Trugenhofen
- Tübingen
- Tullau
- Tuntenhausen
- Tünzhausen
- Türkenfeld
- Türkenfeld
- Türkheim (Bay)Bf
- Tüßling
-
506-524
Ueberkingen – Utzmemmingen
- Tuttlingen
- Tyrlaching
- Bad Überkingen
- Überlingen am Ried
- Burgmannshofen
- Uhingen
- Uissigheim
- Ulm
- Unering
- Herrgottsruh
- Unterammergau
- Unterbiberg
- Unterboihingen
- Unterdeufstetten
- Unterdigisheim
- Untereberfing
- Unteremmendorf
- Engersdorf
- Unterensingen
- Untereschelbach
- Unteressendorf
- Unterframmering
- Untergermaringen
- Untergröningen
- Untergruppenbach
- Hagenried
- Unterhausen
- Unterjesingen
- Unterkessach
- Unterkochen
- Unterlaichling
- Unterliezheim
- Untermarchtal
- Untermeitingen
- Untermenzing
- Elkofen
- Unterostendorf
- Peißenberg
- Unterregenbach
- Unterriexingen
- Unterröhrenbach
- Unterschneidheim
- Unterschondorf
- Unterschüpf
- Unterschwandorf
- Unterschwarzach
- Sielmingen
- Untersontheim
- Unterwachingen
- Unterweissach
- Unterwilflingen
- Unterzeil
- Unterzeitlarn
- Upfingen
- Bad Urach
- Urnau
- Urphar
- Ursberg
-
524-528
Vaihingen – Vordergern
- Urschalling
- Ursensollen
- Auhausen
- Urspring
- Usterling
- Uttenweiler
- Utzmemmingen
- Vaihingen an der Enz
- Veitsbronn
- Velburg
- Velden
- Velden
- Vellberg
- Veringendorf
- Veringenstadt
- Vilgertshofen
- Villingen-Schwenningen
- Vilsbiburg
- Vilseck
- Vilshofen an der Donau
- Violau
- Vogtareuth
- Vohburg an der Donau
- Vohenstrauß
- Vorbachzimmern
- Vordergern
-
529-569
Waal – Wurzach
- Waal
- Waalhaupten
- Wachbach
- Wachendorf
- Waging am See
- Waiblingen
- Wain
- Wald
- Wald
- Wald
- Waldau
- Walburgskirchen
- Waldbach
- Waldburg
- Walddorf
- Waldenbuch
- Waldenburg
- Waldenhausen
- Walderbach
- Wäldershub
- Waldhof
- Waldkirch
- Waldmünchen
- Waldsassen
- Bad Waldsee
- Waldshut-Tiengen
- Waldstetten
- Walkertshofen
- Walldürn
- Wallerstein
- Walleshausen
- Walpertskirchen
- Wamberg
- Wangen
- Wangen
- Wangen
- Wannweil
- Wartenberg
- Wäschenbeuren
- Wasseralfingen
- Wasserburg am Inn
- Wassertrüdingen
- Wasserzell
- Weichs
- Weicht
- Weiden
- Weidenbach
- Weidenstetten
- Weihenlinden
- Weikersheim
- Weihmörting
- Weil
- Weil im Schönbuch
- Weil der Stadt
- Weildorf
- Weiler an der Zaber
- Weiler bei Weinsberg
- Weiler in den Bergen
- Weilham
- Weilheim
- Weilheim an der Teck
- Weilheim
- Weilimdorf
- Weilkirchen
- Weiltingen
- Weingarten
- Weinsberg
- Weissach
- Kloster Weissenau
- Weißenburg in Bayern
- Weißendorf
- Weißendorf
- Weißenkirchen
- Weißenregen
- Weißenstein
- Weitenburg
- Weitenried
- Weiterdingen
- Weiterskirchen
- Weitingen
- Weitnau
- Welden
- Wellheim
- Welschingen
- Kloster Weltenburg
- Welzheim
- Wemding
- Wendlingen am Neckar
- Weng
- Wengen
- Werenwag
- Wermutshausen
- Wernberg-Köblitz
- Wörnsmühl
- Wertheim
- Wertingen
- Wessobrunn
- Westendorf
- Westerbuchberg
- Westerheim
- Westerholzhausen
- Westerndorf
- Westerstetten
- Westgartshausen
- Westhausen
- Wettlkam
- Wettenhausen
- Wetterfeld
- Weyarn
- Wiblingen
- Widdern
- Wiechs
- Wiedergeltingen
- Wiefelsdorf
- Moosbach
- Wieskirche
- Wiesenbach
- Wiesensteig
- Wiesent
- Wiggensbach
- Wilchenreuth
- Bad Wildbad im Schwarzwald
- Wildberg
- Wildenau
- Wildenstein
- Wildenstein
- Wildpoltsweiler
- Wilfingen
- Wilhermsdorf
- Willing
- Willmendingen
- Wilparting
- Wildpoldsried
- Willprechtszell
- Wimpasing
- Bad Wimpfen
- Wimsheim
- Winbuch
- Windberg
- Windsbach
- Bad Windsheim
- Winhöring
- Winnenden
- Winterbach (b Schorndorf)
- Winterrieden
- Wirlings
- Wißgoldingen
- Oberwittelsbach
- Wittislingen
- Wölchingen
- Wolfartsweiler
- Wolfegg
- Wolfakirchen
- Wolfratshausen
- Wolfring
- Wolkering
- Wollmatingen
- Wolnzach
- Wolpertswende
- Wondreb
- Bad Wörishofen
- Wörnersberg
- Wörnstorf
- Wörth a.d.Donau
-
569-574
Zaberfeld – Zwingenberg
- Wuchzenhofen
- Wülzburg
- Würding
- Wurmlingen
- Wurmsham
- Bad Wurzach
- Zaberfeld
- Zaisersweiher
- Zandt
- Zangberg
- Zangenfels
- Zangenstein
- Bad Teinach-Zavelstein
- Zeholfing
- Schloß Zeil
- Eisenberg
- Zell
- Zell am Neckar
- Ziemetshausen
- Zimmern
- Neckarzimmern
- Dürrenzimmern
- Zinzendorf
- Zipplingen
- Zirgesheim
- Zöbingen
- Zorneding
- Zuffenhausen
- Zulling
- Zußdorf
- Züttlingen
- Zwecksberg
- Zwiefalten
- Zwiefaltendorf
- Zwiesel
- Zwingenberg
- 575-596 Anhang
- 597-610 Ortsverzeichnis
- 611-621 Künstlerverzeichnis
- Einband
- Maßstab
Rot
— 446 —
Rot
weggeführt, das System mithin ähnlich dem der Stuttgarter Stifts-K.
Die reich gemusterten Sterngwbb. datiert mit 1497 (s Ssch.), 1507
(n Ssch.), 1517 (Msch.). Der Chor überragt das Lhs. außen und
innen; der quadr. Vorchor, jetzt in 2 schmal-rck. Gwbb. geteilt,
entspricht wohl dem älteren Bau; Schluß 5/8; Formen korrekt hoch-
gotisch, im Maßwerk erste Anfänge von Fischblasen. — Die spgot.
Flügelaltäre, 7 an der Zahl, im Kunsthandel erworben, Her-
kunft unbekannt, Altes und Neues gemischt. Der älteste der
Apostelaltar mit rel. strengem Maßwerkornament um 1450. [Chor-
gestühl von Landolin Ohmacht, jetzt in Dünningen.] Kanzel neu
mit alten Figg. Taufstein gotisierende Renss. 1562.
Evang. K. (früher Dominikaner). Durch Umbau 1753 der got.
Charakter bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Ausgedehnter Fresken-
zyklus von /. Wannemacher 1755. Im Chor an Wand und
Decke Verherrlichung des h. Dominikus. Die 3 großen Decken-
gemälde im Lhs.: Sieg bei Lepanto auf Fürbitte der Rosenkranz-
königin, Belagerung Rottweils durch die Franzosen 1643, Dominikus
als Fürbitter im Himmel.
Sog. Kapellen-K. Bmkw. vornehmlich der an der WFront vor-
springende T. Durch Größe (70 m h.) und Pracht scheint er eine
sehr bedeutende K. anzukündigen; in Wahrheit hatte sie kaum
mittlere Dimensionen. Das System des Sch. nicht mehr zu er-
kennen. Nach Einsturz der Gwbb. 1721 durch einen Barockbau
im Hallensystem ersetzt; der Chor 1478 von Albrecht Georg stark
verändert. Der T. hat einen hochgot. (2. V. 14. Jh.) und einen
spgot. (1473 ff.) Abschnitt. Der erstere 4 seit., etwas breiter als tief,
auf jeder der 3 Freiseiten ein großes Portal, darüber Flachnische unter
Wimperg, innerhalb deren jedesmal ein Rosenfenster. (Dies Motiv,
wie überhaupt die ganze Formensprache, könnte aus Reutlingen
stammen; ein ähnliches als Zierbaldachin schon am abgebrochenen
Lettner des Straßburger Münsters, 3. V. 13. Jh.). An den Ecken der
WSeite Schneckentürmchen. Die Wandflächen mit Stab- und Maß-
werk reliefiert, am 1. Geschoß 2 Reihen von Statuen auf Konsolen.
Vom Zierwerk vieles zertört. 1473 mit 2 achteckigen Geschossen
weitergeführt. Die einst durchbrochene Steinpyramide im 18. Jh.
durch Zeltdach ersetzt. — Ein für die Kunstgeschichte wich-
tiges Denkmal ist der Kapellen-T. durch seinen Skulpturen-
schmuck. (Sonderschrift von P. Hartmann in Vorbereitung.)
Hier zum ersten Male im Osten des Oberrheins tritt die monu-
mentale Plastik im Sinne der entwickelten Gotik als ein inte-
grierender Teil des Bauprogramms auf. Die leitenden Künstler
hatten ihre Schule im Westen gemacht (in Straßburg? in Frank-
reich selbst?). Die Ausbildung ihrer Gehilfen war mangelhaft.
Daher der eigentümlich gemischte Charakter des Werkes: Die An-
— 446 —
Rot
weggeführt, das System mithin ähnlich dem der Stuttgarter Stifts-K.
Die reich gemusterten Sterngwbb. datiert mit 1497 (s Ssch.), 1507
(n Ssch.), 1517 (Msch.). Der Chor überragt das Lhs. außen und
innen; der quadr. Vorchor, jetzt in 2 schmal-rck. Gwbb. geteilt,
entspricht wohl dem älteren Bau; Schluß 5/8; Formen korrekt hoch-
gotisch, im Maßwerk erste Anfänge von Fischblasen. — Die spgot.
Flügelaltäre, 7 an der Zahl, im Kunsthandel erworben, Her-
kunft unbekannt, Altes und Neues gemischt. Der älteste der
Apostelaltar mit rel. strengem Maßwerkornament um 1450. [Chor-
gestühl von Landolin Ohmacht, jetzt in Dünningen.] Kanzel neu
mit alten Figg. Taufstein gotisierende Renss. 1562.
Evang. K. (früher Dominikaner). Durch Umbau 1753 der got.
Charakter bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Ausgedehnter Fresken-
zyklus von /. Wannemacher 1755. Im Chor an Wand und
Decke Verherrlichung des h. Dominikus. Die 3 großen Decken-
gemälde im Lhs.: Sieg bei Lepanto auf Fürbitte der Rosenkranz-
königin, Belagerung Rottweils durch die Franzosen 1643, Dominikus
als Fürbitter im Himmel.
Sog. Kapellen-K. Bmkw. vornehmlich der an der WFront vor-
springende T. Durch Größe (70 m h.) und Pracht scheint er eine
sehr bedeutende K. anzukündigen; in Wahrheit hatte sie kaum
mittlere Dimensionen. Das System des Sch. nicht mehr zu er-
kennen. Nach Einsturz der Gwbb. 1721 durch einen Barockbau
im Hallensystem ersetzt; der Chor 1478 von Albrecht Georg stark
verändert. Der T. hat einen hochgot. (2. V. 14. Jh.) und einen
spgot. (1473 ff.) Abschnitt. Der erstere 4 seit., etwas breiter als tief,
auf jeder der 3 Freiseiten ein großes Portal, darüber Flachnische unter
Wimperg, innerhalb deren jedesmal ein Rosenfenster. (Dies Motiv,
wie überhaupt die ganze Formensprache, könnte aus Reutlingen
stammen; ein ähnliches als Zierbaldachin schon am abgebrochenen
Lettner des Straßburger Münsters, 3. V. 13. Jh.). An den Ecken der
WSeite Schneckentürmchen. Die Wandflächen mit Stab- und Maß-
werk reliefiert, am 1. Geschoß 2 Reihen von Statuen auf Konsolen.
Vom Zierwerk vieles zertört. 1473 mit 2 achteckigen Geschossen
weitergeführt. Die einst durchbrochene Steinpyramide im 18. Jh.
durch Zeltdach ersetzt. — Ein für die Kunstgeschichte wich-
tiges Denkmal ist der Kapellen-T. durch seinen Skulpturen-
schmuck. (Sonderschrift von P. Hartmann in Vorbereitung.)
Hier zum ersten Male im Osten des Oberrheins tritt die monu-
mentale Plastik im Sinne der entwickelten Gotik als ein inte-
grierender Teil des Bauprogramms auf. Die leitenden Künstler
hatten ihre Schule im Westen gemacht (in Straßburg? in Frank-
reich selbst?). Die Ausbildung ihrer Gehilfen war mangelhaft.
Daher der eigentümlich gemischte Charakter des Werkes: Die An-