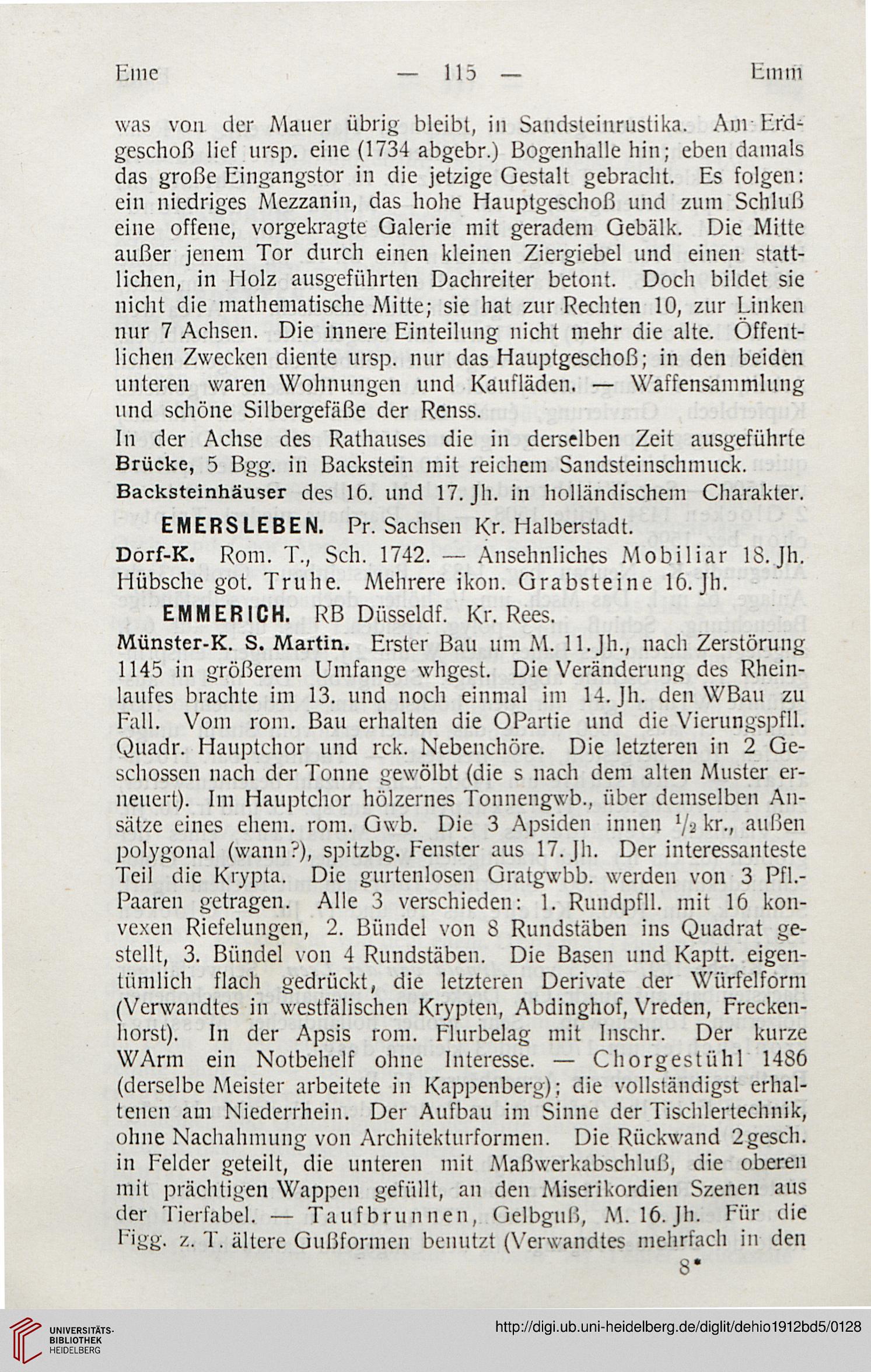Dehio, Georg
Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler (Band 5): Nordwestdeutschland
— Berlin, 1912
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.11108#0128
DOI Seite / Zitierlink:
https://doi.org/10.11588/diglit.11108#0128
- Karte
- Titelblatt
- III-IV Vorwort
- V-VI Verzeichnis der bis jetzt erschienenen amtlichen Inventare
- VII-VIII Verzeichnis der Abkürzungen
-
1-30
Aachen – Aurich
- ⟦Aachen⟧
- ⟦Abbendorf⟧
- ⟦Abbenrode⟧
- ⟦Accum⟧
- ⟦Achim⟧
- ⟦Adelebsen⟧
- ⟦Adendorf⟧
- ⟦Adensen⟧
- ⟦Adenstedt⟧
- ⟦Aderstedt⟧
- ⟦Adorf⟧
- ⟦Aegidienberg⟧
- ⟦Aerzen⟧
- ⟦Affeln⟧
- ⟦Agathenburg⟧
- ⟦Ahaus⟧
- ⟦Ahlden⟧
- ⟦Ahlen⟧
- ⟦Ahrbergen⟧
- ⟦Aken⟧
- ⟦Albachten⟧
- ⟦Albersloh⟧
- ⟦Aldenhoven⟧
- ⟦Alfeld⟧
- ⟦Alfen⟧
- ⟦Alfhausen⟧
- ⟦Alfter⟧
- ⟦Allendorf⟧
- ⟦Alleringersleben⟧
- ⟦Alpen⟧
- ⟦Alst⟧
- ⟦Alstätte⟧
- ⟦Alswede⟧
- ⟦Bruchhausen-Vilsen⟧
- ⟦Altena⟧
- ⟦Altenbeken⟧
- ⟦Altenberg⟧
- ⟦Altenberge⟧
- ⟦Altenbruch⟧
- ⟦Altenburg⟧
- ⟦Altencelle⟧
- ⟦Altendorf⟧
- ⟦Altengeseke⟧
- ⟦Altenhausen⟧
- ⟦Altenoythe⟧
- ⟦Altenrath⟧
- ⟦Altenrode⟧
- ⟦Altona⟧
- ⟦Bebertal Eins⟧
- ⟦Burg Alvensleben⟧
- ⟦Alverskirchen⟧
- ⟦Amelsbüren⟧
- ⟦Amelungsborn Kloster⟧
- ⟦Sankt Anton-Amern⟧
- ⟦Amesdorf⟧
- ⟦Groß Ammensleben⟧
- ⟦Klein Ammensleben⟧
- ⟦Ampfurth⟧
- ⟦Ampleben⟧
- ⟦Anderbeck⟧
- ⟦Angelmodde⟧
- ⟦Angern⟧
- ⟦Ballenstedt⟧
- ⟦Burg Anholt⟧
- ⟦Ankum⟧
- ⟦Anröchte⟧
- ⟦Antweiler⟧
- ⟦Apelern⟧
- ⟦Aplerbeck⟧
- ⟦Appeldorn⟧
- ⟦Ardorf⟧
- ⟦Arendsee (Altmark)⟧
- ⟦Schloss Arensburg⟧
- ⟦Arfeld⟧
- ⟦Arle⟧
- ⟦Arneburg⟧
- ⟦Arnim⟧
- ⟦Arnoldsweiler⟧
- ⟦Arnsberg⟧
- ⟦Bad Arolsen⟧
- ⟦Asbeck⟧
- ⟦Aschendorf⟧
- ⟦Aschersleben⟧
- ⟦Asel⟧
- ⟦Asperden⟧
- ⟦Assel⟧
- ⟦Asseln⟧
- ⟦Assen⟧
- ⟦Athensleben⟧
- ⟦Attendorn⟧
- ⟦Atzendorf⟧
- ⟦Audorf⟧
-
30-91
Badbergen – Byink
- ⟦Aurich⟧
- ⟦Badbergen⟧
- ⟦Badeleben⟧
- ⟦Badingen⟧
- ⟦Baerl⟧
- ⟦Bahrdorf⟧
- ⟦Bahrendorf⟧
- ⟦Baesweiler⟧
- ⟦Bakum⟧
- ⟦Balge⟧
- ⟦Ballenstedt⟧
- ⟦Balve⟧
- ⟦Barby⟧
- ⟦Bardewisch⟧
- ⟦Bardowick⟧
- ⟦Barienrode⟧
- ⟦Barleben⟧
- ⟦Barmen⟧
- ⟦Barmen⟧
- ⟦Barnstorf⟧
- ⟦Barntrup⟧
- ⟦Barsinghausen⟧
- ⟦Barskamp⟧
- ⟦Barum⟧
- ⟦Neustadt am Rübenberge⟧
- ⟦Bassum⟧
- ⟦Baum⟧
- ⟦Bausenhagen⟧
- ⟦Beber⟧
- ⟦Beckum⟧
- ⟦Bedburdyck⟧
- ⟦Bedburg⟧
- ⟦Bedburg⟧
- ⟦Meiderich⟧
- ⟦Beelitz⟧
- ⟦Beese⟧
- ⟦Beetzendorf⟧
- ⟦Benndorf⟧
- ⟦Beienrode⟧
- ⟦Belm⟧
- ⟦Schloss Benrath⟧
- ⟦Bensberg⟧
- ⟦Bad Bentheim⟧
- ⟦Bentlage⟧
- ⟦Berg⟧
- ⟦Berge⟧
- ⟦Bergen⟧
- ⟦Bergerhausen⟧
- ⟦Berghausen⟧
- ⟦Bergheim⟧
- ⟦Bergisch Gladbach⟧
- ⟦Bergkirchen⟧
- ⟦Berkum⟧
- ⟦Bad Berleburg⟧
- ⟦Bernburg⟧
- ⟦Berndorf⟧
- ⟦Berne⟧
- ⟦Berrendorf⟧
- ⟦Bersenbrück⟧
- ⟦Bettenhoven⟧
- ⟦Bevern⟧
- ⟦Bexhövede⟧
- ⟦Beyenburg⟧
- ⟦Beyendorf⟧
- ⟦Bielefeld⟧
- ⟦Biendorf⟧
- ⟦Bierbergen⟧
- ⟦Bierstedt⟧
- ⟦Klein Biewende⟧
- ⟦Bilderlahe⟧
- ⟦Bilk⟧
- ⟦Billerbeck⟧
- ⟦Bilme⟧
- ⟦Bingum⟧
- ⟦Binsfeld⟧
- ⟦Bippen⟧
- ⟦Birgel⟧
- ⟦Bislich⟧
- ⟦Bismark⟧
- ⟦Bisperode⟧
- ⟦Bispingen⟧
- ⟦Bissendorf⟧
- ⟦Bladenhorst⟧
- ⟦Stadt Blankenberg⟧
- ⟦Blankenburg⟧
- ⟦Blankenheim⟧
- ⟦Blasheim⟧
- ⟦Blexen⟧
- ⟦Schloß Bloemersheim⟧
- ⟦Blomberg⟧
- ⟦Lobberich⟧
- ⟦Bocholt⟧
- ⟦Bockenem⟧
- ⟦Bökenförde⟧
- ⟦Bockhorst⟧
- ⟦Bockum⟧
- ⟦Bödefeld⟧
- ⟦Bodelschwingh⟧
- ⟦Bodenburg⟧
- ⟦Bodendorf⟧
- ⟦Bodenwerder⟧
- ⟦Bödingen⟧
- ⟦Boffzen⟧
- ⟦Boisheim⟧
- ⟦Boke⟧
- ⟦Bonn⟧
- ⟦Borbeck⟧
- ⟦Rinkerode⟧
- ⟦Borgeln⟧
- ⟦Borgholzhausen⟧
- ⟦Borghorst⟧
- ⟦Borken⟧
- ⟦Born⟧
- ⟦Borne⟧
- ⟦Börninghausen⟧
- ⟦Börstel⟧
- ⟦Bortfeld⟧
- ⟦Bösensell⟧
- ⟦Boslar⟧
- ⟦Bothfeld⟧
- ⟦Bothmer⟧
- ⟦Bottenbroich⟧
- ⟦Brabecke⟧
- ⟦Brachelen⟧
- ⟦Bracht⟧
- ⟦Brackel⟧
- ⟦Brakel⟧
- ⟦Bramsche⟧
- ⟦Braunlage⟧
- ⟦Braunschweig⟧
- ⟦Brauweiler⟧
- ⟦Brechten⟧
- ⟦Breckerfeld⟧
- ⟦Breil⟧
- ⟦Breinum⟧
- ⟦Bremen⟧
- ⟦Bremen⟧
- ⟦Bremervörde⟧
- ⟦Bremke⟧
- ⟦Bremke⟧
- ⟦Brenkhausen⟧
- ⟦Breselenz⟧
- ⟦Brilon⟧
- ⟦Brochterbeck⟧
- ⟦Broich⟧
- ⟦Brüggen⟧
- ⟦Brühl⟧
- ⟦Brumby⟧
- ⟦Brunau⟧
- ⟦Brünen⟧
- ⟦Brunkensen⟧
- ⟦Brunshausen⟧
- ⟦Buch⟧
- ⟦Buchholz⟧
- ⟦Buckau⟧
- ⟦Bückeburg⟧
- ⟦Bücken⟧
- ⟦Bücknitz⟧
- ⟦Buer⟧
- ⟦Bukow⟧
- ⟦Bullange⟧
- ⟦Bültum⟧
- ⟦Bunde⟧
- ⟦Bünde⟧
- ⟦Burbach⟧
- ⟦Büren⟧
- ⟦Burg⟧
- ⟦Burg⟧
- ⟦Burgdorf⟧
- ⟦Haus Bürgel⟧
- ⟦Burgsteinfurt⟧
- ⟦Burgstemmen⟧
- ⟦Waldniel⟧
- ⟦Burlage⟧
- ⟦Burlo⟧
- ⟦Buro, Kirche⟧
- ⟦Bürrig⟧
- ⟦Bursfelde⟧
- ⟦Bürvenich⟧
- ⟦Buschbell⟧
- ⟦Buschhoven⟧
- ⟦Butgenbach⟧
- ⟦Buttforde⟧
- ⟦Büttgen⟧
- ⟦Buxtehude⟧
-
91-109
Dalchau – Dyckhof
- ⟦Davensberg⟧
- ⟦Dalchau⟧
- ⟦Dambeck⟧
- ⟦Damme⟧
- ⟦Dankensen⟧
- ⟦Dannefeld⟧
- ⟦Dannenberg⟧
- ⟦Darlingerode⟧
- ⟦Darup⟧
- ⟦Dassel⟧
- ⟦Datteln⟧
- ⟦Dattenfeld⟧
- ⟦Davensberg⟧
- ⟦Debstedt⟧
- ⟦Deckbergen⟧
- ⟦Deetz⟧
- ⟦Deetz⟧
- ⟦Deilinghofen⟧
- ⟦Delbrück⟧
- ⟦Lütgendortmund⟧
- ⟦Derichsweiler⟧
- ⟦Derneburg⟧
- ⟦Dessau⟧
- ⟦Destedt⟧
- ⟦Detershagen⟧
- ⟦Detfurth⟧
- ⟦Detmold⟧
- ⟦Dielingen⟧
- ⟦Dielmissen⟧
- ⟦Diepholz⟧
- ⟦Diesdorf⟧
- ⟦Dinker⟧
- ⟦Dinklage⟧
- ⟦Dinklar⟧
- ⟦Dinslaken⟧
- ⟦Ditfurt⟧
- ⟦Dodendorf⟧
- ⟦Dolberg⟧
- ⟦Domersleben⟧
- ⟦Bebertal Zwei⟧
- ⟦Dorfmark⟧
- ⟦Dorlar⟧
- ⟦Dornberg⟧
- ⟦Dornburg⟧
- ⟦Dörnhagen⟧
- ⟦Dornick⟧
- ⟦Dornum⟧
- ⟦Dorstadt⟧
- ⟦Dorsten⟧
- ⟦Dortmund⟧
- ⟦Dorum⟧
- ⟦Dörverden⟧
- ⟦Dötlingen⟧
- ⟦Drachenfels⟧
- ⟦Drakenburg⟧
- ⟦Drackenstedt⟧
- ⟦Dreierwalde⟧
- ⟦Drensteinfurt⟧
- ⟦Drevenack⟧
- ⟦Bad Driburg⟧
- ⟦Drohndorf⟧
- ⟦Drolshagen⟧
- ⟦Drove⟧
- ⟦Drübeck⟧
- ⟦Möhnesee⟧
- ⟦Drüsedau⟧
- ⟦Duderstadt⟧
- ⟦Duisburg⟧
- ⟦Dungelbeck⟧
- ⟦Dünnwald⟧
- ⟦Dünschede⟧
- ⟦Dunum⟧
- ⟦Düren⟧
- ⟦Dürscheven⟧
- ⟦Düsedau⟧
- ⟦Düsseldorf⟧
-
109-125
Ebstorf – Externsteine
- ⟦Duttenstedt⟧
- ⟦Dyck⟧
- ⟦Gut Dyckhof⟧
- ⟦Ebstorf⟧
- ⟦Ederen⟧
- ⟦Edewecht⟧
- ⟦Efferen⟧
- ⟦Egeln⟧
- ⟦Egestorf⟧
- ⟦Eggerode⟧
- ⟦Ehreshoven⟧
- ⟦Eichenbarleben⟧
- ⟦Eichlinghofen⟧
- ⟦Eickel⟧
- ⟦Eilenstedt⟧
- ⟦Eilsum⟧
- ⟦Eimbeckhausen⟧
- ⟦Eime⟧
- ⟦Einbeck⟧
- ⟦Eitorf⟧
- ⟦Elberfeld⟧
- ⟦Elbeu⟧
- ⟦Elbrinxen⟧
- ⟦Elmpt⟧
- ⟦Elsdorf⟧
- ⟦Elsen⟧
- ⟦Elsen⟧
- ⟦Elsey⟧
- ⟦Elsig⟧
- ⟦Elsoff⟧
- ⟦Elspe⟧
- ⟦Schloß Elsum⟧
- ⟦Embken⟧
- ⟦Embsen⟧
- ⟦Emden⟧
- ⟦Emden⟧
- ⟦Emersleben⟧
- ⟦Emmerich⟧
- ⟦Empel⟧
- ⟦Emsbüren⟧
- ⟦Emsdetten⟧
- ⟦Engelsdorf⟧
- ⟦Enger⟧
- ⟦Enkhausen⟧
- ⟦Ennigerloh⟧
- ⟦Kloster Eppinghoven⟧
- ⟦Eppinghoven⟧
- ⟦Erichsburg⟧
- ⟦Erkelenz⟧
- ⟦Erkrath⟧
- ⟦Erndtebrück⟧
- ⟦Erp⟧
- ⟦Erwitte⟧
- ⟦Erxleben⟧
- ⟦Esch⟧
- ⟦Esch⟧
- ⟦Eschweiler⟧
- ⟦Esenshamm⟧
- ⟦Eslohe⟧
- ⟦Essen⟧
- ⟦Estedt⟧
- ⟦Eupen⟧
- ⟦Euskirchen⟧
- ⟦Everloh⟧
- ⟦Eversberg⟧
-
125-133
Falkenhagen – Fussenich
- ⟦Everswinkel⟧
- ⟦Evessen⟧
- ⟦Ewig⟧
- ⟦Exten⟧
- ⟦Holzhausen-Externsteine⟧
- ⟦Falkenhagen⟧
- ⟦Fallersleben⟧
- ⟦Fedderwarden⟧
- ⟦Feldbergen⟧
- ⟦Felgeleben⟧
- ⟦Ferndorf⟧
- ⟦Feudingen⟧
- ⟦Fischbeck⟧
- ⟦Fischbeck⟧
- ⟦Fischeln⟧
- ⟦Flamersheim⟧
- ⟦Flechtdorf⟧
- ⟦Flechtingen⟧
- ⟦Flierich⟧
- ⟦Flittard⟧
- ⟦Flötz⟧
- ⟦Förderstedt⟧
- ⟦Frauenberg⟧
- ⟦Frauweiler⟧
- ⟦Frauwüllesheim⟧
- ⟦Freckenhorst⟧
- ⟦Fredelsloh⟧
- ⟦Freepsum⟧
- ⟦Freialdenhoven⟧
- ⟦Quadrath-Ichendorf⟧
- ⟦Frenswegen⟧
- ⟦Frenz⟧
- ⟦Friedland⟧
- ⟦Friesdorf⟧
- ⟦Friesheim⟧
- ⟦Friesoythe⟧
- ⟦Fröndenberg⟧
- ⟦Frose⟧
-
133-159
Gaesdonk – Gymnich
- ⟦Füchten⟧
- ⟦Fuhlen⟧
- ⟦Funnix⟧
- ⟦Fürstenberg⟧
- ⟦Füssenich⟧
- ⟦Gaesdonk⟧
- ⟦Ganderkesee⟧
- ⟦Bad Gandersheim⟧
- ⟦Gangelt⟧
- ⟦Gänsefurth⟧
- ⟦Gardelegen⟧
- ⟦Gartrop-Bühl⟧
- ⟦Garz⟧
- ⟦Gatersleben⟧
- ⟦Gebhardshagen⟧
- ⟦Gehlenbeck⟧
- ⟦Gehrden⟧
- ⟦Gehrden⟧
- ⟦Gehrden⟧
- ⟦Geismar⟧
- ⟦Geistingen⟧
- ⟦Geldern⟧
- ⟦Gemen⟧
- ⟦Genthin⟧
- ⟦Gerblingerode⟧
- ⟦Gerdau⟧
- ⟦Gernrode⟧
- ⟦Gerresheim⟧
- ⟦Gersdorf⟧
- ⟦Gertrudenberg⟧
- ⟦Gescher⟧
- ⟦Geseke⟧
- ⟦Gielsdorf⟧
- ⟦Gifhorn⟧
- ⟦Gildehaus⟧
- ⟦Gimbte⟧
- ⟦Ginderich⟧
- ⟦Girkhausen⟧
- ⟦Gittelde⟧
- ⟦Gladau⟧
- ⟦Gladbach⟧
- ⟦Bergisch Gladbach⟧
- ⟦Glehn⟧
- ⟦Gleichen⟧
- ⟦Glesch⟧
- ⟦Gleuel⟧
- ⟦Glienke⟧
- ⟦Gnadental⟧
- ⟦Goch⟧
- ⟦Schloß Gödens⟧
- ⟦Bad Godesberg⟧
- ⟦Gödnitz⟧
- ⟦Gohr⟧
- ⟦Göhrde⟧
- ⟦Goldenstedt⟧
- ⟦Golzwarden⟧
- ⟦Gommern⟧
- ⟦Görzke⟧
- ⟦Goslar⟧
- ⟦Gottesgnaden⟧
- ⟦Göttingen⟧
- ⟦Grabow⟧
- ⟦Liblar⟧
- ⟦Gräfrath⟧
- ⟦Grafschaft⟧
- ⟦Grasdorf⟧
- ⟦Grasdorf⟧
- ⟦Gravenhorst⟧
- ⟦Greene⟧
- ⟦Greffen⟧
- ⟦Grefrath⟧
- ⟦Gressenich⟧
- ⟦Greven⟧
- ⟦Grevenbroich⟧
- ⟦Grevenstein⟧
- ⟦Grieth⟧
- ⟦Griethausen⟧
- ⟦Grimberg⟧
- ⟦Ossum-Bösinghoven⟧
- ⟦Gronau⟧
- ⟦Groppendorf⟧
- ⟦Großbadegast⟧
- ⟦Groß Bartensleben⟧
- ⟦Großburgwedel⟧
- ⟦Engersen⟧
- ⟦Großenwieden⟧
- ⟦Groß Himstedt⟧
- ⟦Königsdorf⟧
- ⟦Großkühnau⟧
- ⟦Lübars⟧
- ⟦Lübs⟧
- ⟦Mangelsdorf⟧
- ⟦Groß Mühlingen⟧
- ⟦Groß Quenstedt⟧
- ⟦Groß Rottmersleben⟧
- ⟦Salzelmen⟧
- ⟦Groß-Schierstedt⟧
- ⟦Groß Stöckheim⟧
- ⟦Groß Vahlberg⟧
- ⟦Groß Vernich⟧
- ⟦Weißandt-Gölzau⟧
- ⟦Großwülknitz⟧
- ⟦Wulkow⟧
- ⟦Wusterwitz⟧
- ⟦Grove⟧
- ⟦Grubenhagen⟧
- ⟦Gruiten⟧
- ⟦Gübs⟧
- ⟦Gudenau⟧
- ⟦Gummersbach⟧
- ⟦Güsten⟧
- ⟦Güsten⟧
- ⟦Gustorf⟧
- ⟦Gütersloh⟧
-
159-223
Haag – Huyseburg
- ⟦Gyhum⟧
- ⟦Gymnich⟧
- ⟦Schloß Haag⟧
- ⟦Haddenhausen⟧
- ⟦Hadmersleben⟧
- ⟦Haffen⟧
- ⟦Hage⟧
- ⟦Hagen⟧
- ⟦Hakenstedt⟧
- ⟦Halberstadt⟧
- ⟦Haldern⟧
- ⟦Halle⟧
- ⟦Hambach⟧
- ⟦Hamborn⟧
- ⟦Hameln⟧
- ⟦Hämelschenburg⟧
- ⟦Hamersleben⟧
- ⟦Hämerten⟧
- ⟦Hamm⟧
- ⟦Handorf⟧
- ⟦Hannover⟧
- ⟦Hanselaer⟧
- ⟦Harbke⟧
- ⟦Harburg⟧
- ⟦Hardegsen⟧
- ⟦Hardehausen⟧
- ⟦Nörten-Hardenberg⟧
- ⟦Hardenberg⟧
- ⟦Harenberg⟧
- ⟦Harff⟧
- ⟦Harpen⟧
- ⟦Harsefeld⟧
- ⟦Harsewinkel⟧
- ⟦Harsleben⟧
- ⟦Försterei Hartenberg⟧
- ⟦Bad Harzburg⟧
- ⟦Harzgerode⟧
- ⟦Hasbergen⟧
- ⟦Haselünne⟧
- ⟦Häsewig⟧
- ⟦Hassel⟧
- ⟦Hastenbeck⟧
- ⟦Hattendorf⟧
- ⟦Hattingen⟧
- ⟦Hattorf⟧
- ⟦Hattorf am Harz⟧
- ⟦Hausberge⟧
- ⟦Havixbeck⟧
- ⟦Kleiner Heckberg⟧
- ⟦Hecklingen⟧
- ⟦Hedersleben⟧
- ⟦Hedwigsburg⟧
- ⟦Heemsen⟧
- ⟦Heepen⟧
- ⟦Heeren⟧
- ⟦Heeslingen⟧
- ⟦Heessen⟧
- ⟦Heggen⟧
- ⟦Hehlen⟧
- ⟦Heiligendorf⟧
- ⟦Heiligenfelde⟧
- ⟦Heiligenkirchen⟧
- ⟦Heiligenrode⟧
- ⟦Heimerzheim⟧
- ⟦Heimsen⟧
- ⟦Heiningen⟧
- ⟦Heinsberg⟧
- ⟦Heinsberg⟧
- ⟦Heisterbach⟧
- ⟦Helden⟧
- ⟦Hellefeld⟧
- ⟦Helmstedt⟧
- ⟦Hemer⟧
- ⟦Hemmerde⟧
- ⟦Burg Hemmersbach⟧
- ⟦Henneckenrode⟧
- ⟦Hennef⟧
- ⟦Hennen⟧
- ⟦Herbede⟧
- ⟦Herbern⟧
- ⟦Herchen⟧
- ⟦Herdecke⟧
- ⟦Herdringen⟧
- ⟦Herford⟧
- ⟦Hergenrath⟧
- ⟦Herkenrath⟧
- ⟦Hermannsburg⟧
- ⟦Herrenstrunden⟧
- ⟦Herrhausen⟧
- ⟦Herringen⟧
- ⟦Herten⟧
- ⟦Hervest⟧
- ⟦Herzberg am Harz⟧
- ⟦Herzebrock⟧
- ⟦Herzfeld⟧
- ⟦Herzlake⟧
- ⟦Herzogenrath⟧
- ⟦Hessen⟧
- ⟦Hetjershausen⟧
- ⟦Heuerßen⟧
- ⟦Hevensen⟧
- ⟦Hiddestorf⟧
- ⟦Hilbeck⟧
- ⟦Hilden⟧
- ⟦Hildesheim⟧
- ⟦Hiltrup⟧
- ⟦Hilwartshausen⟧
- ⟦Himmelgeist⟧
- ⟦Himmelpforten⟧
- ⟦Himmelpforten⟧
- ⟦Hinsbeck⟧
- ⟦Hirschberg⟧
- ⟦Hittfeld⟧
- ⟦Hoch Elten⟧
- ⟦Hoch Elten⟧
- ⟦Hoetmar⟧
- ⟦Hehlen⟧
- ⟦Hohenbostel⟧
- ⟦Hohenbudberg⟧
- ⟦Hohendodeleben⟧
- ⟦Hochemmerich⟧
- ⟦Hohengöhren⟧
- ⟦Hohenhameln⟧
- ⟦Hohenkirchen⟧
- ⟦Hohenrode⟧
- ⟦Hohenseeden⟧
- ⟦Hohenziatz⟧
- ⟦Burg Hohnstein⟧
- ⟦Holdenstedt⟧
- ⟦Holle⟧
- ⟦Hollern⟧
- ⟦Hollwinkel⟧
- ⟦Schloß Holte⟧
- ⟦Holtensen⟧
- ⟦Holtensen bei Weetzen⟧
- ⟦Holthausen⟧
- ⟦Holtrup⟧
- ⟦Holzhausen Zwei⟧
- ⟦Bad Holzhausen⟧
- ⟦Holzminden⟧
- ⟦Homberg⟧
- ⟦Homburg⟧
- ⟦Stadtoldendorf⟧
- ⟦Bad Honnef⟧
- ⟦Honrath⟧
- ⟦Hoppenstedt⟧
- ⟦Hopsten⟧
- ⟦Horbach⟧
- ⟦Hörde⟧
- ⟦Horn⟧
- ⟦Hornburg⟧
- ⟦Hörsingen⟧
- ⟦Hörste⟧
- ⟦Horstmar⟧
- ⟦Hötensleben⟧
- ⟦Hoven⟧
- ⟦Hovestadt⟧
- ⟦Höxter⟧
- ⟦Hoya⟧
- ⟦Hoym⟧
- ⟦Hubbelrath⟧
- ⟦Huckarde⟧
- ⟦Hückelhoven⟧
- ⟦Hückeswagen⟧
- ⟦Hude⟧
- ⟦Hudemühlen⟧
- ⟦Hürth⟧
- ⟦Schloß Hugenpoet⟧
- ⟦Huisberden⟧
- ⟦Hülchrath⟧
- ⟦Hüls⟧
- ⟦Hülsede⟧
- ⟦Burg Hülshoff⟧
- ⟦Hundisburg⟧
- ⟦Huntlosen⟧
- ⟦Hünxe⟧
- ⟦Huysburg⟧
- 223-230 Ibbenbüren – Iversheim
-
230-303
Kabelitz – Kuhfelde
- ⟦Ivenrode⟧
- ⟦Iversheim⟧
- ⟦Kabelitz⟧
- ⟦Kade⟧
- ⟦Kaiserswerth⟧
- ⟦Calbe⟧
- ⟦Käcklitz⟧
- ⟦Calberwisch⟧
- ⟦Kaldenkirchen⟧
- ⟦Kalkar⟧
- ⟦Kalkum⟧
- ⟦Kallenhardt⟧
- ⟦Kloster Kamp⟧
- ⟦Kampen⟧
- ⟦Campen⟧
- ⟦Canum⟧
- ⟦Lippstadt⟧
- ⟦Kapellen⟧
- ⟦Cappeln⟧
- ⟦Kappenberg⟧
- ⟦Karow⟧
- ⟦Castrop-Rauxel⟧
- ⟦Kathrinhagen⟧
- ⟦Katlenburg-Lindau⟧
- ⟦Cattenstedt⟧
- ⟦Kaunitz⟧
- ⟦Celle⟧
- ⟦Kellen⟧
- ⟦Kloster Kemnade⟧
- ⟦Kempen⟧
- ⟦Kendenich⟧
- ⟦Stift Keppel⟧
- ⟦Kerpen⟧
- ⟦Kessel⟧
- ⟦Kessenich⟧
- ⟦Kettenis⟧
- ⟦Kevelaer⟧
- ⟦Keyenberg⟧
- ⟦Kierdorf⟧
- ⟦Kipshoven⟧
- ⟦Kirchborchen⟧
- ⟦Kirchbrak⟧
- ⟦Kirchderne⟧
- ⟦Kirchdorf⟧
- ⟦Kirchheim⟧
- ⟦Kirchhorst⟧
- ⟦Kirchhundem⟧
- ⟦Kirchlinde⟧
- ⟦Kirchlinteln⟧
- ⟦Kirchrode⟧
- ⟦Kirchtimke⟧
- ⟦Kirchveischede⟧
- ⟦Kirchwalsede⟧
- ⟦Kissenbrück⟧
- ⟦Kläden⟧
- ⟦Kläden⟧
- ⟦Clarholz⟧
- ⟦Kleinbadegast⟧
- ⟦Erxleben⟧
- ⟦Kleinenbremen⟧
- ⟦Kleinbüllesheim⟧
- ⟦Klein Himstedt⟧
- ⟦Kleinpaschleben⟧
- ⟦Klein Quenstedt⟧
- ⟦Kleinschwechten⟧
- ⟦Schloß Clemenswerth⟧
- ⟦Klepps⟧
- ⟦Kleve⟧
- ⟦Cleverns⟧
- ⟦Klietz⟧
- ⟦Kloster Gröningen⟧
- ⟦Kloster Neuendorf⟧
- ⟦Clus⟧
- ⟦Kloster Knechtsteden⟧
- ⟦Kneitlingen⟧
- ⟦Cobbenrode⟧
- ⟦Cochstedt⟧
- ⟦Coesfeld⟧
- ⟦Kofferen⟧
- ⟦Kohlhagen⟧
- ⟦Cölbigk⟧
- ⟦Kolborn⟧
- ⟦Köln⟧
- ⟦Königswinter⟧
- ⟦Konradsheim⟧
- ⟦Konzen⟧
- ⟦Coppenbrügge⟧
- ⟦Korbach⟧
- ⟦Körbecke⟧
- ⟦Kornelimünster⟧
- ⟦Imperial Abbey of Corvey⟧
- ⟦Cösitz⟧
- ⟦Coswig⟧
- ⟦Köthen⟧
- ⟦Kurl⟧
- ⟦Kranenburg⟧
- ⟦Krapendorf⟧
- ⟦Krefeld⟧
- ⟦Kreuzau⟧
- ⟦Krevese⟧
- ⟦Schloß Krickenbeck⟧
- ⟦Krombach⟧
-
303-327
Laasphe – Luttrum
- ⟦Kroppenstedt⟧
- ⟦Krottorf⟧
- ⟦Krückeberg⟧
- ⟦Münster⟧
- ⟦Küdinghoven⟧
- ⟦Kuhfelde⟧
- ⟦Bad Laasphe⟧
- ⟦Laatzen⟧
- ⟦Lachem⟧
- ⟦Laer⟧
- ⟦Lage⟧
- ⟦Lahde⟧
- ⟦Lamersdorf⟧
- ⟦Lamspringe⟧
- ⟦Landsberg am Lech⟧
- ⟦Langeln⟧
- ⟦Langelsheim⟧
- ⟦Langenberg⟧
- ⟦Langenberg⟧
- ⟦Langendorf⟧
- ⟦Langenhagen⟧
- ⟦Langenholzen⟧
- ⟦Langenhorst⟧
- ⟦Langensalzwedel⟧
- ⟦Langenstein⟧
- ⟦Langenweddingen⟧
- ⟦Langerwehe⟧
- ⟦Langförden⟧
- ⟦Langlingen⟧
- ⟦Langwaden⟧
- ⟦Langwarden⟧
- ⟦Larrelt⟧
- ⟦Lastrup⟧
- ⟦Lathen⟧
- ⟦Lauenau⟧
- ⟦Lauenburg⟧
- ⟦Moers⟧
- ⟦Laurenzberg⟧
- ⟦Kaarst⟧
- ⟦Lechenich⟧
- ⟦Ledde⟧
- ⟦Leer⟧
- ⟦Leerodt⟧
- ⟦Legden⟧
- ⟦Lehmke⟧
- ⟦Lehre⟧
- ⟦Leichlingen⟧
- ⟦Leitzkau⟧
- ⟦Lemgo⟧
- ⟦Lendersdorf⟧
- ⟦Lengerich⟧
- ⟦Lengerich⟧
- ⟦Lengsdorf⟧
- ⟦Lenne⟧
- ⟦Lennep⟧
- ⟦Lenthe⟧
- ⟦Lessenich⟧
- ⟦Letmathe⟧
- ⟦Lette⟧
- ⟦Leuscheid⟧
- ⟦Levern⟧
- ⟦Liblar⟧
- ⟦Lichterfelde⟧
- ⟦Liebenau⟧
- ⟦Liebenburg⟧
- ⟦Lieberhausen⟧
- ⟦Liesborn⟧
- ⟦Lilienthal⟧
- ⟦Limperich⟧
- ⟦Lindau⟧
- ⟦Düsseldorf⟧
- ⟦Lindtorf⟧
- ⟦Lindern⟧
- ⟦Lindhorst (Schaumb-Lippe)⟧
- ⟦Lindlar⟧
- ⟦Lingen⟧
- ⟦Linn⟧
- ⟦Linnich⟧
- ⟦Jülich⟧
- ⟦Lipp⟧
- ⟦Lippborg⟧
- ⟦Bad Lippspringe⟧
- ⟦Lippstadt⟧
- ⟦Lobberich⟧
- ⟦Loburg⟧
- ⟦Rehburg-Loccum⟧
- ⟦Lohe⟧
- ⟦Lohmar⟧
- ⟦Lohne⟧
- ⟦Lommersum⟧
- ⟦Lontzen⟧
- ⟦Loquard⟧
- ⟦Lövenich⟧
- ⟦Lövenich⟧
- ⟦Loverich⟧
- ⟦Lübbecke⟧
- ⟦Lüchow⟧
- ⟦Luckau⟧
- ⟦Ludendorf⟧
- ⟦Lüdinghausen⟧
- ⟦Lüdingworth⟧
- ⟦Lüffingen⟧
- ⟦Lüftelberg⟧
- ⟦Lügde⟧
- ⟦Lühe⟧
- ⟦Lühnde⟧
- ⟦Luko⟧
- ⟦Lüneburg⟧
- ⟦Lünen⟧
- ⟦Lünern⟧
- ⟦Lütgendortmund⟧
- ⟦Lutter am Barenberge⟧
- ⟦Lüttringhausen⟧
- ⟦Luttrum⟧
-
328-379
Magdeburg – Münstereifel
- ⟦Magdeburg⟧
- ⟦Mahlerten⟧
- ⟦Mahlpfuhl⟧
- ⟦Malgarten⟧
- ⟦Malmédy⟧
- ⟦Mammendorf⟧
- ⟦Mandelsloh⟧
- ⟦Marialinden⟧
- ⟦Marienbaum⟧
- ⟦Marienborn⟧
- ⟦Mariënburg⟧
- ⟦Mariendrebber⟧
- ⟦Marienfeld⟧
- ⟦Marienforst⟧
- ⟦Mariengarten⟧
- ⟦Marienhafe⟧
- ⟦Marienhagen⟧
- ⟦Marienheide⟧
- ⟦Marienloh⟧
- ⟦Marienmünster⟧
- ⟦Marienrode⟧
- ⟦Mariensee⟧
- ⟦Marienstein⟧
- ⟦Mariental⟧
- ⟦Marienthal⟧
- ⟦Hannover⟧
- ⟦Hamm⟧
- ⟦Medingen⟧
- ⟦Meer⟧
- ⟦Meerbeck⟧
- ⟦Mehr⟧
- ⟦Mehrum⟧
- ⟦Meinerzhagen⟧
- ⟦Meiningen⟧
- ⟦Melkow⟧
- ⟦Melle⟧
- ⟦Melverode⟧
- ⟦Menden⟧
- ⟦Mengede⟧
- ⟦Menslage⟧
- ⟦Menzelen⟧
- ⟦Meppen⟧
- ⟦Merken⟧
- ⟦Merode⟧
- ⟦Mersch⟧
- ⟦Merten⟧
- ⟦Merten⟧
- ⟦Merzen⟧
- ⟦Merzenich⟧
- ⟦Merzenich⟧
- ⟦Merzien⟧
- ⟦Meschede⟧
- ⟦Mesum⟧
- ⟦Metelen⟧
- ⟦Methler⟧
- ⟦Mettmann⟧
- ⟦Meyendorf⟧
- ⟦Michaelstein⟧
- ⟦Micheln⟧
- ⟦Midlum⟧
- ⟦Miel⟧
- ⟦Millen⟧
- ⟦Schloß Myllendonk⟧
- ⟦Millingen⟧
- ⟦Mingerode⟧
- ⟦Minden⟧
- ⟦Minsen⟧
- ⟦Minsleben⟧
- ⟦Mintard⟧
- ⟦Misselwarden⟧
- ⟦Möckern⟧
- ⟦Moers⟧
- ⟦Kloster Möllenbeck⟧
- ⟦Molzen⟧
- ⟦Monheim am Rhein⟧
- ⟦Monschau⟧
- ⟦Morenhoven⟧
- ⟦Moringen⟧
- ⟦Moritz⟧
- ⟦Morsbach⟧
- ⟦Morsleben⟧
- ⟦Mosigkau⟧
- ⟦Moyland⟧
- ⟦Much⟧
- ⟦Celle⟧
- ⟦Müden⟧
- ⟦Müddersheim⟧
- ⟦Mutscheid⟧
- ⟦Muffendorf⟧
- ⟦Mühlhausen⟧
- ⟦Mülheim⟧
- ⟦Müllenbach⟧
- ⟦Mulsum⟧
- ⟦Mönninghausen⟧
- ⟦Mönchengladbach⟧
- ⟦Mündelheim⟧
- ⟦Hannoversch Münden⟧
- ⟦Mündt⟧
- ⟦Munster⟧
- ⟦Münster⟧
- ⟦Bad Münstereifel⟧
-
379-392
Neersen – Nümbrecht
- ⟦Neersen⟧
- ⟦Neetze⟧
- ⟦Berwicke⟧
- ⟦Neindorf⟧
- ⟦Neinstedt⟧
- ⟦Nemmenich⟧
- ⟦Bad Nenndorf⟧
- ⟦Nesenitz⟧
- ⟦Nesse⟧
- ⟦Netphen⟧
- ⟦Nettlingen⟧
- ⟦Neuenbeken⟧
- ⟦Wilhelmshaven⟧
- ⟦Wilhelmshaven⟧
- ⟦Neuengeseke⟧
- ⟦Neuenheerse⟧
- ⟦Neuenhof⟧
- ⟦Neuenhuntorf⟧
- ⟦Neuenkirchen⟧
- ⟦Neuenkirchen⟧
- ⟦Neuenkirchen⟧
- ⟦Neuenklitsche⟧
- ⟦Haldensleben I⟧
- ⟦Schloss Neuhaus⟧
- ⟦Neukirchen⟧
- ⟦Neukirchen⟧
- ⟦Kloster Graefenthal Goch⟧
- ⟦Neukloster⟧
- ⟦Neulingen⟧
- ⟦Neundorf (bei Lobenstein)⟧
- ⟦Neundorf⟧
- ⟦Neunkirchen⟧
- ⟦Neunkirchen⟧
- ⟦Neuss⟧
- ⟦Neustadt am Rübenberge⟧
- ⟦Neuwerk⟧
- ⟦Neviges⟧
- ⟦Nikolausberg⟧
- ⟦Nideggen⟧
- ⟦Niederau⟧
- ⟦Niederberg⟧
- ⟦Niederdollendorf⟧
- ⟦Niederdonk⟧
- ⟦Rees⟧
- ⟦Niederkassel⟧
- ⟦Niederkastenholz⟧
- ⟦Niederkrüchten⟧
- ⟦Niederndodeleben⟧
- ⟦Niederntudorf⟧
- ⟦Niederpleis⟧
- ⟦Niedersalwey⟧
- ⟦Niedersickte⟧
- ⟦Niederwenigern⟧
- ⟦Niederzier⟧
- ⟦Zündorf⟧
- ⟦Nieheim⟧
- ⟦Nienberge⟧
- ⟦Nienburg/Saale⟧
- ⟦Nienburg⟧
- ⟦Nieukerk⟧
- ⟦Nievenheim⟧
- ⟦Nordassel⟧
- ⟦Norden⟧
- ⟦Nordherringen⟧
- ⟦Nordhorn⟧
- ⟦Nordkirchen⟧
- ⟦Nordleda⟧
- ⟦Helmstedt⟧
- ⟦Nordwalde⟧
- ⟦Norf⟧
- ⟦Nörten-Hardenberg⟧
- ⟦Northeim⟧
-
392-409
Oberdollendorf – Oythe
- ⟦Nörvenich⟧
- ⟦Nöschenrode⟧
- ⟦Nothberg⟧
- ⟦Nottuln⟧
- ⟦Nümbrecht⟧
- ⟦Oberdollendorf⟧
- ⟦Oberembt⟧
- ⟦Obergartzem⟧
- ⟦Oberholzklau⟧
- ⟦Oberhundem⟧
- ⟦Oberkassel⟧
- ⟦Obermarsberg⟧
- ⟦Obernkirchen⟧
- ⟦Oberntudorf⟧
- ⟦Oberpleis⟧
- ⟦Zündorf⟧
- ⟦Ochsendorf⟧
- ⟦Odendorf⟧
- ⟦Odenthal⟧
- ⟦Oebisfelde⟧
- ⟦Oekoven⟧
- ⟦Oedt⟧
- ⟦Kloster Oelinghausen⟧
- ⟦Oelber am weißen Wege⟧
- ⟦Oelde⟧
- ⟦Oerel⟧
- ⟦Oerlinghausen⟧
- ⟦Kloster Oesede⟧
- ⟦Oestinghausen⟧
- ⟦Münster⟧
- ⟦Ohle⟧
- ⟦Ohligs⟧
- ⟦Ohrdorf⟧
- ⟦Ohrum⟧
- ⟦Ohsen⟧
- ⟦Oidtweiler⟧
- ⟦Oldenburg⟧
- ⟦Preußisch Oldendorf⟧
- ⟦Hessisch Oldendorf⟧
- ⟦Oldendorf⟧
- ⟦Oldenrode⟧
- ⟦Oldenstadt⟧
- ⟦Oldersum⟧
- ⟦Oldorf⟧
- ⟦Ollheim⟧
- ⟦Olpe⟧
- ⟦Olvenstedt⟧
- ⟦Opherdicke⟧
- ⟦Ophoven⟧
- ⟦Opperhausen⟧
- ⟦Oranienbaum⟧
- ⟦Orsoy⟧
- ⟦Oschersleben⟧
- ⟦Osmarsleben⟧
- ⟦Osnabrück⟧
- ⟦Ostbevern⟧
- ⟦Ostenfelde⟧
- ⟦Ostenholz⟧
- ⟦Osterburg⟧
- ⟦Osterholz-Scharmbeck⟧
- ⟦Osterode am Harz⟧
- ⟦Osterwieck⟧
- ⟦Osterwohle⟧
- ⟦Ostinghausen⟧
- ⟦Ostönnen⟧
- ⟦Ottenstein⟧
-
409-421
Paddingbüttel – Pyrmont
- ⟦Otterndorf⟧
- ⟦Overath⟧
- ⟦Oythe⟧
- ⟦Padingbüttel⟧
- ⟦Paderborn⟧
- ⟦Paffrath⟧
- ⟦Pakens⟧
- ⟦Übach-Palenberg⟧
- ⟦Parey⟧
- ⟦Paaschberg⟧
- ⟦Pattensen⟧
- ⟦Peine⟧
- ⟦Pelkum⟧
- ⟦Petershagen⟧
- ⟦Petzen⟧
- ⟦Paffendorf⟧
- ⟦Pietzpuhl⟧
- ⟦Pilsum⟧
- ⟦Plate⟧
- ⟦Plesse⟧
- ⟦Plettenberg⟧
- ⟦Plittersdorf⟧
- ⟦Plötzkau⟧
- ⟦Pöhlde⟧
- ⟦Polle⟧
- ⟦Poppelsdorf⟧
- ⟦Pötnitz⟧
- ⟦Pulheim⟧
- ⟦Pretzien⟧
- ⟦Preußisch Oldendorf⟧
- ⟦Puderbach⟧
- ⟦Pustekrei⟧
- ⟦Pützchen⟧
- ⟦Bad Pyrmont⟧
- 422-426 Quakenbrück – Quedlinburg
-
426-439
Raennland – Ruthe
- ⟦Kreis Siegen-Wittgenstein⟧
- ⟦Raesfeld⟧
- ⟦Rahrbach⟧
- ⟦Ramelsloh⟧
- ⟦Ramersdorf⟧
- ⟦Ramsdorf⟧
- ⟦Rastede⟧
- ⟦Ratingen⟧
- ⟦Raven⟧
- ⟦Ravensburg⟧
- ⟦Recklinghausen⟧
- ⟦Redekin⟧
- ⟦Reepsholt⟧
- ⟦Rees⟧
- ⟦Refrath⟧
- ⟦Burg Regenstein⟧
- ⟦Rehme⟧
- ⟦Reinhausen⟧
- ⟦Remblinghausen⟧
- ⟦Remscheid⟧
- ⟦Aachen⟧
- ⟦Repelen⟧
- ⟦Rethmar⟧
- ⟦Rheda⟧
- ⟦Rheden⟧
- ⟦Rheinbach⟧
- ⟦Rheinberg⟧
- ⟦Rheindorf⟧
- ⟦Rheine⟧
- ⟦Rheinkassel⟧
- ⟦Rheydt⟧
- ⟦Rhoden⟧
- ⟦Rhynern⟧
- ⟦Richrath⟧
- ⟦Schloß Ricklingen⟧
- ⟦Riddagshausen⟧
- ⟦Riechenberg⟧
- ⟦Rieder⟧
- ⟦Riesenbeck⟧
- ⟦Rietberg⟧
- ⟦Rimburg⟧
- ⟦Rindtorf⟧
- ⟦Ringelheim⟧
- ⟦Ringenberg⟧
- ⟦Schweinheim⟧
- ⟦Rinkerode⟧
- ⟦Rinteln⟧
- ⟦Ristedt⟧
- ⟦Ritze⟧
- ⟦Rodenberg House⟧
- ⟦Rodenkirchen⟧
- ⟦Rodenkirchen⟧
- ⟦Rodewald⟧
- ⟦Rödingen⟧
- ⟦Rödinghausen⟧
- ⟦Rölsdorf⟧
- ⟦Rösrath⟧
- ⟦Rogätz⟧
- ⟦Rohrberg⟧
- ⟦Rohrsheim⟧
- ⟦Roisdorf⟧
- ⟦Römershagen⟧
- ⟦Rommerskirchen⟧
- ⟦Römstedt⟧
- ⟦Ronnenberg⟧
- ⟦Rosbach⟧
- ⟦Rösberg⟧
- ⟦Rosian⟧
- ⟦Roßdorf⟧
- ⟦Roßlau⟧
- ⟦Rotenburg⟧
- ⟦Röttgen⟧
-
439-476
Saalhausen – Surenburg
- ⟦Röwitz⟧
- ⟦Roxel⟧
- ⟦Ründeroth⟧
- ⟦Rüngsdorf⟧
- ⟦Ruppichteroth⟧
- ⟦Ruthe⟧
- ⟦Saalhausen⟧
- ⟦Saarn⟧
- ⟦Bad Sachsa⟧
- ⟦Sachsenhagen⟧
- ⟦Saerbeck⟧
- ⟦Salder⟧
- ⟦Salzbergen⟧
- ⟦Salzdahlum⟧
- ⟦Salzderhelden⟧
- ⟦Bad Salzdetfurth⟧
- ⟦Salzkotten⟧
- ⟦Bad Salzuflen⟧
- ⟦Satzvey⟧
- ⟦Salzwedel⟧
- ⟦Sambleben⟧
- ⟦Samswegen⟧
- ⟦Sandau⟧
- ⟦Sandbeiendorf⟧
- ⟦Sande⟧
- ⟦Sandersleben⟧
- ⟦Sankt Tönis⟧
- ⟦Sankt Vit⟧
- ⟦Saint-Vith⟧
- ⟦Sanne⟧
- ⟦Sassenberg⟧
- ⟦Bad Sassendorf⟧
- ⟦Schale⟧
- ⟦Schapdetten⟧
- ⟦Osterholz-Scharmbeck⟧
- ⟦Scharnebeck⟧
- ⟦Schaumburg⟧
- ⟦Scheeßel⟧
- ⟦Scheidingen⟧
- ⟦Schelenburg⟧
- ⟦Rellinghausen⟧
- ⟦Schellerten⟧
- ⟦Schermbeck⟧
- ⟦Scheventorf⟧
- ⟦Schieder-Schwalenberg⟧
- ⟦Schildesche⟧
- ⟦Schinna⟧
- ⟦Schlanstedt⟧
- ⟦Schleiden⟧
- ⟦Schlewecke⟧
- ⟦Schliestedt⟧
- ⟦Schliprüthen⟧
- ⟦Schmallenberg⟧
- ⟦Schmetzdorf⟧
- ⟦Schnarsleben⟧
- ⟦Schnega⟧
- ⟦Schnellenberg⟧
- ⟦Schönau⟧
- ⟦Schönebeck⟧
- ⟦Schönemoor⟧
- ⟦Schönhausen⟧
- ⟦Schönholthausen⟧
- ⟦Schöningen⟧
- ⟦Schophoven⟧
- ⟦Schöppenstedt⟧
- ⟦Schöppingen⟧
- ⟦Schortens⟧
- ⟦Schüttorf⟧
- ⟦Schieder-Schwalenberg⟧
- ⟦Schwanebeck⟧
- ⟦Schwanenberg⟧
- ⟦Schwarmstedt⟧
- ⟦Schwarz Rheindorf⟧
- ⟦Schwelm⟧
- ⟦Schwerte⟧
- ⟦Schwöbber⟧
- ⟦Seehausen (Altmark)⟧
- ⟦Seehausen⟧
- ⟦Seelze⟧
- ⟦Seesen⟧
- ⟦Segelhorst⟧
- ⟦Seligental⟧
- ⟦Selm⟧
- ⟦Selsingen⟧
- ⟦Senden⟧
- ⟦Sengwarden⟧
- ⟦Seppenrade⟧
- ⟦Siedengrieben⟧
- ⟦Siegburg⟧
- ⟦Siegen⟧
- ⟦Sieglar⟧
- ⟦Siersdorf⟧
- ⟦Sillenstede⟧
- ⟦Silstedt⟧
- ⟦Sindorf⟧
- ⟦Sinzenich⟧
- ⟦Sittensen⟧
- ⟦Söder⟧
- ⟦Soest⟧
- ⟦Solingen⟧
- ⟦Soltau⟧
- ⟦Sommerschenburg⟧
- ⟦Sommersdorf⟧
- ⟦Sonnborn⟧
- ⟦Sonsbeck⟧
- ⟦Sottmar⟧
- ⟦Stade⟧
- ⟦Stadthagen⟧
- ⟦Stadtlohn⟧
- ⟦Stadtoldendorf⟧
- ⟦Staffelde⟧
- ⟦Stammheim⟧
- ⟦Staßfurt⟧
- ⟦Stecklenberg⟧
- ⟦Stederdorf⟧
- ⟦Stegelitz⟧
- ⟦Steinfeld⟧
- ⟦Steinfelde⟧
- ⟦Steinhagen⟧
- ⟦Steinhorst⟧
- ⟦Stellichte⟧
- ⟦Stendal⟧
- ⟦Steterburg⟧
- ⟦Stieldorf⟧
- ⟦Stiepel⟧
- ⟦Borgholzhausen⟧
- ⟦Stockum⟧
- ⟦Stolberg⟧
- ⟦Stommeln⟧
- ⟦Stoppenberg⟧
- ⟦Storkau⟧
- ⟦Störmede⟧
- ⟦Stötterlingen⟧
- ⟦Kloster Stötterlingenburg⟧
- ⟦Stotzheim⟧
- ⟦Straelen⟧
- ⟦Stromberg⟧
- ⟦Stuhr⟧
- ⟦Styrum⟧
- ⟦Süchteln⟧
- ⟦Suderburg⟧
- ⟦Bad Suderode⟧
- ⟦Südkirchen⟧
- ⟦Südlohn⟧
- ⟦Süggerath⟧
- ⟦Sülldorf⟧
- ⟦Sünninghausen⟧
- ⟦Süpplingenburg⟧
- 476-479 Tangeln – Tylsen
- 479-481 Uchtdorf – Uttum
-
482-489
Varel – Vreden
- ⟦Varel⟧
- ⟦Varenholz⟧
- ⟦Varste⟧
- ⟦Vasbeck⟧
- ⟦Vechta⟧
- ⟦Veckenstedt⟧
- ⟦Veen⟧
- ⟦Veerßen⟧
- ⟦Veenhusen⟧
- ⟦Vellern⟧
- ⟦Veltheim⟧
- ⟦Veltheim⟧
- ⟦Veltheim⟧
- ⟦Verden⟧
- ⟦Verl⟧
- ⟦Werne⟧
- ⟦Versmold⟧
- ⟦Köln⟧
- ⟦Viersen⟧
- ⟦Viesen⟧
- ⟦Vilich⟧
- ⟦Vilsen⟧
- ⟦Milte⟧
- ⟦Burg Vischering⟧
- ⟦Vlotho⟧
- ⟦Volberg⟧
- ⟦Völkenrode⟧
- ⟦Blankenburg⟧
- ⟦Völlinghausen⟧
- ⟦Tönisvorst⟧
- ⟦Vreden⟧
-
489-519
Wachtendonck – Wust
- ⟦Wachtendonk⟧
- ⟦Waddewarden⟧
- ⟦Wadersloh⟧
- ⟦Wahn⟧
- ⟦Walbeck⟧
- ⟦Walbeck⟧
- ⟦Solingen⟧
- ⟦Waldbröl⟧
- ⟦Waldeck⟧
- ⟦Waldfeucht⟧
- ⟦Walhorn⟧
- ⟦Walkenried⟧
- ⟦Wallenhorst⟧
- ⟦Alt Wallmoden⟧
- ⟦Wallstawe⟧
- ⟦Wallwitz⟧
- ⟦Walsleben⟧
- ⟦Walsrode⟧
- ⟦Waltrop⟧
- ⟦Wanlo⟧
- ⟦Wanzleben⟧
- ⟦Warbsen⟧
- ⟦Warburg⟧
- ⟦Warsaw⟧
- ⟦Warendorf⟧
- ⟦Warstein⟧
- ⟦Wassenberg⟧
- ⟦Wathlingen⟧
- ⟦Watzum⟧
- ⟦Wechold⟧
- ⟦Wedringen⟧
- ⟦Weeze⟧
- ⟦Wefensleben⟧
- ⟦Weferlingen⟧
- ⟦Weferlingen⟧
- ⟦Wegeleben⟧
- ⟦Wehrstedt⟧
- ⟦Weilerswist⟧
- ⟦Waimes⟧
- ⟦Weisweiler⟧
- ⟦Welbergen⟧
- ⟦Welsleben⟧
- ⟦Welver⟧
- ⟦Wenau⟧
- ⟦Wendeburg⟧
- ⟦Wenden⟧
- ⟦Wendlinghausen⟧
- ⟦Wenholthausen⟧
- ⟦Wennigsen⟧
- ⟦Werben⟧
- ⟦Werden⟧
- ⟦Werdohl⟧
- ⟦Werl⟧
- ⟦Wermelskirchen⟧
- ⟦Werne⟧
- ⟦Wernigerode⟧
- ⟦Wersen⟧
- ⟦Wesel⟧
- ⟦Weslarn⟧
- ⟦Westbevern⟧
- ⟦Westen⟧
- ⟦Westeraccum⟧
- ⟦Westerburg⟧
- ⟦Westerhüsen⟧
- ⟦Westerkappeln⟧
- ⟦Westerstede⟧
- ⟦Schloß Westerwinkel⟧
- ⟦Wettringen⟧
- ⟦Weweler⟧
- ⟦Wewelsburg⟧
- ⟦Wewer⟧
- ⟦Wiblingwerde⟧
- ⟦Wichmannsburg⟧
- ⟦Wichterich⟧
- ⟦Wickede⟧
- ⟦Wickrathberg⟧
- ⟦Wiedelah⟧
- ⟦Rheda-Wiedenbrück⟧
- ⟦Wiedenest⟧
- ⟦Wiefelstede⟧
- ⟦Wienhausen⟧
- ⟦Wienrode⟧
- ⟦Wiebrechtshausen⟧
- ⟦Wietzen⟧
- ⟦Wildeshausen⟧
- ⟦Wilkenburg⟧
- ⟦Willebadessen⟧
- ⟦Willich⟧
- ⟦Wilstedt⟧
- ⟦Windheim⟧
- ⟦Wingeshausen⟧
- ⟦Winnenthal⟧
- ⟦Winsen⟧
- ⟦Winterscheid⟧
- ⟦Wipperfürth⟧
- ⟦Wirtzfeld⟧
- ⟦Wissel⟧
- ⟦Wissen⟧
- ⟦Porta Westfalica⟧
- ⟦Wittenburg⟧
- ⟦Wittingen⟧
- ⟦Wittlaer⟧
- ⟦Witzhelden⟧
- ⟦Wolbeck⟧
- ⟦Wolfenbüttel⟧
- ⟦Wolfsburg⟧
- ⟦Wulsdorf⟧
- ⟦Wunstorf⟧
- ⟦Wüppels⟧
- 519-524 Xanten
- 524-528 Zerbst – Zyfflich
- 529-531 Nachträge zu den altmärkischen Kreisen Osterburg, Salzwedel und Stendal
- 532-542 Ortsverzeichnis
- 543-546 Künstlerverzeichnis
- Maßstab/Farbkeil
Knie
— 115 —
limin
was von der Mauer übrig bleibt, in Sandsteinrustika. Am Erd-
geschoß lief ursp. eine (1734 abgebr.) Bogenhalle hin; eben damals
das große Eingangstor in die jetzige Gestalt gebracht. Es folgen:
ein niedriges Mezzanin, das hohe Hauptgeschoß und zum Schluß
eine offene, vorgekragte Galerie mit geradem Gebälk. Die Mitte
außer jenem Tor durch einen kleinen Ziergiebel und einen statt-
lichen, in Holz ausgeführten Dachreiter betont. Doch bildet sie
nicht die mathematische Mitte; sie hat zur Rechten 10, zur Linken
nur 7 Achsen. Die innere Einteilung nicht mehr die alte. Öffent-
lichen Zwecken diente ursp. nur das Hauptgeschoß; in den beiden
unteren waren Wohnungen und Kaufläden. — Waffensammlung
und schöne Silbergefäße der Renss.
In der Achse des Rathauses die in derselben Zeit ausgeführte
Brücke, 5 Bgg. in Backstein mit reichem Sandsteinschmuck.
Backsteinhäuser des 16. und 17. Jh. in holländischem Charakter.
EMERSLEBEN. Pr. Sachsen Kr. Halberstadt.
Dorf-K. Rom. T., Sch. 1742. — Ansehnliches Mobiliar IS. Jh.
Hübsche got. Truhe. Mehrere ikon. Grabsteine 16. Jh.
EMMERICH. RB Düsseidf. Kr. Rees.
Münster-K. S. Martin. Erster Bau um M. 11. Jh., nach Zerstörung
1145 in größerem Umfange whgest. Die Veränderung des Rhein-
laufes brachte im 13. und noch einmal im 14. Jh. den WBau zu
Fall. Vom rom. Bau erhalten die OPartie und die Vierungspfll.
Quadr. Hauptchor und rck. Nebenchöre. Die letzteren in 2 Ge-
schossen nach der Tonne gewölbt (die s nach dem alten Muster er-
neuert). Im Hauptchor hölzernes Tonnengwb., über demselben An-
sätze eines ehem. rom. Gwb. Die 3 Apsiden innen lh kr., außen
polygonal (wann?), spitzbg. Fenster aus 17. Jh. Der interessanteste
Teil die Krypta. Die gurtenlosen Gratgwbb. werden von 3 Pfl.-
Paaren getragen. Alle 3 verschieden: 1. Rundpfll. mit 16 kon-
vexen Riefelungen, 2. Bündel von S Rundstäben ins Quadrat ge-
stellt, 3. Bündel von 4 Rundstäben. Die Basen und Kaptt. eigen-
tümlich flach gedrückt, die letzteren Derivate der Würfelform
(Verwandtes in westfälischen Krypten, Abdinghof, Vreden, Frecken-
horst). In der Apsis rom. Flurbelag mit Inschr. Der kurze
WArm ein Notbehelf ohne Interesse. — Chorgestühl 1486
(derselbe Meister arbeitete in Kappenberg); die vollständigst erhal-
tenen aui Niederrhein. Der Aufbau im Sinne der Tischlertechnik,
ohne Nachahmung von Architekturformen. Die Rückwand 2gesch.
in Felder geteilt, die unteren mit Maßwerkabschluß, die oberen
mit prächtigen Wappen gefüllt, an den Miserikordien Szenen aus
der Tierfabel. — Taufbrunnen, Gelbguß, M. 16. Jh. Für die
Figg. z. T. ältere Gußformen benutzt (Verwandtes mehrfach in den
8*
— 115 —
limin
was von der Mauer übrig bleibt, in Sandsteinrustika. Am Erd-
geschoß lief ursp. eine (1734 abgebr.) Bogenhalle hin; eben damals
das große Eingangstor in die jetzige Gestalt gebracht. Es folgen:
ein niedriges Mezzanin, das hohe Hauptgeschoß und zum Schluß
eine offene, vorgekragte Galerie mit geradem Gebälk. Die Mitte
außer jenem Tor durch einen kleinen Ziergiebel und einen statt-
lichen, in Holz ausgeführten Dachreiter betont. Doch bildet sie
nicht die mathematische Mitte; sie hat zur Rechten 10, zur Linken
nur 7 Achsen. Die innere Einteilung nicht mehr die alte. Öffent-
lichen Zwecken diente ursp. nur das Hauptgeschoß; in den beiden
unteren waren Wohnungen und Kaufläden. — Waffensammlung
und schöne Silbergefäße der Renss.
In der Achse des Rathauses die in derselben Zeit ausgeführte
Brücke, 5 Bgg. in Backstein mit reichem Sandsteinschmuck.
Backsteinhäuser des 16. und 17. Jh. in holländischem Charakter.
EMERSLEBEN. Pr. Sachsen Kr. Halberstadt.
Dorf-K. Rom. T., Sch. 1742. — Ansehnliches Mobiliar IS. Jh.
Hübsche got. Truhe. Mehrere ikon. Grabsteine 16. Jh.
EMMERICH. RB Düsseidf. Kr. Rees.
Münster-K. S. Martin. Erster Bau um M. 11. Jh., nach Zerstörung
1145 in größerem Umfange whgest. Die Veränderung des Rhein-
laufes brachte im 13. und noch einmal im 14. Jh. den WBau zu
Fall. Vom rom. Bau erhalten die OPartie und die Vierungspfll.
Quadr. Hauptchor und rck. Nebenchöre. Die letzteren in 2 Ge-
schossen nach der Tonne gewölbt (die s nach dem alten Muster er-
neuert). Im Hauptchor hölzernes Tonnengwb., über demselben An-
sätze eines ehem. rom. Gwb. Die 3 Apsiden innen lh kr., außen
polygonal (wann?), spitzbg. Fenster aus 17. Jh. Der interessanteste
Teil die Krypta. Die gurtenlosen Gratgwbb. werden von 3 Pfl.-
Paaren getragen. Alle 3 verschieden: 1. Rundpfll. mit 16 kon-
vexen Riefelungen, 2. Bündel von S Rundstäben ins Quadrat ge-
stellt, 3. Bündel von 4 Rundstäben. Die Basen und Kaptt. eigen-
tümlich flach gedrückt, die letzteren Derivate der Würfelform
(Verwandtes in westfälischen Krypten, Abdinghof, Vreden, Frecken-
horst). In der Apsis rom. Flurbelag mit Inschr. Der kurze
WArm ein Notbehelf ohne Interesse. — Chorgestühl 1486
(derselbe Meister arbeitete in Kappenberg); die vollständigst erhal-
tenen aui Niederrhein. Der Aufbau im Sinne der Tischlertechnik,
ohne Nachahmung von Architekturformen. Die Rückwand 2gesch.
in Felder geteilt, die unteren mit Maßwerkabschluß, die oberen
mit prächtigen Wappen gefüllt, an den Miserikordien Szenen aus
der Tierfabel. — Taufbrunnen, Gelbguß, M. 16. Jh. Für die
Figg. z. T. ältere Gußformen benutzt (Verwandtes mehrfach in den
8*