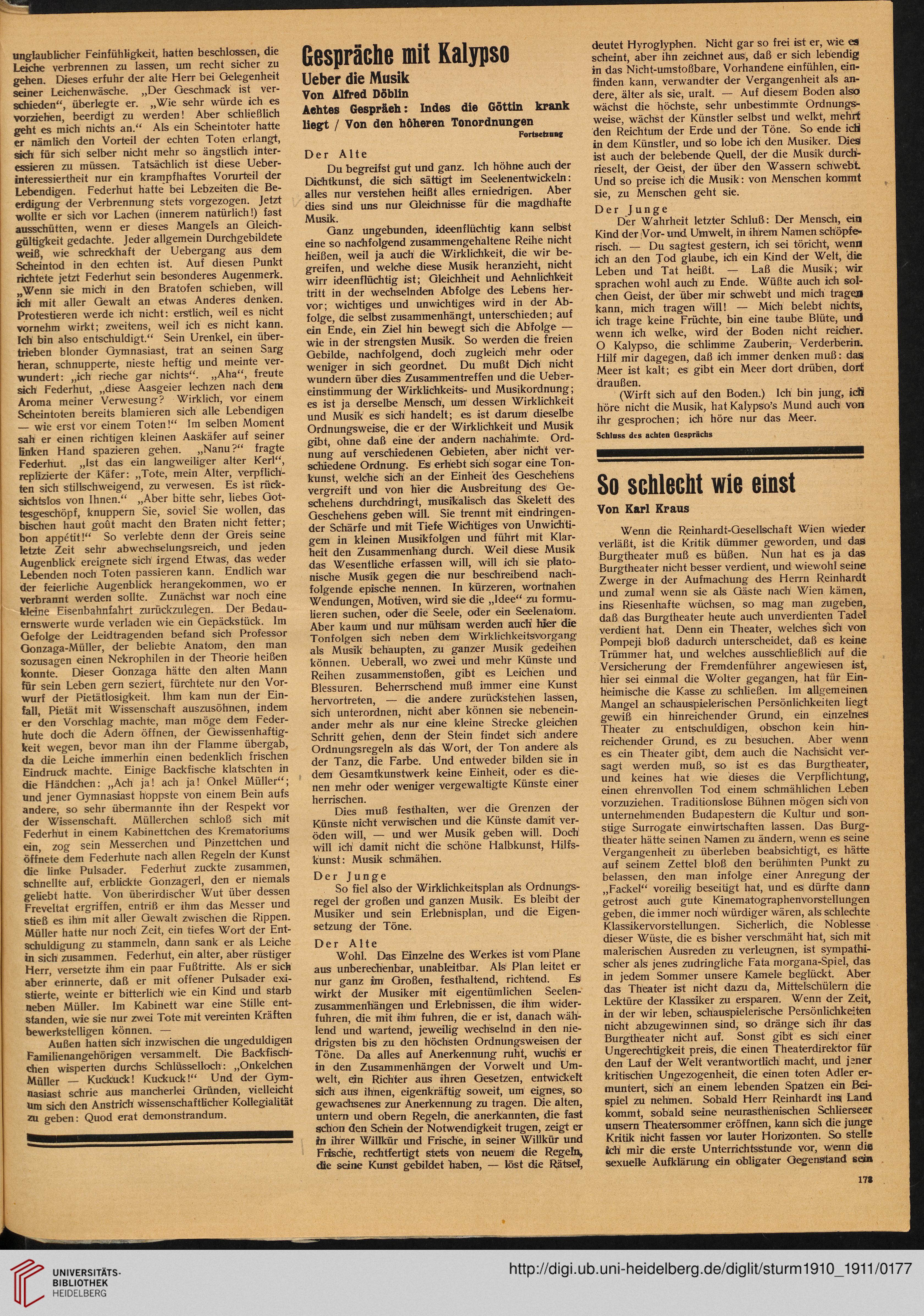unglaublicher Feinfühligkeit, hatten beschlossen, die
Leiche verbrennen zu Iassen, run recht sicher zu
gehen. Dieses erfuhr der alte Herr bei Gelegenheit
seiner Leichenwäsche. „Der Geschmack ist ver-
schieden“, überlegte er. „Wie sehr würde ich es
vorziehen, beerdigt zu werden! Aber schließlich
geht es mich nichts an.“ Als ein Scheintoter hatte
er nämlich den Vorteil der echten Toten erlangt,
sich für sich selber nicht mehr so ängstlich inter-
essieren zu müssen. Tatsächlich ist diese Ueber-
interessiertheit nur ein krampfhaftes Vorurteil der
Lebendigen. Federhüt hatte bei Lebzeiten die Be-
erdigung der Verbrennung stets vorgezogen. Jetzt
wollte er sich vor LaChen (innerem natürlich!) fast
ausschütten, wenn er dieses Mangels an Gleich-
gültigkeit gedachte. Jeder allgemein Durchgebildete
weiß, wie schredchaft der Uebergang aus dem
Scheintod in den echten ist. Auf diesen Punkt
richtete jetzt Federhut sein besonderes Augenmerk.
„Wenn sie mich in den Bratofen sChieben, will
ich mit aller Gewalt an etwas Anderes denken.
Protestieren werde ich nicht: erstlich, weil es nicht
vornehm wirkt; zweitens, weil ich es nicht kann.
Ich bin also entschuldigt.“ Sein Urenkel, ein über-
trieben blonder Gymnasiast, trat an seinen Sarg
heran, schnupperte, nieste heftig und meinte ver-
wundert: „ich rieChe gar nichts“. „Aha“, freute
sich Federhut, „diese Aasgeier leChzen nach dena
Aroma meiner Verwesung? Wirklich, vor einem
Scheintoten bereits blamieren sich alle Lebendigen
— wie erst vor einem Toten!“ Im selben Moment
sah er einen richtigen kleinen Aaskäfer auf seiner
finken Hand spazieren gehen. „Nanu?“ fragte
Federhut. „Ist das' ein langweiliger alter Kerl“,
replizierte der Käfer: „Tote, mein Alter, verpflich-
ten sich stillschweigend, zu verwesen. Es ist riick-
sichtslos von Ihnen.“ „Aber bitte sehr, liebes Got-
tesgeschöpf, knuppern Sie, soviel Sie wollen, das
bischen haut goüt macht den Braten nicht fetter;
bon appetit!“ So verlebte denn der Greis seine
letzte Zeit sehr abwechselungsreich, und jeden
Augenblick ereignete sich irgend EtwaS, das weder
Lebenden noch Toten passieren kann. Endlich war
der feierliche Augenblick herangekommen, wo er
verbrannt werden sollte. Zunächst war noch eine
kleine Eisenbahnfahrt zurückzulegen. Der Bedau-
ernswerte wurde verladen wie ein Gepäckstück. Im
Gefolge der Leidtragenden befand sich Professor
Gonzaga-Müller, der beliebte Anatom, den man
sozusagen einen Nekrophilen in der Theorie heißen
konnte. Dieser Gonzaga hätte den alten Mann
für sein Leben gern seziert, fürchtete nur den Vor-
wurf der Pietätlosigkeit. Ihm kam nun der Ein-
fall, Pietät mit Wissenschaft auszusöhnen, indem
er den Vorschlag machte, man möge dem Feder-
hüte doch die Adern öffnen, der Gewissenhaftig-
keit wegen, bevor man ihn der Flamme übergab,
da die Leiche immerhin einen bedenklich frischen
Eindruck machte. Einige Backfische klatschten in
die Händchen: „Ach ja! ach ja! Onkel Müller“;
und jener Gymnasiast hoppste von einem Bein aufs
andere, so sehr übermannte ihn der Respekt vor
der Wissenschaft. Müllerchen schloß sich mit
Federhut in einem Kabinettchen des Krematoriums
ein, zog sein Messerchen und Pinzettchen und
öffnete dem Federhute nach allen Regeln der Kunst
die linke Pulsader. Federhut zuckte zusammen,
schnellte auf, erblickte Gonzagerl, den er niemals
geliebt hatte. Von überirdischer Wut über dessen
Freveltat ergriffen, entriß er ihm das Messer und
stieß es ihm mit aller Gewalt zwischen die Rippen.
Müller hatte nur noch Zeit, ein tiefes Wort der Ent-
sehuldigung zu stammeln, dann sank er als Leiche
in sich zusammen. Federhut, ein alter, aber rüstiger
Herr, versetzte ihm ein paar Fußtritte. Als er sich
aber erinnerte, daß er mit offener Pulsader exi-
stierte, weinte er bitterlich wie ein Kind und starb
neben Müller. Im Kabinett war eine Stille ent-
standen, wie sie nur zwei Tote mit vereinten Kräften
bewerkstelligen können. —
Außen hatten sich inzwischen die ungeduldigen
Familienangehörigen versammelt. Die BackfisCh-
chen wisperten durChs Schliisselloch: „Onkelcben
Müller — KuCkück! Kuckuck!“ Und der Gym-
nasiast schrie aus mancherlei Gründen, vielleicht
Um sich den Anstrich wissenschaftlicher Kollegialität
zu geben: Quod erat demonstrandum.
Gespräche mit Kalypso
Ueber die Musik
Von Alfred DöbUn
Aehtes Gespräeh: Indes die Göttin krank
Uegt / Von den höheren Tonordnungen
Forteetzaat
Der Alte
Du begreifst gut und ganz. Ich höhne auch der
DiChtkunst, die sich sättigt im Seelenentwickeln:
alles nur verstehen heißt alles erniedrigen. Aber
dies sind ims nur Gleidmisse für die magdhafte
Musik.
Ganz ungebunden, ideenflüchtig kann selbst
eine so naChfolgend zusammengehaltene Reihe nicht
heißen, weil ja auch die WirkliChkeit, die wir be-
greifen, und welChe diese Musik heranzieht, nicht
wirr ideenflüchtig ist; Gleichheit und Aehnlichkeit
tritt in der wechselnden Abfolge des Lebens her-
vor; wichtiges und unwichtiges wird in der Ab-
folge, die selbst zusammenhängt, unterschieden; auf
ein Ende, ein Ziel hin bewegt sich die Abfolge —
wie in der strengsten Musik. So werden die freien
Gebilde, nachfolgend, doch zugleich mehr oder
weniger in sich geordnet. Du mußt Dich nicht
wundern über dies Zusammentreffen und die Ueber-
einstimmung der Wirklichkeits- und Musikordnung;
es ist ja derselbe Mensch, um dessen Wirklichkeit
und Musik es sich handelt; es ist darum dieselbe
Ordnungsweise, die er der Wirklichkeit und Musik
gibt, ohne daß eine der andern nachahüite. Ord-
nung auf verschiedenen Gebieten, aber nicht ver-
schiedene Ordnung. Es erhebt sich sogar eine Ton-
künst, welche sich an der Einheit des Geschehens
vergreift und von hier die Ausbreitung des Ge-
schehens durchdringt, musikalisch das Skelett des
Geschehens geben will. Sie trennt mit eindringen-
der Schärfe und mit Tiefe WiChtiges von Unwichti-
gem in kleinen Musikfolgen und füh'rt mit Klar-
heit den Zusammenhang durch. Weil diese Musik
das Wesentliche erfassen will, will ich sie plato-
nische Musik gegen die nur besChreibend nach-
folgende epische nennen. In kürzeren, wortnahen
Wendungen, Motiven, wird sie die „Idee“ zu formu-
lieren suchen, oder die Seele, oder ein Seelenatom.
Aber kaum und nur miihsam werden auch hier die
Tonfolgen sidh neben dem WirklichkeitsMorgang
als Musik behäupten, zu ganzer Musik gedeihen
können. Ueberall, wo zwei und mehr Künste und
Reihen zusammenstoßen, gibt es Leichen und
Blessuren. Beherrschend muß: immer eine Kunst
hervortreten, — die andere zurückstehen lasSen,
sich unterordnen, nicht aber können sie nebenein-
ander mehr als nur eine kleine Strecke gleichen
Schritt gehen, denn der Stein findet sich andere
Ordnungsregeln als däs Wort, der Ton andere als
der Tanz, die Farbe. Und entweder bilden sie in
dem Gesamtkunstwerk keine Einheit, oder es die-
nen mehr oder weniger vergewaltigte Künste einer
herrischen.
Dies muß festhalten, wer die Grenzen der
Künste nicht verwisChen und die Künste damit ver-
öden will, — und wer Musik geben will. Doch
will ich damit nicht die schöne Halbkunst, Hilfs-
kunst: Musik schmähen.
Der Junge
So fiel also der Wirklichkeitsplan als Ordnungs-
regel der großen und ganzen Musik. Es bleibt der
Musiker und sein Erlebnisplan, und die Eigen-
setzung der Töne.
Der Alte
Wohl. Das Einzelne des Werkes ist vom Plane
aus unberechenbar, unableitbar. Als 1 Plan Ieitet er
nur ganz im Großen, festhaltend, richtend. Es
wirkt der Musiker mit eigentümlichen Seelen-
zusammenhängen und Erlebnissen, die ihm wider-
fuhren, die mit ihm fuhren, die er ist, danach wäh-
lend und wartend, jeweilig wechselnd in den nie-
drigsten bis zu den höchsten Ordnungsweisen der
Töne. Da alles auf Anerkennung ruht, wuchs er
in den Zusammenhängen der Vorwelt und Um-
welt, ejn Richter aus ihren Gesetzen, entwickelt
sich aus ihnen, eigenkräftig soweit, um eignes, so
gewaChsenes zur Anerkennung zu tragen. Die alten,
untern und obem Regeln, die anerkännten, die fast
schon den SChein der Notwendigkeit trugen, zeigt er
in ihrer Willkür und Frische, in seiner Willkür und
Frische, reChtfertigt stets von neuem die Regeln,
die seine Kunst gebildet haben, — löst die Rätsel,
deutet Hyroglyphen. Nicht gar so frei ist er, wie es
scheint, aber ihn zeichnet aus, daß er sich lebendig
in das Nicht-umstoßbare, Vorhandene einfühlen, ein-
finden kann, verwandter der Vergangenheit als an-
dere, älter als sie, uralt. — Auf diesem Boden alsö
wächst die höchste, sehr unbestimmte Ordnungs-
weise, wächst der Künstler selbst und welkt, mehrt
den Reichtum der Erde und der Töne. So ende idi
in dem Künstler, und so lobe ich den Musiker. Dies
ist auch der belebende Quell, der die Musik durch-
rieselt, der Geist, der über den Wassern schwebt
Und so preise ich die Musik: von Menschen kommt
sie, zu Menschen geht sie.
Der Junge
Der Wahrheit letzter Schluß : Der Mensch, ein
Kind der Vor- und Umwelt, in ihrem Namen schöpfe-
risch. — Du sagtest gestern, ich sei töricht, wenn
ich an den Tod glaube, ich ein Kind der Welt, die
Leben und Tat heißt. — Laß die Musik; wir
sprachen wohl auch zu Ende. Wüßte auch ich sol-
chen Geist, der über mir schwebt und mich tragen
kann, mich tragen will! — Mich belebt nichtS,
ich trage keine Früchte, bin eine taube Blüte, und
wenn ich welke, wird der Boden nicht reiCher.
O Kalypso, die schlimme Zauberin, Verderberin.
Hilf mir dagegen, daß ich immer denken muß: dasä
Meer ist kalt; es gibt ein Meer dort drüben, dort
draußen.
(Wirft sich auf den Boden.) Ich bin jung, idi
höre nicht die Musik, hat Kalypso’s Mund auch von
ihr gesprochen; ich höre nur das Meer.
Schlnss dts achten Oesprächs
So schlecht wie einst
Von Karl Kraus
Wenn die Reinhardt-Gesellschaft Wien wieder
verläßt, ist die Kritik dümmer geworden, und das
Burgtheater muß es büßen. Nun hat es ja das
Burgtheater nicht besser verdient, und wiewohl seine
Zwerge in der Aufmachung des Herrn Reinhardt
und zumal wenn sie als Gäste nach Wien kämen,
ins Riesenhafte wüchsen, so mag man zugeben,
daßi das Burgtheater heute auCh unverdienten Tadel
verdient hat. Denn ein Theater, welches sich von
Pompeji bloß dadurch unterscheidet, daß es keine
Trümmer hat, und welches ausschließliCh auf die
Versicherung der Fremdenführer angewiesen ist,
hier sei einmal die Wolter gegangen, hat für Ein-
heimische die Kasse zu schließen. Im allgemeinen
Mangel an schäuspielerischen Persönlichkeiten liegt
gewiß ein hinreichender Grund, ein einzelnesl
Theater zu entschuldigen, obschon kein hin-
reichender Grund, es zu besüchen. Aber wenn
es ein Theater gibt, dem auch die Nachsicht ver-
sagt werden muß, so ist es das Burgtheater,
und keines hat wie dieses die Verpflichtung,
einen ehrenvollen Tod einem schmählichen Leben
vorzuziehen. Traditionslose Bühnen mögen sichvon
unternehmenden Budapestern die Kultur und spn-
stige Surrogate einwirtschaften lassen. Das Burg-
theater hätte seinen Namen zu ändern, wenn es seine
Vergangenheit zu überleben beabsichtigt, es hätte
auf seinem Zettel bloß den berühüiten Punkt zu
belassen, den man infolge einer Anregung der
„Fackel“ voreilig beseiügt hat, und es dürfte dann
getrost auch gute Kinematographenvorstellungen
geben, die immer noch würdiger wären, als schlechte
Klassikervorstellungen. Sicherlich, die Noblesse
dieser Wüste, die es bisher verschmäht hat, sich mit
malerischen Ausreden zu verleugnen, ist sympathi-
scher als jenes zudringliche Fata morgana-Spiel, das
in jedem Sommer unsere Kamele beglückt. Aber
das Theater ist nicht dazu da, Mittelschülern die
Lektüre der Klassiker zu ersparen. Wenn der Zeit,
in der wir leben, schäuspielerische Persönlichkeiten
nicht abzugewinnen sind, so dränge sich ihr das
Burgtheater nicht auf. Sonst gibt es sich einer
Ungerechtigkeit preis, die einen Theaterdirektor für
den Lauf der Welt verantwortlich macht, und jener
kritischen Ungezogenheit, die einen toten Adler cr-
muntert, sich an einem lebenden Spatzen ein Bei-
spiel zu nehmen. Sobald Herr Reinhardt insi Land
kommt, sobald seine neurasthenischen Schlierseer
unsern Theatersommer eröffnen, kann sich die junge
Kritik hicht fassen vor lauter Horizonten. So stellt
iCh mir die erste Unterrichtsstunde vor, wenn die
sexuelle Aufklärung ein obligater Gegenstand seiii
17»
Leiche verbrennen zu Iassen, run recht sicher zu
gehen. Dieses erfuhr der alte Herr bei Gelegenheit
seiner Leichenwäsche. „Der Geschmack ist ver-
schieden“, überlegte er. „Wie sehr würde ich es
vorziehen, beerdigt zu werden! Aber schließlich
geht es mich nichts an.“ Als ein Scheintoter hatte
er nämlich den Vorteil der echten Toten erlangt,
sich für sich selber nicht mehr so ängstlich inter-
essieren zu müssen. Tatsächlich ist diese Ueber-
interessiertheit nur ein krampfhaftes Vorurteil der
Lebendigen. Federhüt hatte bei Lebzeiten die Be-
erdigung der Verbrennung stets vorgezogen. Jetzt
wollte er sich vor LaChen (innerem natürlich!) fast
ausschütten, wenn er dieses Mangels an Gleich-
gültigkeit gedachte. Jeder allgemein Durchgebildete
weiß, wie schredchaft der Uebergang aus dem
Scheintod in den echten ist. Auf diesen Punkt
richtete jetzt Federhut sein besonderes Augenmerk.
„Wenn sie mich in den Bratofen sChieben, will
ich mit aller Gewalt an etwas Anderes denken.
Protestieren werde ich nicht: erstlich, weil es nicht
vornehm wirkt; zweitens, weil ich es nicht kann.
Ich bin also entschuldigt.“ Sein Urenkel, ein über-
trieben blonder Gymnasiast, trat an seinen Sarg
heran, schnupperte, nieste heftig und meinte ver-
wundert: „ich rieChe gar nichts“. „Aha“, freute
sich Federhut, „diese Aasgeier leChzen nach dena
Aroma meiner Verwesung? Wirklich, vor einem
Scheintoten bereits blamieren sich alle Lebendigen
— wie erst vor einem Toten!“ Im selben Moment
sah er einen richtigen kleinen Aaskäfer auf seiner
finken Hand spazieren gehen. „Nanu?“ fragte
Federhut. „Ist das' ein langweiliger alter Kerl“,
replizierte der Käfer: „Tote, mein Alter, verpflich-
ten sich stillschweigend, zu verwesen. Es ist riick-
sichtslos von Ihnen.“ „Aber bitte sehr, liebes Got-
tesgeschöpf, knuppern Sie, soviel Sie wollen, das
bischen haut goüt macht den Braten nicht fetter;
bon appetit!“ So verlebte denn der Greis seine
letzte Zeit sehr abwechselungsreich, und jeden
Augenblick ereignete sich irgend EtwaS, das weder
Lebenden noch Toten passieren kann. Endlich war
der feierliche Augenblick herangekommen, wo er
verbrannt werden sollte. Zunächst war noch eine
kleine Eisenbahnfahrt zurückzulegen. Der Bedau-
ernswerte wurde verladen wie ein Gepäckstück. Im
Gefolge der Leidtragenden befand sich Professor
Gonzaga-Müller, der beliebte Anatom, den man
sozusagen einen Nekrophilen in der Theorie heißen
konnte. Dieser Gonzaga hätte den alten Mann
für sein Leben gern seziert, fürchtete nur den Vor-
wurf der Pietätlosigkeit. Ihm kam nun der Ein-
fall, Pietät mit Wissenschaft auszusöhnen, indem
er den Vorschlag machte, man möge dem Feder-
hüte doch die Adern öffnen, der Gewissenhaftig-
keit wegen, bevor man ihn der Flamme übergab,
da die Leiche immerhin einen bedenklich frischen
Eindruck machte. Einige Backfische klatschten in
die Händchen: „Ach ja! ach ja! Onkel Müller“;
und jener Gymnasiast hoppste von einem Bein aufs
andere, so sehr übermannte ihn der Respekt vor
der Wissenschaft. Müllerchen schloß sich mit
Federhut in einem Kabinettchen des Krematoriums
ein, zog sein Messerchen und Pinzettchen und
öffnete dem Federhute nach allen Regeln der Kunst
die linke Pulsader. Federhut zuckte zusammen,
schnellte auf, erblickte Gonzagerl, den er niemals
geliebt hatte. Von überirdischer Wut über dessen
Freveltat ergriffen, entriß er ihm das Messer und
stieß es ihm mit aller Gewalt zwischen die Rippen.
Müller hatte nur noch Zeit, ein tiefes Wort der Ent-
sehuldigung zu stammeln, dann sank er als Leiche
in sich zusammen. Federhut, ein alter, aber rüstiger
Herr, versetzte ihm ein paar Fußtritte. Als er sich
aber erinnerte, daß er mit offener Pulsader exi-
stierte, weinte er bitterlich wie ein Kind und starb
neben Müller. Im Kabinett war eine Stille ent-
standen, wie sie nur zwei Tote mit vereinten Kräften
bewerkstelligen können. —
Außen hatten sich inzwischen die ungeduldigen
Familienangehörigen versammelt. Die BackfisCh-
chen wisperten durChs Schliisselloch: „Onkelcben
Müller — KuCkück! Kuckuck!“ Und der Gym-
nasiast schrie aus mancherlei Gründen, vielleicht
Um sich den Anstrich wissenschaftlicher Kollegialität
zu geben: Quod erat demonstrandum.
Gespräche mit Kalypso
Ueber die Musik
Von Alfred DöbUn
Aehtes Gespräeh: Indes die Göttin krank
Uegt / Von den höheren Tonordnungen
Forteetzaat
Der Alte
Du begreifst gut und ganz. Ich höhne auch der
DiChtkunst, die sich sättigt im Seelenentwickeln:
alles nur verstehen heißt alles erniedrigen. Aber
dies sind ims nur Gleidmisse für die magdhafte
Musik.
Ganz ungebunden, ideenflüchtig kann selbst
eine so naChfolgend zusammengehaltene Reihe nicht
heißen, weil ja auch die WirkliChkeit, die wir be-
greifen, und welChe diese Musik heranzieht, nicht
wirr ideenflüchtig ist; Gleichheit und Aehnlichkeit
tritt in der wechselnden Abfolge des Lebens her-
vor; wichtiges und unwichtiges wird in der Ab-
folge, die selbst zusammenhängt, unterschieden; auf
ein Ende, ein Ziel hin bewegt sich die Abfolge —
wie in der strengsten Musik. So werden die freien
Gebilde, nachfolgend, doch zugleich mehr oder
weniger in sich geordnet. Du mußt Dich nicht
wundern über dies Zusammentreffen und die Ueber-
einstimmung der Wirklichkeits- und Musikordnung;
es ist ja derselbe Mensch, um dessen Wirklichkeit
und Musik es sich handelt; es ist darum dieselbe
Ordnungsweise, die er der Wirklichkeit und Musik
gibt, ohne daß eine der andern nachahüite. Ord-
nung auf verschiedenen Gebieten, aber nicht ver-
schiedene Ordnung. Es erhebt sich sogar eine Ton-
künst, welche sich an der Einheit des Geschehens
vergreift und von hier die Ausbreitung des Ge-
schehens durchdringt, musikalisch das Skelett des
Geschehens geben will. Sie trennt mit eindringen-
der Schärfe und mit Tiefe WiChtiges von Unwichti-
gem in kleinen Musikfolgen und füh'rt mit Klar-
heit den Zusammenhang durch. Weil diese Musik
das Wesentliche erfassen will, will ich sie plato-
nische Musik gegen die nur besChreibend nach-
folgende epische nennen. In kürzeren, wortnahen
Wendungen, Motiven, wird sie die „Idee“ zu formu-
lieren suchen, oder die Seele, oder ein Seelenatom.
Aber kaum und nur miihsam werden auch hier die
Tonfolgen sidh neben dem WirklichkeitsMorgang
als Musik behäupten, zu ganzer Musik gedeihen
können. Ueberall, wo zwei und mehr Künste und
Reihen zusammenstoßen, gibt es Leichen und
Blessuren. Beherrschend muß: immer eine Kunst
hervortreten, — die andere zurückstehen lasSen,
sich unterordnen, nicht aber können sie nebenein-
ander mehr als nur eine kleine Strecke gleichen
Schritt gehen, denn der Stein findet sich andere
Ordnungsregeln als däs Wort, der Ton andere als
der Tanz, die Farbe. Und entweder bilden sie in
dem Gesamtkunstwerk keine Einheit, oder es die-
nen mehr oder weniger vergewaltigte Künste einer
herrischen.
Dies muß festhalten, wer die Grenzen der
Künste nicht verwisChen und die Künste damit ver-
öden will, — und wer Musik geben will. Doch
will ich damit nicht die schöne Halbkunst, Hilfs-
kunst: Musik schmähen.
Der Junge
So fiel also der Wirklichkeitsplan als Ordnungs-
regel der großen und ganzen Musik. Es bleibt der
Musiker und sein Erlebnisplan, und die Eigen-
setzung der Töne.
Der Alte
Wohl. Das Einzelne des Werkes ist vom Plane
aus unberechenbar, unableitbar. Als 1 Plan Ieitet er
nur ganz im Großen, festhaltend, richtend. Es
wirkt der Musiker mit eigentümlichen Seelen-
zusammenhängen und Erlebnissen, die ihm wider-
fuhren, die mit ihm fuhren, die er ist, danach wäh-
lend und wartend, jeweilig wechselnd in den nie-
drigsten bis zu den höchsten Ordnungsweisen der
Töne. Da alles auf Anerkennung ruht, wuchs er
in den Zusammenhängen der Vorwelt und Um-
welt, ejn Richter aus ihren Gesetzen, entwickelt
sich aus ihnen, eigenkräftig soweit, um eignes, so
gewaChsenes zur Anerkennung zu tragen. Die alten,
untern und obem Regeln, die anerkännten, die fast
schon den SChein der Notwendigkeit trugen, zeigt er
in ihrer Willkür und Frische, in seiner Willkür und
Frische, reChtfertigt stets von neuem die Regeln,
die seine Kunst gebildet haben, — löst die Rätsel,
deutet Hyroglyphen. Nicht gar so frei ist er, wie es
scheint, aber ihn zeichnet aus, daß er sich lebendig
in das Nicht-umstoßbare, Vorhandene einfühlen, ein-
finden kann, verwandter der Vergangenheit als an-
dere, älter als sie, uralt. — Auf diesem Boden alsö
wächst die höchste, sehr unbestimmte Ordnungs-
weise, wächst der Künstler selbst und welkt, mehrt
den Reichtum der Erde und der Töne. So ende idi
in dem Künstler, und so lobe ich den Musiker. Dies
ist auch der belebende Quell, der die Musik durch-
rieselt, der Geist, der über den Wassern schwebt
Und so preise ich die Musik: von Menschen kommt
sie, zu Menschen geht sie.
Der Junge
Der Wahrheit letzter Schluß : Der Mensch, ein
Kind der Vor- und Umwelt, in ihrem Namen schöpfe-
risch. — Du sagtest gestern, ich sei töricht, wenn
ich an den Tod glaube, ich ein Kind der Welt, die
Leben und Tat heißt. — Laß die Musik; wir
sprachen wohl auch zu Ende. Wüßte auch ich sol-
chen Geist, der über mir schwebt und mich tragen
kann, mich tragen will! — Mich belebt nichtS,
ich trage keine Früchte, bin eine taube Blüte, und
wenn ich welke, wird der Boden nicht reiCher.
O Kalypso, die schlimme Zauberin, Verderberin.
Hilf mir dagegen, daß ich immer denken muß: dasä
Meer ist kalt; es gibt ein Meer dort drüben, dort
draußen.
(Wirft sich auf den Boden.) Ich bin jung, idi
höre nicht die Musik, hat Kalypso’s Mund auch von
ihr gesprochen; ich höre nur das Meer.
Schlnss dts achten Oesprächs
So schlecht wie einst
Von Karl Kraus
Wenn die Reinhardt-Gesellschaft Wien wieder
verläßt, ist die Kritik dümmer geworden, und das
Burgtheater muß es büßen. Nun hat es ja das
Burgtheater nicht besser verdient, und wiewohl seine
Zwerge in der Aufmachung des Herrn Reinhardt
und zumal wenn sie als Gäste nach Wien kämen,
ins Riesenhafte wüchsen, so mag man zugeben,
daßi das Burgtheater heute auCh unverdienten Tadel
verdient hat. Denn ein Theater, welches sich von
Pompeji bloß dadurch unterscheidet, daß es keine
Trümmer hat, und welches ausschließliCh auf die
Versicherung der Fremdenführer angewiesen ist,
hier sei einmal die Wolter gegangen, hat für Ein-
heimische die Kasse zu schließen. Im allgemeinen
Mangel an schäuspielerischen Persönlichkeiten liegt
gewiß ein hinreichender Grund, ein einzelnesl
Theater zu entschuldigen, obschon kein hin-
reichender Grund, es zu besüchen. Aber wenn
es ein Theater gibt, dem auch die Nachsicht ver-
sagt werden muß, so ist es das Burgtheater,
und keines hat wie dieses die Verpflichtung,
einen ehrenvollen Tod einem schmählichen Leben
vorzuziehen. Traditionslose Bühnen mögen sichvon
unternehmenden Budapestern die Kultur und spn-
stige Surrogate einwirtschaften lassen. Das Burg-
theater hätte seinen Namen zu ändern, wenn es seine
Vergangenheit zu überleben beabsichtigt, es hätte
auf seinem Zettel bloß den berühüiten Punkt zu
belassen, den man infolge einer Anregung der
„Fackel“ voreilig beseiügt hat, und es dürfte dann
getrost auch gute Kinematographenvorstellungen
geben, die immer noch würdiger wären, als schlechte
Klassikervorstellungen. Sicherlich, die Noblesse
dieser Wüste, die es bisher verschmäht hat, sich mit
malerischen Ausreden zu verleugnen, ist sympathi-
scher als jenes zudringliche Fata morgana-Spiel, das
in jedem Sommer unsere Kamele beglückt. Aber
das Theater ist nicht dazu da, Mittelschülern die
Lektüre der Klassiker zu ersparen. Wenn der Zeit,
in der wir leben, schäuspielerische Persönlichkeiten
nicht abzugewinnen sind, so dränge sich ihr das
Burgtheater nicht auf. Sonst gibt es sich einer
Ungerechtigkeit preis, die einen Theaterdirektor für
den Lauf der Welt verantwortlich macht, und jener
kritischen Ungezogenheit, die einen toten Adler cr-
muntert, sich an einem lebenden Spatzen ein Bei-
spiel zu nehmen. Sobald Herr Reinhardt insi Land
kommt, sobald seine neurasthenischen Schlierseer
unsern Theatersommer eröffnen, kann sich die junge
Kritik hicht fassen vor lauter Horizonten. So stellt
iCh mir die erste Unterrichtsstunde vor, wenn die
sexuelle Aufklärung ein obligater Gegenstand seiii
17»