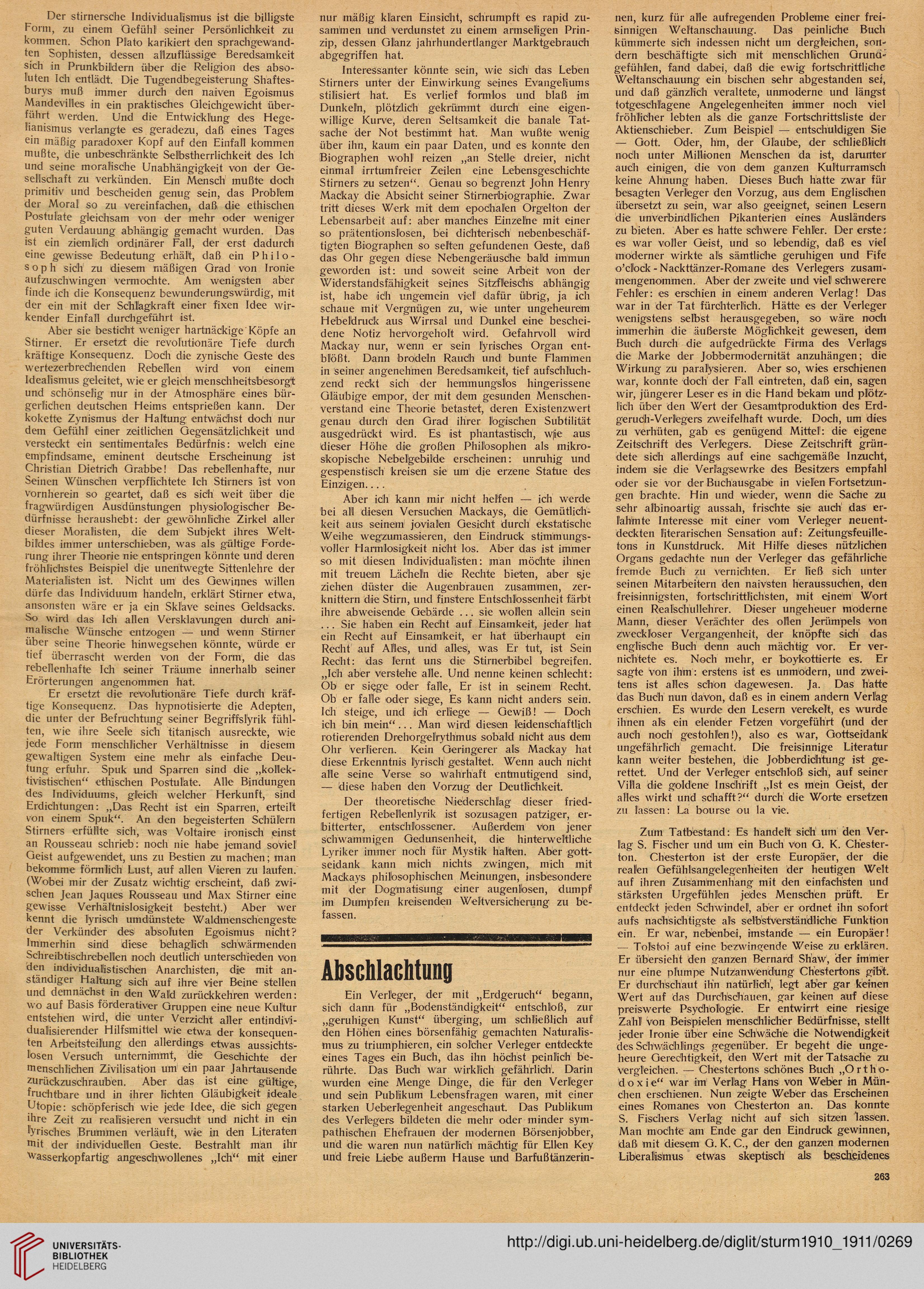Der Sturm: Monatsschrift für Kultur und die Künste — 1.1910-1911
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.31770#0269
DOI issue:
Nr. 33 (Oktober 1910)
DOI article:Mayer, Hans: Bildungsphilister, [2]
DOI article:Corvinus: Abschlachtung
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.31770#0269
Der stirnersche Individual'ismus ist die billigste
Form, zu einem Qefühl 1 seiner PersÖnlichkeit zu
kommen. Schon Plato karikiert den sprachgewand-
ten Sophisten, dessen allzuflüssige Beredsamkeit
sich in Prunkbildern über die Religion des abso-
luten Ich entlädt. Die Tugendbegeisterung Shaftes-
burys muß immer durCh den naiven Egoismus
Mandevilles in ein praktisChes Qleichgewicht über-
führt werden. Und die Entwicklung des Hege-
lianismus verlangte es geradezu, daß eines Tages
ein mäßig paradoxer Kopf auf den Einfall kommen
mußte, die unbesChränkte Selbstherrlichkeit des Ich
und seine moralische Unabhängigkeit von der Ge-
seflsChaft zu verkünden. Ein Mensch mußte doch
primitiv und bescheiden genug sein, das Probl'em
der Moral' so zu vereinfachen, daß; die ethischen
Postuläte gleiChsam von der mehr oder weniger
guten Verdauung abhängig gemaCht wurden. Das
ist ein ziemlich ordinärer Fall, der erst dadurch
eine gewisse Bedeutung crhält, claß ein P h i 1 o -
s o p h sich ! zu diesem mäßigen Grad von Ironie
aufzuschwingen vermochte. Äm wenigsten aber
finde ich die Konsequenz bewunderungswürdig, mit
der ein rnit der Schlagkraft einer fixen Idee wir-
kender Einfall durChgeführt ist.
Aber sie bestiCht weniger hartnäckige Köpfe an
Stirner. Er ersetzt die revolutionäre Tiefe durch
kräftige Konsequenz. DoCh die zynische Geste des
vvertezerbredienden Rebellen wird von einem
Ideal’ismus geleitet, wie er gleich menschheitsbesorg(t
und schönselig nur in der Atmosphäre eines bür-
gerl'ichen deutschen Heims entsprießen kann. Der
kokette Zynismus der Hal'tung entwächst doch nur
detn Gefühl einer zeitlichen Gegensätzlichkeit und
versteCkt ein sentimentalcs Bedürfnis: welch eine
empfindsame, eminent deutsche ErsCheinung jst
Christian DietriCh Grabbe! Das rebellenhafte, nur
Seincn WünsChen verpfllchtete Ich Stirners ist von
vornherein so geartet, daß es siCh weit ü'ber die
fragwürdigen Ausdünstungen physiolbgischer Be-
dürfnisse heraushebt: der gewöhnfiche Zirkel aller
dieser Morafisten, die dem Subjekt ihres Welt-
bifdes immer untersChieben, was als gültige Forde-
rung ihrer Theorie nie entspringen könnte und deren
fröhlichstes Beispiel die unentwegte Sittenlehre der
Materialisten ist. Nicht um des Gewinnes w.illen
dürfe das Individuum handel'n, erklärt Stirner etwa,
ansonsten wäre er ja ein Skfave seines GeldsaCks.
So wird das Ich allen Versklavungen durch ani-
malische Wünsche entzogen — und wenn Stirner
über seine Theorie hinwegsehen könnte, würde er
tief überrascht werden von der Form, die das
rebellenhafte Ich seiner Träume innerhalb seiner
Erörterungen angenommen hät.
Er ersetzt die rcvolutionäre Tiefe durCh kräf-
tige Konsequenz. Das hypnotisierte die Adepten,
die unter der Befruchtung seiner Begriffsfyrik fühl-
ten, wie ihre Seele sich titanisch ausreckte, wie
jede Form menschficher Verhrältnisse in diesem
gewaftigen System eine mehr als einfache Deu-
tung erfuhr. Spuk und Sparren sind die „kollek-
tivistischen“ ethischen Postufate. Alle Bindungen
des Individuums, gleich welcher Herkunft, sind
ErdiChtungen: „Das Recht ist ein Sparren, erteift
von einem Spuk“. An den begeisterten Sc'hüfern
Stirners erfüflte sich, was Voltaire ironisch einst
an Rousseau schrieb: noch nie habe jemänd soviel
Geist aufgewendet, uns zu Bestien zu maChen; man
bekomme förmlich Lust, auf allen Vieren zu laufen.
(Wobei mir der Zusatz wiChtig ersCheint, daß zw.i-
schen Jean Jaques Rousseau und Max Stirner eine
gewisse Verhäftnislosigkeit besteht.) Aber wer
kennt die fyrisCh umdünstete Waldmenschengeste
der Verkündier des absofuten Egoismüs nicht?
Immerhin sind diese behagfich sChwärmenden
Schreibtischrebellen noch deutliCh untersChieden von
den individuafistisChen Anarchisten, die mit an-
ständiger Haltung sich auf ihre vier Beine stellen
und demnächst in den Wald zurückkehren werden:
wo auf Basis förderativer Gruppen eine neue Kultur
entstehen wird, die unter Verzicht aller entindivi-
duafisierender Hilfsmittel wie etwa der konsequen-
ten Arbeitsteifung den allerdings etwas aussichts-
losen VersuCh unternimhit, die Geschichte der
menschfichen Zivilisation um ein paar Jahrtausende
zurückzuschrauben. Aber das ist eine gültige,
fruchtbare und in ihrer fichten Gläubigkeit ideale
Utopie: schöpferisch wie jede Idee, die sich gegen
ihre Zeit zu reafisieren versuCht und nidht in ejn
fyrisChes Brummen verläuft, wie in den Literaten
mit der individuellen Geste. Bestrahlt man ihr
tvasserkopfartig angeschwollenes „Ich“ mit einer
nur mäßig kliaren EinsiCht, schrumpft es rapid zu-
sam'men und Verdunstet zu einem armsefigen Prin-
zip, dessen Gfanz jahrhundertlanger MarktgebrauCh
abgegriffen hat.
Interessanter könnte sein, wie sidh das Leben
Stirners unter der Einwirkung seines Evangefiums
stifisiert hat. Es verlief formlos und blaß im
Dunkelh, plötzlic'h gekrümmt durCh' eine eigen-
wiflige Kurve, deren Seltsamkeit die banale Tat-
sache der Not bestimmt hat. Man wußte wenig
über ihn, kaum ein paar Daten, und es konnte den
Biographen wohf reizen „an Stelle dreier, nicht
einmaf irrtumfreier Zeilen eine Lebensgeschichte
Stirners zu setzen“. Genau so begrenzt John Henry
Mackay die Absicht seiner Stirnerbiographie. Zwar
tritt dieses Werk mit dem epoChäfen Orgelton der
Lebensarbeit auf: aber mänChes Einzelne mit einer
so prätentionslbsen, bei diChterisch nebenbeschäf-
tigten Biographen so selten gefundenen Geste, daß
das Ohr gegen diese NebengeräusChe bafd immun
gewiorden ist: und soweit seine Arbeit von der
Widerstandsfähiigkeit seines Sitzfl'eischs abhängig
ist, habe ich ungemein vief dafür übrig, ja ich
sChaue mit Vergnügen zu, wie unter ungeheurelm
Hebefdruck aus Wirrsal und Dunkel eine beschei-
dene Notiz hervörgeholt wird. Gefahrvoll wird
MaCkay nur, wenn er sein lyrisclies Organ ent-
bfößt. Dann brodeln RauCh und bunte Flammen
in seiner angeneh !men Beredsamkeit, tief aufsChfuch-
zend reckt sich der hemtnungslos hingerissene
Gfäubige empor, der mit dem gesunden Mertschen-
verstand eine Thieorie betastet, deren Existenzwert
genau durCh den Grad ihrer fogischen Subtilität
ausgedrüokt wird. Es ist phäntastisCh, w|ie aus
dieser 1 löhe die großen Phifosophen als mikro-
skopische Nebellgebilde erscheinen: unruhig und
gespenstisch kreisen sie um die erzene Statue des
Einzigen....
Äber idh kann mir nicht hclfeti — ich werde
bei afl diesen Versudhen Mackays, die Gemütlich-
keit aus seinem jovialen GesiCht durcll ekstatische
Weihe wegzumassiercn, den Eindruck stimmungs-
voller Harmlosigkeit nicht los. Aber das ist immer
so mit diesen Individuafisten: män möChte jhnen
mit treuem Läc'hefn die Rechte bieten, aber sje
ziehen düster die Augenbrauen zusammen, zer-
knittern die Stirn, und finstere EntsChfossenheit färbt
ihre abweisende Gebärde ... sie wollen allein sein
... Sie haben ein ReCht auf Einsamkeit, jeder hat
ein ReCht auf Einsamkeit, er hat überhaupt ein
Redht auf Afleis, und alles, was Er tut, ist Sein
ReCht: das fernt uns dje Stirnerbiibel begreifen.
„Ich aber verstehe alle. Und nenne keinen schlecht:
Ob er siege oder falle, Er ist in seinem Recht.
Ob er fafle oder siege, Es kann nidht anders sein.
ICh steige, und ich erfiege — Gewiß! — Doch
ich bin mein“ ... Man wird diesen leidcnschaftüch
rotierenden Drehorgefrythmus sobäld nidht aus dem
Ohr verlieren. Kein Geringerer als Mackay hät
diese Erkenntnis fyrisch gestaltet. Wenn auch nicht
afle seine Verse so wahrhäft entmutigend sind,
— diese haben den Vorzug der DeutlliChkeit.
Der theoretisChe Niederschfag dieser fried-
fertigen Rebeflenlyrik ist sozusagen patziger, er-
bitterter, entschlossener. Außerdern vou jener
sChwämmigen Oedunsenheit, die hinterweltliChe
Lyriker immer noch für Mystik halten. Aber gott-
seidank kann mich nichts zwingen, mich mit
MaCkays phifosophischen Meinungen, insbesöndere
mit der Dogmätisung einer augenlbsen, dumpf
irn Dumpfen kreisenden Weftversicherung zu be-
fassen.
Abschlachtung
Ein Verfeger, der mit „Erdgeruch“ begann,
sich dann für „Bodenständigkeit“ entschfoß, zur
„geruhigen Kunst“ überging, um schfießlich auf
den Höhen eines börsenfähig gemachten Natural'is-
mus zu triumphieren, ein sofcher Verleger entdeckte
eines Tages ein Buch, das ihn höchst peinfiCh be-
rührte. Das Buch war wirkfich gefährlich. Darin
wurden eine Menge Dinge, die für den Verfeger
und sein Pubfikum Lebensfragen waren, mit eäner
starken Ucberlegenheit angesChaut. Das Publikum
des Verfegers bildeten die mehr oder minder sym-
pathisChen Ehefrauen der modernen Börsenjobber,
und die waren nun natürfich mächtig für Ellen Key
und freie Liebe außerm Hause und Barfußtänzerin-
nen, kurz für alle aufregenden Probleme einer frei-
Sinnigen Weftanschauung. Das peinliche Buch
kümmerte sich indessen nic'ht um dergfeichen, son-
dern besChäftigte sich mit menschlichen Qrund'
gefühfen, fand dabei, daß die ewig fortschrittliche
Weftanschauung ein bischen sehr abgestanden sei,
und daß gänzfich veraltete, unmoderne und längst
totgesChlägene Angelegenheiten immer noch viel
fröhfiCher lebten als die ganze Fortschrittsliste der
Aktienschieber. Zum Beispief — entschuldigen Sie
— Gott. Oder, hm, der Gfaube, der sChließfich
noch unter Millionen Menschen da ist, darurtter
auch einigen, die von dem ganzen Kulturramsch
keine Ahnung haben. Dieses Buch hätte zwar für
besagten Verleger den Vorzug, aus dem EnglisChen
übersetzt zu sein, war afso geeignet, seinen Lesern
die unverbindlichen Pikanterien eines Ausländers
zu bieten. Aber es hatte sChwere Fehfer. Der erste:
es war voller Geist, und so lebendig, daß es viel
moderner wirkte als sämtliche geruhigen und Fife
o’cfock - Nackttänzer-Romane des Verlegers zusam-
mengenommen. Aber der zweite und vief sChwerere
Fehfer: es erschien in einem anderen Verlag! Das
war in der Tat fürChterfich. Hätte es der Verleger
wenigstens selbst herausgegeben, so wäre noCh
immerhin die äußerste Mögfichkeit gewesen, dem
BuCh durch die aufgedrückte Firma des Verlägs
die Marke der Jobbermodernität anzuhängen; die
Wirkung zu paralysieren. Aber so, wies ersdhienen
war, konnte doch der Fall eintreten, daß ein, sagen
wir, jüngerer Leser es in die Hand bekam und plÖtz-
fich über den Wert der Gesamtproduktion des Erd-
geruCh-Verfegers zweifelhaft wurde. Doch, um dies
zu verhüten, gab es genügend Mittef: die eigene
ZeitsChrift des Verlegers. Diese Zeitschrift grün-
dete siCh allerdings auf eine saChgemäße Inzucht,
indem sie die Verlägsewrke des Besitzers empfahl
oder sie vor der Buchäusgabe in viefen Fortsetzun-
gen braChte. Hin und wieder, wenn die SaChe zu
sehr afbinioartig aussah, frisChte sie auch' das er-
lähmte Interesse mit einer vom Verleger neuent-
deckten fiterarischen Sensation auf: Zeitungsfeuille-
tons in Kunstdruck. Mit Hiffe dieses nützlichen
Organs gedaChte nun der Verfeger das gefährliche
fremde BuCh zu verniChten. Er fieß sich unter
seinen Mitarbeitern den naivsten heraussuChen, den
freisinnigsten, fortschrittfichsten, mit einehf Wort
einen Reafschüllehrer. Dieser ungeheuer moderne
Mann, dieser VeräChter des oflen Jerümpels Von
ZweCkfoser Vergangenheit, der knöpfte sich das
englische Buch denn auch mächtig Vor. Er ver-
nichtete es. Noch mehr, er boykottierte es. Er
sagte von ihm : erstens ist es unmodern, und zwei-
tens ist afles schön dagewesen. Ja. Das hätte
das Buch nun daVon, daß es in einem andern Verfag
ersChien. Es wurde den Lesern verekeft, es wurde
ihnen afs ein elender Fetzen Vorgeführt (und der
auCh noch gestohfen!), also es war, Gottseidank'
ungefährfiCh gemacht. Die freisinnige Literatur
kann wCiter bestehen, die JobberdiChtung ist ge-
rettet. Und der Verfeger entschloß sidh, auf seiner
Villa die goldcne Insdhrift „Ist es mein Geist, der
afles wirkt und sChafft?“ durch die Worte ersetzen
zu lassen: La bourse ou la Vie.
Zum Tatbestand: Es handelt sich um den Ver-
lag S. Fischer und um ein Buch Von G. K. Chester-
ton. Chesterton ist der erste Europäer, der die
reafen Gefühisangelegenheiten der heutigen Welt
auf ihren Zusammenhang mit den einfaChsten und
stärksten Urgefühfen jedes MensChen prüft. Er
entdeekt jeden SChwindef, aber er ordnet ihn sbfort
aufs üachsichtigste afs selbstverstandlichc Fünktion
ein. Er war, ncbenbei, imstande — ein Europäer!
— Tolstoi auf eine bezwingende Weise zu erklären.
Er übersieht den ganzen Bernard Shäw, der ämmer
nur eine plümpe NutZanwendung Chestertons gibt.
Er durchschaut ihn natürfich, legt aber gar keinen
Wert auf das Durchschäuen, gar keinen auf diese
preiswerte Psyühofogie. Er entwirrt eine riesige
Zahf Von Beispielen menschliCher Bedürfnisse, stellt
jeder Ironie über eine Schwächc die Notwendigkeit
des SühwädhJings gegenüber. Er begeht die unge-
heure Gerechtigkeit, den Wert mit derTatsache zu
Vergfeichen. — Chestertons schönes Buch „Ortho-
doxie“ war irü Verläg Hans von Weber in Mün-
Chen erschienen. Nun zeigte Weber das Erscheinen
eines Romanes Von Chesterton an. Das konnte
S. Fischers Verfag nicht auf sich sitzen lasseu.
Man 'moChte am Ende gar den Eindruck gewinnen,
daß mit diesem G. K. C., der den ganzen modernen
Liberafismus etwäs skeptisch als bescheidenes
263
Form, zu einem Qefühl 1 seiner PersÖnlichkeit zu
kommen. Schon Plato karikiert den sprachgewand-
ten Sophisten, dessen allzuflüssige Beredsamkeit
sich in Prunkbildern über die Religion des abso-
luten Ich entlädt. Die Tugendbegeisterung Shaftes-
burys muß immer durCh den naiven Egoismus
Mandevilles in ein praktisChes Qleichgewicht über-
führt werden. Und die Entwicklung des Hege-
lianismus verlangte es geradezu, daß eines Tages
ein mäßig paradoxer Kopf auf den Einfall kommen
mußte, die unbesChränkte Selbstherrlichkeit des Ich
und seine moralische Unabhängigkeit von der Ge-
seflsChaft zu verkünden. Ein Mensch mußte doch
primitiv und bescheiden genug sein, das Probl'em
der Moral' so zu vereinfachen, daß; die ethischen
Postuläte gleiChsam von der mehr oder weniger
guten Verdauung abhängig gemaCht wurden. Das
ist ein ziemlich ordinärer Fall, der erst dadurch
eine gewisse Bedeutung crhält, claß ein P h i 1 o -
s o p h sich ! zu diesem mäßigen Grad von Ironie
aufzuschwingen vermochte. Äm wenigsten aber
finde ich die Konsequenz bewunderungswürdig, mit
der ein rnit der Schlagkraft einer fixen Idee wir-
kender Einfall durChgeführt ist.
Aber sie bestiCht weniger hartnäckige Köpfe an
Stirner. Er ersetzt die revolutionäre Tiefe durch
kräftige Konsequenz. DoCh die zynische Geste des
vvertezerbredienden Rebellen wird von einem
Ideal’ismus geleitet, wie er gleich menschheitsbesorg(t
und schönselig nur in der Atmosphäre eines bür-
gerl'ichen deutschen Heims entsprießen kann. Der
kokette Zynismus der Hal'tung entwächst doch nur
detn Gefühl einer zeitlichen Gegensätzlichkeit und
versteCkt ein sentimentalcs Bedürfnis: welch eine
empfindsame, eminent deutsche ErsCheinung jst
Christian DietriCh Grabbe! Das rebellenhafte, nur
Seincn WünsChen verpfllchtete Ich Stirners ist von
vornherein so geartet, daß es siCh weit ü'ber die
fragwürdigen Ausdünstungen physiolbgischer Be-
dürfnisse heraushebt: der gewöhnfiche Zirkel aller
dieser Morafisten, die dem Subjekt ihres Welt-
bifdes immer untersChieben, was als gültige Forde-
rung ihrer Theorie nie entspringen könnte und deren
fröhlichstes Beispiel die unentwegte Sittenlehre der
Materialisten ist. Nicht um des Gewinnes w.illen
dürfe das Individuum handel'n, erklärt Stirner etwa,
ansonsten wäre er ja ein Skfave seines GeldsaCks.
So wird das Ich allen Versklavungen durch ani-
malische Wünsche entzogen — und wenn Stirner
über seine Theorie hinwegsehen könnte, würde er
tief überrascht werden von der Form, die das
rebellenhafte Ich seiner Träume innerhalb seiner
Erörterungen angenommen hät.
Er ersetzt die rcvolutionäre Tiefe durCh kräf-
tige Konsequenz. Das hypnotisierte die Adepten,
die unter der Befruchtung seiner Begriffsfyrik fühl-
ten, wie ihre Seele sich titanisch ausreckte, wie
jede Form menschficher Verhrältnisse in diesem
gewaftigen System eine mehr als einfache Deu-
tung erfuhr. Spuk und Sparren sind die „kollek-
tivistischen“ ethischen Postufate. Alle Bindungen
des Individuums, gleich welcher Herkunft, sind
ErdiChtungen: „Das Recht ist ein Sparren, erteift
von einem Spuk“. An den begeisterten Sc'hüfern
Stirners erfüflte sich, was Voltaire ironisch einst
an Rousseau schrieb: noch nie habe jemänd soviel
Geist aufgewendet, uns zu Bestien zu maChen; man
bekomme förmlich Lust, auf allen Vieren zu laufen.
(Wobei mir der Zusatz wiChtig ersCheint, daß zw.i-
schen Jean Jaques Rousseau und Max Stirner eine
gewisse Verhäftnislosigkeit besteht.) Aber wer
kennt die fyrisCh umdünstete Waldmenschengeste
der Verkündier des absofuten Egoismüs nicht?
Immerhin sind diese behagfich sChwärmenden
Schreibtischrebellen noch deutliCh untersChieden von
den individuafistisChen Anarchisten, die mit an-
ständiger Haltung sich auf ihre vier Beine stellen
und demnächst in den Wald zurückkehren werden:
wo auf Basis förderativer Gruppen eine neue Kultur
entstehen wird, die unter Verzicht aller entindivi-
duafisierender Hilfsmittel wie etwa der konsequen-
ten Arbeitsteifung den allerdings etwas aussichts-
losen VersuCh unternimhit, die Geschichte der
menschfichen Zivilisation um ein paar Jahrtausende
zurückzuschrauben. Aber das ist eine gültige,
fruchtbare und in ihrer fichten Gläubigkeit ideale
Utopie: schöpferisch wie jede Idee, die sich gegen
ihre Zeit zu reafisieren versuCht und nidht in ejn
fyrisChes Brummen verläuft, wie in den Literaten
mit der individuellen Geste. Bestrahlt man ihr
tvasserkopfartig angeschwollenes „Ich“ mit einer
nur mäßig kliaren EinsiCht, schrumpft es rapid zu-
sam'men und Verdunstet zu einem armsefigen Prin-
zip, dessen Gfanz jahrhundertlanger MarktgebrauCh
abgegriffen hat.
Interessanter könnte sein, wie sidh das Leben
Stirners unter der Einwirkung seines Evangefiums
stifisiert hat. Es verlief formlos und blaß im
Dunkelh, plötzlic'h gekrümmt durCh' eine eigen-
wiflige Kurve, deren Seltsamkeit die banale Tat-
sache der Not bestimmt hat. Man wußte wenig
über ihn, kaum ein paar Daten, und es konnte den
Biographen wohf reizen „an Stelle dreier, nicht
einmaf irrtumfreier Zeilen eine Lebensgeschichte
Stirners zu setzen“. Genau so begrenzt John Henry
Mackay die Absicht seiner Stirnerbiographie. Zwar
tritt dieses Werk mit dem epoChäfen Orgelton der
Lebensarbeit auf: aber mänChes Einzelne mit einer
so prätentionslbsen, bei diChterisch nebenbeschäf-
tigten Biographen so selten gefundenen Geste, daß
das Ohr gegen diese NebengeräusChe bafd immun
gewiorden ist: und soweit seine Arbeit von der
Widerstandsfähiigkeit seines Sitzfl'eischs abhängig
ist, habe ich ungemein vief dafür übrig, ja ich
sChaue mit Vergnügen zu, wie unter ungeheurelm
Hebefdruck aus Wirrsal und Dunkel eine beschei-
dene Notiz hervörgeholt wird. Gefahrvoll wird
MaCkay nur, wenn er sein lyrisclies Organ ent-
bfößt. Dann brodeln RauCh und bunte Flammen
in seiner angeneh !men Beredsamkeit, tief aufsChfuch-
zend reckt sich der hemtnungslos hingerissene
Gfäubige empor, der mit dem gesunden Mertschen-
verstand eine Thieorie betastet, deren Existenzwert
genau durCh den Grad ihrer fogischen Subtilität
ausgedrüokt wird. Es ist phäntastisCh, w|ie aus
dieser 1 löhe die großen Phifosophen als mikro-
skopische Nebellgebilde erscheinen: unruhig und
gespenstisch kreisen sie um die erzene Statue des
Einzigen....
Äber idh kann mir nicht hclfeti — ich werde
bei afl diesen Versudhen Mackays, die Gemütlich-
keit aus seinem jovialen GesiCht durcll ekstatische
Weihe wegzumassiercn, den Eindruck stimmungs-
voller Harmlosigkeit nicht los. Aber das ist immer
so mit diesen Individuafisten: män möChte jhnen
mit treuem Läc'hefn die Rechte bieten, aber sje
ziehen düster die Augenbrauen zusammen, zer-
knittern die Stirn, und finstere EntsChfossenheit färbt
ihre abweisende Gebärde ... sie wollen allein sein
... Sie haben ein ReCht auf Einsamkeit, jeder hat
ein ReCht auf Einsamkeit, er hat überhaupt ein
Redht auf Afleis, und alles, was Er tut, ist Sein
ReCht: das fernt uns dje Stirnerbiibel begreifen.
„Ich aber verstehe alle. Und nenne keinen schlecht:
Ob er siege oder falle, Er ist in seinem Recht.
Ob er fafle oder siege, Es kann nidht anders sein.
ICh steige, und ich erfiege — Gewiß! — Doch
ich bin mein“ ... Man wird diesen leidcnschaftüch
rotierenden Drehorgefrythmus sobäld nidht aus dem
Ohr verlieren. Kein Geringerer als Mackay hät
diese Erkenntnis fyrisch gestaltet. Wenn auch nicht
afle seine Verse so wahrhäft entmutigend sind,
— diese haben den Vorzug der DeutlliChkeit.
Der theoretisChe Niederschfag dieser fried-
fertigen Rebeflenlyrik ist sozusagen patziger, er-
bitterter, entschlossener. Außerdern vou jener
sChwämmigen Oedunsenheit, die hinterweltliChe
Lyriker immer noch für Mystik halten. Aber gott-
seidank kann mich nichts zwingen, mich mit
MaCkays phifosophischen Meinungen, insbesöndere
mit der Dogmätisung einer augenlbsen, dumpf
irn Dumpfen kreisenden Weftversicherung zu be-
fassen.
Abschlachtung
Ein Verfeger, der mit „Erdgeruch“ begann,
sich dann für „Bodenständigkeit“ entschfoß, zur
„geruhigen Kunst“ überging, um schfießlich auf
den Höhen eines börsenfähig gemachten Natural'is-
mus zu triumphieren, ein sofcher Verleger entdeckte
eines Tages ein Buch, das ihn höchst peinfiCh be-
rührte. Das Buch war wirkfich gefährlich. Darin
wurden eine Menge Dinge, die für den Verfeger
und sein Pubfikum Lebensfragen waren, mit eäner
starken Ucberlegenheit angesChaut. Das Publikum
des Verfegers bildeten die mehr oder minder sym-
pathisChen Ehefrauen der modernen Börsenjobber,
und die waren nun natürfich mächtig für Ellen Key
und freie Liebe außerm Hause und Barfußtänzerin-
nen, kurz für alle aufregenden Probleme einer frei-
Sinnigen Weftanschauung. Das peinliche Buch
kümmerte sich indessen nic'ht um dergfeichen, son-
dern besChäftigte sich mit menschlichen Qrund'
gefühfen, fand dabei, daß die ewig fortschrittliche
Weftanschauung ein bischen sehr abgestanden sei,
und daß gänzfich veraltete, unmoderne und längst
totgesChlägene Angelegenheiten immer noch viel
fröhfiCher lebten als die ganze Fortschrittsliste der
Aktienschieber. Zum Beispief — entschuldigen Sie
— Gott. Oder, hm, der Gfaube, der sChließfich
noch unter Millionen Menschen da ist, darurtter
auch einigen, die von dem ganzen Kulturramsch
keine Ahnung haben. Dieses Buch hätte zwar für
besagten Verleger den Vorzug, aus dem EnglisChen
übersetzt zu sein, war afso geeignet, seinen Lesern
die unverbindlichen Pikanterien eines Ausländers
zu bieten. Aber es hatte sChwere Fehfer. Der erste:
es war voller Geist, und so lebendig, daß es viel
moderner wirkte als sämtliche geruhigen und Fife
o’cfock - Nackttänzer-Romane des Verlegers zusam-
mengenommen. Aber der zweite und vief sChwerere
Fehfer: es erschien in einem anderen Verlag! Das
war in der Tat fürChterfich. Hätte es der Verleger
wenigstens selbst herausgegeben, so wäre noCh
immerhin die äußerste Mögfichkeit gewesen, dem
BuCh durch die aufgedrückte Firma des Verlägs
die Marke der Jobbermodernität anzuhängen; die
Wirkung zu paralysieren. Aber so, wies ersdhienen
war, konnte doch der Fall eintreten, daß ein, sagen
wir, jüngerer Leser es in die Hand bekam und plÖtz-
fich über den Wert der Gesamtproduktion des Erd-
geruCh-Verfegers zweifelhaft wurde. Doch, um dies
zu verhüten, gab es genügend Mittef: die eigene
ZeitsChrift des Verlegers. Diese Zeitschrift grün-
dete siCh allerdings auf eine saChgemäße Inzucht,
indem sie die Verlägsewrke des Besitzers empfahl
oder sie vor der Buchäusgabe in viefen Fortsetzun-
gen braChte. Hin und wieder, wenn die SaChe zu
sehr afbinioartig aussah, frisChte sie auch' das er-
lähmte Interesse mit einer vom Verleger neuent-
deckten fiterarischen Sensation auf: Zeitungsfeuille-
tons in Kunstdruck. Mit Hiffe dieses nützlichen
Organs gedaChte nun der Verfeger das gefährliche
fremde BuCh zu verniChten. Er fieß sich unter
seinen Mitarbeitern den naivsten heraussuChen, den
freisinnigsten, fortschrittfichsten, mit einehf Wort
einen Reafschüllehrer. Dieser ungeheuer moderne
Mann, dieser VeräChter des oflen Jerümpels Von
ZweCkfoser Vergangenheit, der knöpfte sich das
englische Buch denn auch mächtig Vor. Er ver-
nichtete es. Noch mehr, er boykottierte es. Er
sagte von ihm : erstens ist es unmodern, und zwei-
tens ist afles schön dagewesen. Ja. Das hätte
das Buch nun daVon, daß es in einem andern Verfag
ersChien. Es wurde den Lesern verekeft, es wurde
ihnen afs ein elender Fetzen Vorgeführt (und der
auCh noch gestohfen!), also es war, Gottseidank'
ungefährfiCh gemacht. Die freisinnige Literatur
kann wCiter bestehen, die JobberdiChtung ist ge-
rettet. Und der Verfeger entschloß sidh, auf seiner
Villa die goldcne Insdhrift „Ist es mein Geist, der
afles wirkt und sChafft?“ durch die Worte ersetzen
zu lassen: La bourse ou la Vie.
Zum Tatbestand: Es handelt sich um den Ver-
lag S. Fischer und um ein Buch Von G. K. Chester-
ton. Chesterton ist der erste Europäer, der die
reafen Gefühisangelegenheiten der heutigen Welt
auf ihren Zusammenhang mit den einfaChsten und
stärksten Urgefühfen jedes MensChen prüft. Er
entdeekt jeden SChwindef, aber er ordnet ihn sbfort
aufs üachsichtigste afs selbstverstandlichc Fünktion
ein. Er war, ncbenbei, imstande — ein Europäer!
— Tolstoi auf eine bezwingende Weise zu erklären.
Er übersieht den ganzen Bernard Shäw, der ämmer
nur eine plümpe NutZanwendung Chestertons gibt.
Er durchschaut ihn natürfich, legt aber gar keinen
Wert auf das Durchschäuen, gar keinen auf diese
preiswerte Psyühofogie. Er entwirrt eine riesige
Zahf Von Beispielen menschliCher Bedürfnisse, stellt
jeder Ironie über eine Schwächc die Notwendigkeit
des SühwädhJings gegenüber. Er begeht die unge-
heure Gerechtigkeit, den Wert mit derTatsache zu
Vergfeichen. — Chestertons schönes Buch „Ortho-
doxie“ war irü Verläg Hans von Weber in Mün-
Chen erschienen. Nun zeigte Weber das Erscheinen
eines Romanes Von Chesterton an. Das konnte
S. Fischers Verfag nicht auf sich sitzen lasseu.
Man 'moChte am Ende gar den Eindruck gewinnen,
daß mit diesem G. K. C., der den ganzen modernen
Liberafismus etwäs skeptisch als bescheidenes
263