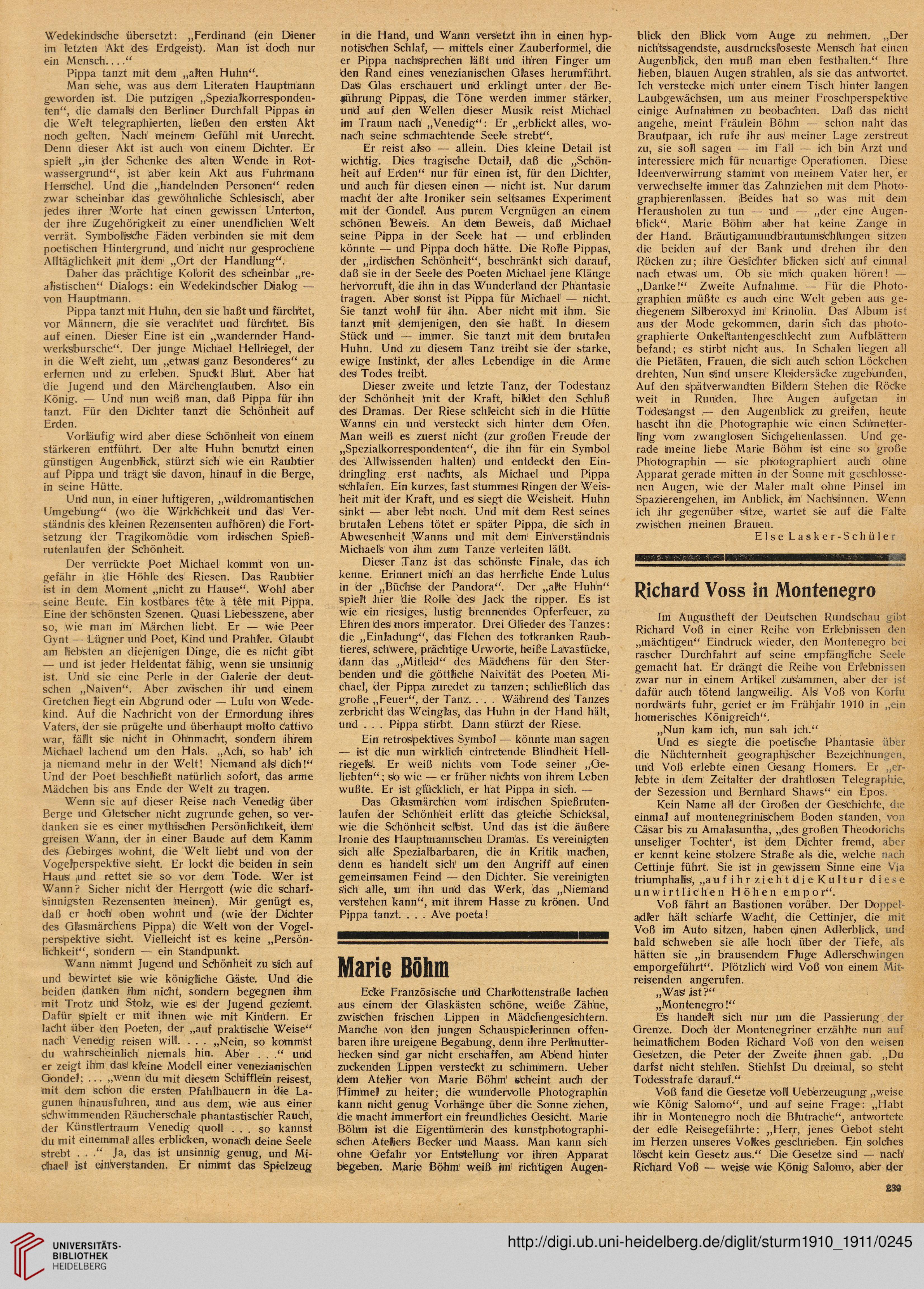Wedekindsche übersetzt: „Fcrdinand (ein Diener
im fetzten Akt des Erdgeist). Man ist doch nur
ein Mensdh_“
Pippa tanzt mit dem „alten Huhn“.
Man sehe, was aus dem Literaten Hauptmann
geworden ist. Die putzigen „Spezialkorresponden-
ten“, die damals den Berliner Durdhfall Pippas in
die Welt telegraphierten, ließen den ersten Akt
nodh gelten. Nach meinem Oefühl mit Unrecht.
Denn dieser Akt ist auch von einem Dichter. Er
spiel't „in ;der Sdhenke des alten Wende in Rot-
wassergrund“, ist jaber kein Akt aus Fuhrmann
Henschel 1. Und die „handelnden Personen“ reden
zwar Sdheinbar das gewöhnKche Schlesisdh, aber
jedes ihrer Worte hat einen gewissen Unterton,
der ihre iZugehörigkeit zu einer unendlichen Welt
verrät. Symbolische Fäden verbinden sie mit dem
poetisdhen Hintergrund, und nicht nur gesprochene
Alltäglichkeit |mit jdem „Ort der Handlung“.
Daher das prächtige Kolbrit des sdheinbär „re-
afistischen“ Dialogs: ein Wedekindscher Dialog —
von Hauptmann.
Pippa tanzt mit Huhn, den sie häßt und fürchtet,
vor Männern, jdie sie verachtet und fürdhtet. Bis
auf einen. Dieser Eine ist ein „wandernder Hand-
werksbürsche“. Der junge Midiaef Helfriegef, der
in die Weft zieht, um „etwasl ganz Besonderes“ zu
erlernen und zu erleben. Spuckt Blut. Aber hat
die Jugend und den Märchengfauben. AIso ein
König. — Und nun weiß man, daß Pippa für ihn
tanzt. Für den Dichter tanzt die Schönheit auf
Erden.
Vortäufig wird aber diese SChönheit von einem
stärkeren entführt. Der alte Huhn benutzt einen
günstigen Augenbfick, stürzt sich wie ein Raubtier
auf Pippa und trägt sie daVon, hinauf in die Berge,
in seine Hütte.
Und nun, in einer lüftigeren, „wildromantischen
Umgebung“ (wo die Wirkfichkeit und das : Ver-
ständnis des kfeinen Rezensenten aufhören) die Fort-
stetzung der Tragikomödie Vom irdisChen Spieß-
rutenfaufen d er Schönheit.
Der Verrückte Poet Michaef kommt von un-
gefähr in die Höhfe deSI Riesen. Das Raubtier
ist in dem Moment „nicht zu Hause“. Wohf aber
seine Beute. Ein kostbäres tete ä tete mit Pippa.
Eine der sChönsten Szenen. Quasi Liebesszene, aber
50, wie man im Märchen tiebt. Er — wie Peer
Oynt — Lügner und Poet, Kind und Prahfer. Glaubt
am fiebsten an diejenigen Dinge, die es nicht gibt
— und ist jeder Heldentat fähig, wenn sie unsinnig
ist. Und sie eine Perlte in der Galerie der deut-
schen „Naiven“. Aber zwisChen ihr und einem
Gretchen fiegt ein Abgrund oder — Lulu von Wede-
kind. Auf die Nachricht von der Ermordung ihres
Vaters, der sie prügelte und überhaupt molto Cattivö
war, fäflt slie nic'ht in OhnmaCht, sondern ihrem
Michaef fachend um den Hals. „Ach, so hab’ ich
ja niemand mehr in der Welt! Nicmand alsl diCh!“
Und der Poet beSChfießt natürlich sofort, das arme
Mädchen bis ans Ende der Wel't zu tragen.
Wenn sie auf dieser Reise nach Venedig über
Berge und GfetsCher niCht zugrunde gehten, so ver-
danken sie es einer mythisChten Persönlichkeit, dem
greisen Wann, der in einer Baude auf dem Kamm
des pebirges wohnt, die Welt liebt und von der
Vogelperspektive sieht. Er Iockt die beiden in sein
Haus |und rettet sie so vor dem Tode. Wer ist
Wann? Sicher nicht der Herrgott (wie die stehärf-
sinnigsten Rezensenten 'meinen). Mir genügt es,
daß er hoch oben wohnt und (wie der Dichter
des Gläsmärchens Pippa) die Welt von der Vogel-
perspektive sieht. Vieffeicht ist es keine „Persön-
lichkeit“, sondern — ein Standpunkt.
Wann nimmt Jugend und Schönheit zu Sich auf
und bewirtet sie wie königfiche Gäste. Und die
beiden (danken ihm nicht, sondern begegnen ihm
mit Trotz und Stofz, wie es der Jugend geziemt.
Dafür spieft er mit ihnen wie mit Kindern. Er
lächt über den Poeten, der „auf praktistehe Weise“
naCh Venedig reisen wifl. . . . „Nein, so kommst
du wahrsCheinfiCh niemals hin. Aber . . .“ und
er zeigt ihm dasl kfeine Modell einer venezianischen
Gondef; ... „wenn du mit diestem Schifffein reisest,
mit dem schon die ersten Pfahlbauern in die La-
gunen hinausfuhren, und aus dem, wie aus einer
schwimmenden Räucherschalte phantastischer Rauch,
der Künstlertraum Venedig quoll ... so kannst
du mit einemmaf alles erblicken, wonach deine Seele
strebt . . .“ Ja, das ist unsinnig genug, und Mi-
chaef islt einverstanden. Er mimrnt das Spielzeug
in die Hand, und Wann versetzt ihn in einen hyp-
notisChen Schfaf, — mittels einer Zauberformel, die
er Pippa nachspreChen lläßt und ihren Finger um
den Rand einesl venezianischen Gfases herumführt.
Das Gfas ersChauert und erklingt unter der Be-
führung PippaS, die Töne werden imimer stärker,
und auf den Weflen dieser Musik reist Michael
im Traum naCh „Venedig“: Er „erblickt alles 1, wo-
nach Seine schmachtende Seelte strebt“.
Er reist afso — allein. Dies kfeine Detail ist
wiChtig. DieSi tragische Detaif, daß die „Schön-
heit auf Erden“ nur für einen ist, für den Dichter,
und auch für dieSen einen — nicht ist. Nur darum
maCht der alte Ironiker sein seltsames Experiment
mit der Gondef. AuS purem Vergnügen an einem
sChönen JBeweis. An dem Beweis, daß Michael
steine Pippa in der Seete hat — und erblinden
könnte — und Pippa doch hätte. Die Rofle Pippas,
der „irdisChen Schönheit“, beschränkt sich darauf,
daß Sie in der Seefe des Poeten Michael jene Klänge
hervorruft, die ihn in das Wunderfand der Phantasie
tragen. Aber Sonst ist Pippa für Michaef — nicht.
Sie tanzt wohf für ihn. Aber nicht mit ihm. Sie
tanzt (mit demjenigen, den sie haßt. In diesem
Stück und — immer. Sie tanzt mit dem brutafen
Huhn. Und zu diesem Tanz treibt sie der starke,
ewige Instinkt, der afles Lebendige in die Arme
deS Todes treibt.
Dieser zweite und fetzte Tanz, der Todestanz
der Schönheit mit der Kraft, bifdet den Schluß
des Dramas. Der Riese schleicht sich in die Hütte
Wanns 1 ein und VersteCkt sich hinter dem Ofen.
Man weiß es zuerst nicht (zur großen Freude der
„Spezialkorrespondenten“, die ihn für ein Symbol
des Aflwissenden halten) und entdeekt den Ein-
dringfing erst nadhts, als Michael und Pippa
sChfafen. Ein kurzes, fast stummesl Ringen der Weis-
heit mit der Kraft, und esi siegt die Weisheit. Huhn
sinkt — aber l'ebt noCh. Und mit dem Rest seines
brutalten LebenS tötet er später Pippa, die sich in
Abwesenheit Wanns und mit demt Einverständnis
MichaelS Von ihm zum Tanze verleiten läßt.
Dieser Tanz ist das schönste Finafe, das ich
kenne. Erinnert rniCh an das' herrfiche Ende Lulus
in der „Büchste der Pandora“. Der „afte Huhn“
spieft hier jdie Rolte desi JaCk thte ripper. Es ist
wie ein riesiiges, fustig brennendes Opferfeuer, zu
Ehren des mors imperator. Drei Glieder des Tanzes:
die „Einladung“, daS Flehen des totkranken Raub-
tieres, sdhwere, prächtige Urworte, heiße Lavastücke,
dann das „Mitleid“ des MädChens für den Ster-
benden und die göttfiehe Naivität desl Poeten Mi-
Chaef, der Pippa zuredet zu tanzen; sChließlich das
große „Feuer“, der Tanz. . . . Während des ! Tanzes
zerbriCht daS Weingfas, das Huhn in der Hand hält,
und . . . Pippa stirbt. Dann stürzt der Riese.
Ein retrospektives Symbof — könnte man sagen
— ist die nun wirkfiCh eintretende Blindheit Hell-
riegefs. Er weiß niChts vom Tode seiner „Ge-
liebten“; sb wie — er früher nitehts von ihrem Leben
wußte. Er ist gfücklich, er hat Pippa in sich. —
Das GllasmärChen vom irdisChen Spießruten-
faufen der SChönheit erlitt das gleiche Schicksal,
wie die Schönheit Selbst. Und das ist Öie äußere
Ironie des HauptmannsChen Dramäs. Es vereinigten
sich afle Spezialbärbaren, die in Kritik maChen,
denn es handeft sich um den Angriff auf einen
gemeinsamen Feind — den Dichter. Sie vereinigten
sich afle, um ihn und das Werk, das „Niemand
verstehen kann“, mit ihrem Hasse zu krönen. Und
Pippa tanzt. . . . Ave poeta!
Marie Böhm
Ecke Französische und Charfottenstraße lachen
aus einem der Gfaskästen schöne, weiße Zähne,
zWistehen frischen Lippen in Mädchengesichtern.
Manche von den jungen Schäuspieferinnen offen-
baren ihre ureigene Begabung, denn ihre Perimutter-
hecken sind gar nicht erschaffen, am Abend hinter
zuCkenden Lippen versteckt zu schimmern. Ueber
dem Atefier Von Marie Böhm sCheint auch der
iHimmef zu heiter; die wundervolle Photographin
kann nicht genug Vorhänge über die Sonne ziehen,
die maCht immerfort ein freundfiches! Gesicht. Marie
Böhm ist die Eigentümerin des kunstphotographi-
sChen Atefiers Becker und Maass. Man kann siteh
ohne Gefahr vor Entstelfung vor ihren Apparat
begeben. Marie Böhin weiß im fiChtigen Augen-
blick den ßlidc Vom Auge zu nelnnen. „Der
nichtslsagendste, ausdrucksfoseste Mensch hat einen
Augenbfick, den muß man eben festhalten.“ Ihre
fieben, blauen Augen strahlen, als sie das antwortet.
Ich verstecke mich unter einem Tisch hinter längen
Laubgewätehsen, um aus meiner Froschperspektive
einige Aufnahmen zu beobaChten. Daß das nicht
angehe, meint Fräufein Böhm — schon naht das
Brautpaar, ic'h rufe ihr aus meiner Lage zerstreut
zu, sie sofl sagen — im Fall — ich bin Arzt und
interessiere mich für neuartige Operationen. Diese
IdeenVerwirrung stammt von meinem Vater her, er
verwechselte immer das Zahnziehen mit dem Photo-
graphierenläsisen. Beides hat so was mit dem
Heraushofen zu tun — und —- „der eine Augen-
bfiCk“. Marie Böhm aber hat keine Zange in
der Hand. Bräutigamundbfautumschlüngen sitzen
die beiden auf der Bank und drehen ihr den
Rücken zu; ihre üesichter bficken sich auf einmal
nach etwasi um. Ob sie micli quaken hören! —
„Danke!“ Zweite Aufnahme. — Für die Photo-
graphien imüßte es' auch eir.e Weft geben aus ge-
diegenem Silberoxyd irn Krinolin. Das' Album ist
aus cier Mode gekommen, darin s'ich das photo-
graphierte OnkeltantengeSchfecht zum Aufblättern
befand; es stirbt nicht aus. In Schafen liegen all
die Pietäten, Frauen, die siCh auCh schon Löckchen
drehten, Nun sind unsere KfeidersäCke zugebünden,
Auf den slpätverwandten Bildern Stehen Öie Röcke
weit in Runden. Ihre Augen aufgetan in
Todesängst ,— den Augenblick zu greifen, heute
hasteht ihn die Photographie wie einen Schmetter-
fing Vöm zwanglosen Sichgehenlassen. Und ge-
rade Imeine liebe Marie Bölim ist eine soi große
Photographin — sie photographiert auch ohne
Apparat gerade mitten in der Sonne mit gesChfosse-
nen Augen, wie der Mafer malt ohne Pinsel iin
Spazierengehen, im AnbfiCk, im Nachsinnen. Wenn
ich jhr gegenüber sitze, wartet sie auf die Falte
zwisChen Imeinen Brauen.
Else Lasker-Schüler
Richard Voss in Montenegro
Im Augustheft der Deutschen Rundschau gibt
Richard Voß in einer Reihe Von Erfebnissen den
„mächtigen“ Eindruck wieder, den Montenegro bei
rascher Durchfahrt auf seine empfängliche Seele
gemacht hat. Er drängt die Reihe von Erfebnissen
zwar nur in einem Artikef zusammen, aber der ist
dafür auch tötend längweilig. Als Voß von Korfu
nordwärts fuhr, geriet er im Frühjahr 1910 in „ein
homerisdies Königreich“.
„Nun kam ich, nun säh ich.“
Und es siegte die poetische Phantasie übter
die NüChternheit geographischer Bezeichnungen,
und Voß erlebte einen GeBäng Homers. Er „er-
febte in dem Zeitalter der drahtlosen Telegraphie,
der Sezession und Bernhard Shaws“ ein Epos.
Kein Name all der Großen der Geschichte, die
einmaf auf montenegrinistehem Boden standen, von
Cäsär bis zu Amalasuntha, „des großen Theodorichs
unSeliger Tochter', ist dem Dichter fremd, aber
er kennt keine stofzere Straße als die, welche nach
Cettinje führt. Sie ist in gewissem Sinne eine Via
triumphafis, „a u f i h r z i e h t d i e K u 11 u r d i e s e
unwirtlichen Höhen empor“.
Voß fährt an Bastionen vorüber. Der Doppef-
adter hält scharfe WaCht, die Cettinjer, die mit
Voß im Auto sitzen, haben einen Adferblick, und
bald schweben sie alle hoteh über der Tiefe, als
hätten sie „in brausendem Ffuge Adlerschwingen
emporgeführt“. Plötzlich wird Voß von einem Mit-
reisenden angerufen.
„Was 1 ist?“
„Montenegro!“
ES hanldeft sich nur um die Passierung der
Grenze. Doch der Montenegriner erzähfte nun auf
heimatfichem Boden Richard Voß Von den weisten
Gesetzen, die Peter der Zweite ihnen gab. „Du
darfst niteht stehlen. Stiehlst Du dreimal, so steht
Todesstrafe darauf.“
Voß fand die Gesletze vol'l Ueberzeugung „weise
wie König Salbmo“, und auf seine Frage : „Habt
ihr in Montenegro noch die Bfutrachte“, antwortete
der edfe Reisegefährte: „Herr, jenes Geböt steht
im Herzen unsteres Volkes geschrieben. E,in solchtes
föscht kein Gesetz aus.“ Die Gesetze siind — nach'
RiChard Voß — weise wie König Safömo, aber der
239
im fetzten Akt des Erdgeist). Man ist doch nur
ein Mensdh_“
Pippa tanzt mit dem „alten Huhn“.
Man sehe, was aus dem Literaten Hauptmann
geworden ist. Die putzigen „Spezialkorresponden-
ten“, die damals den Berliner Durdhfall Pippas in
die Welt telegraphierten, ließen den ersten Akt
nodh gelten. Nach meinem Oefühl mit Unrecht.
Denn dieser Akt ist auch von einem Dichter. Er
spiel't „in ;der Sdhenke des alten Wende in Rot-
wassergrund“, ist jaber kein Akt aus Fuhrmann
Henschel 1. Und die „handelnden Personen“ reden
zwar Sdheinbar das gewöhnKche Schlesisdh, aber
jedes ihrer Worte hat einen gewissen Unterton,
der ihre iZugehörigkeit zu einer unendlichen Welt
verrät. Symbolische Fäden verbinden sie mit dem
poetisdhen Hintergrund, und nicht nur gesprochene
Alltäglichkeit |mit jdem „Ort der Handlung“.
Daher das prächtige Kolbrit des sdheinbär „re-
afistischen“ Dialogs: ein Wedekindscher Dialog —
von Hauptmann.
Pippa tanzt mit Huhn, den sie häßt und fürchtet,
vor Männern, jdie sie verachtet und fürdhtet. Bis
auf einen. Dieser Eine ist ein „wandernder Hand-
werksbürsche“. Der junge Midiaef Helfriegef, der
in die Weft zieht, um „etwasl ganz Besonderes“ zu
erlernen und zu erleben. Spuckt Blut. Aber hat
die Jugend und den Märchengfauben. AIso ein
König. — Und nun weiß man, daß Pippa für ihn
tanzt. Für den Dichter tanzt die Schönheit auf
Erden.
Vortäufig wird aber diese SChönheit von einem
stärkeren entführt. Der alte Huhn benutzt einen
günstigen Augenbfick, stürzt sich wie ein Raubtier
auf Pippa und trägt sie daVon, hinauf in die Berge,
in seine Hütte.
Und nun, in einer lüftigeren, „wildromantischen
Umgebung“ (wo die Wirkfichkeit und das : Ver-
ständnis des kfeinen Rezensenten aufhören) die Fort-
stetzung der Tragikomödie Vom irdisChen Spieß-
rutenfaufen d er Schönheit.
Der Verrückte Poet Michaef kommt von un-
gefähr in die Höhfe deSI Riesen. Das Raubtier
ist in dem Moment „nicht zu Hause“. Wohf aber
seine Beute. Ein kostbäres tete ä tete mit Pippa.
Eine der sChönsten Szenen. Quasi Liebesszene, aber
50, wie man im Märchen tiebt. Er — wie Peer
Oynt — Lügner und Poet, Kind und Prahfer. Glaubt
am fiebsten an diejenigen Dinge, die es nicht gibt
— und ist jeder Heldentat fähig, wenn sie unsinnig
ist. Und sie eine Perlte in der Galerie der deut-
schen „Naiven“. Aber zwisChen ihr und einem
Gretchen fiegt ein Abgrund oder — Lulu von Wede-
kind. Auf die Nachricht von der Ermordung ihres
Vaters, der sie prügelte und überhaupt molto Cattivö
war, fäflt slie nic'ht in OhnmaCht, sondern ihrem
Michaef fachend um den Hals. „Ach, so hab’ ich
ja niemand mehr in der Welt! Nicmand alsl diCh!“
Und der Poet beSChfießt natürlich sofort, das arme
Mädchen bis ans Ende der Wel't zu tragen.
Wenn sie auf dieser Reise nach Venedig über
Berge und GfetsCher niCht zugrunde gehten, so ver-
danken sie es einer mythisChten Persönlichkeit, dem
greisen Wann, der in einer Baude auf dem Kamm
des pebirges wohnt, die Welt liebt und von der
Vogelperspektive sieht. Er Iockt die beiden in sein
Haus |und rettet sie so vor dem Tode. Wer ist
Wann? Sicher nicht der Herrgott (wie die stehärf-
sinnigsten Rezensenten 'meinen). Mir genügt es,
daß er hoch oben wohnt und (wie der Dichter
des Gläsmärchens Pippa) die Welt von der Vogel-
perspektive sieht. Vieffeicht ist es keine „Persön-
lichkeit“, sondern — ein Standpunkt.
Wann nimmt Jugend und Schönheit zu Sich auf
und bewirtet sie wie königfiche Gäste. Und die
beiden (danken ihm nicht, sondern begegnen ihm
mit Trotz und Stofz, wie es der Jugend geziemt.
Dafür spieft er mit ihnen wie mit Kindern. Er
lächt über den Poeten, der „auf praktistehe Weise“
naCh Venedig reisen wifl. . . . „Nein, so kommst
du wahrsCheinfiCh niemals hin. Aber . . .“ und
er zeigt ihm dasl kfeine Modell einer venezianischen
Gondef; ... „wenn du mit diestem Schifffein reisest,
mit dem schon die ersten Pfahlbauern in die La-
gunen hinausfuhren, und aus dem, wie aus einer
schwimmenden Räucherschalte phantastischer Rauch,
der Künstlertraum Venedig quoll ... so kannst
du mit einemmaf alles erblicken, wonach deine Seele
strebt . . .“ Ja, das ist unsinnig genug, und Mi-
chaef islt einverstanden. Er mimrnt das Spielzeug
in die Hand, und Wann versetzt ihn in einen hyp-
notisChen Schfaf, — mittels einer Zauberformel, die
er Pippa nachspreChen lläßt und ihren Finger um
den Rand einesl venezianischen Gfases herumführt.
Das Gfas ersChauert und erklingt unter der Be-
führung PippaS, die Töne werden imimer stärker,
und auf den Weflen dieser Musik reist Michael
im Traum naCh „Venedig“: Er „erblickt alles 1, wo-
nach Seine schmachtende Seelte strebt“.
Er reist afso — allein. Dies kfeine Detail ist
wiChtig. DieSi tragische Detaif, daß die „Schön-
heit auf Erden“ nur für einen ist, für den Dichter,
und auch für dieSen einen — nicht ist. Nur darum
maCht der alte Ironiker sein seltsames Experiment
mit der Gondef. AuS purem Vergnügen an einem
sChönen JBeweis. An dem Beweis, daß Michael
steine Pippa in der Seete hat — und erblinden
könnte — und Pippa doch hätte. Die Rofle Pippas,
der „irdisChen Schönheit“, beschränkt sich darauf,
daß Sie in der Seefe des Poeten Michael jene Klänge
hervorruft, die ihn in das Wunderfand der Phantasie
tragen. Aber Sonst ist Pippa für Michaef — nicht.
Sie tanzt wohf für ihn. Aber nicht mit ihm. Sie
tanzt (mit demjenigen, den sie haßt. In diesem
Stück und — immer. Sie tanzt mit dem brutafen
Huhn. Und zu diesem Tanz treibt sie der starke,
ewige Instinkt, der afles Lebendige in die Arme
deS Todes treibt.
Dieser zweite und fetzte Tanz, der Todestanz
der Schönheit mit der Kraft, bifdet den Schluß
des Dramas. Der Riese schleicht sich in die Hütte
Wanns 1 ein und VersteCkt sich hinter dem Ofen.
Man weiß es zuerst nicht (zur großen Freude der
„Spezialkorrespondenten“, die ihn für ein Symbol
des Aflwissenden halten) und entdeekt den Ein-
dringfing erst nadhts, als Michael und Pippa
sChfafen. Ein kurzes, fast stummesl Ringen der Weis-
heit mit der Kraft, und esi siegt die Weisheit. Huhn
sinkt — aber l'ebt noCh. Und mit dem Rest seines
brutalten LebenS tötet er später Pippa, die sich in
Abwesenheit Wanns und mit demt Einverständnis
MichaelS Von ihm zum Tanze verleiten läßt.
Dieser Tanz ist das schönste Finafe, das ich
kenne. Erinnert rniCh an das' herrfiche Ende Lulus
in der „Büchste der Pandora“. Der „afte Huhn“
spieft hier jdie Rolte desi JaCk thte ripper. Es ist
wie ein riesiiges, fustig brennendes Opferfeuer, zu
Ehren des mors imperator. Drei Glieder des Tanzes:
die „Einladung“, daS Flehen des totkranken Raub-
tieres, sdhwere, prächtige Urworte, heiße Lavastücke,
dann das „Mitleid“ des MädChens für den Ster-
benden und die göttfiehe Naivität desl Poeten Mi-
Chaef, der Pippa zuredet zu tanzen; sChließlich das
große „Feuer“, der Tanz. . . . Während des ! Tanzes
zerbriCht daS Weingfas, das Huhn in der Hand hält,
und . . . Pippa stirbt. Dann stürzt der Riese.
Ein retrospektives Symbof — könnte man sagen
— ist die nun wirkfiCh eintretende Blindheit Hell-
riegefs. Er weiß niChts vom Tode seiner „Ge-
liebten“; sb wie — er früher nitehts von ihrem Leben
wußte. Er ist gfücklich, er hat Pippa in sich. —
Das GllasmärChen vom irdisChen Spießruten-
faufen der SChönheit erlitt das gleiche Schicksal,
wie die Schönheit Selbst. Und das ist Öie äußere
Ironie des HauptmannsChen Dramäs. Es vereinigten
sich afle Spezialbärbaren, die in Kritik maChen,
denn es handeft sich um den Angriff auf einen
gemeinsamen Feind — den Dichter. Sie vereinigten
sich afle, um ihn und das Werk, das „Niemand
verstehen kann“, mit ihrem Hasse zu krönen. Und
Pippa tanzt. . . . Ave poeta!
Marie Böhm
Ecke Französische und Charfottenstraße lachen
aus einem der Gfaskästen schöne, weiße Zähne,
zWistehen frischen Lippen in Mädchengesichtern.
Manche von den jungen Schäuspieferinnen offen-
baren ihre ureigene Begabung, denn ihre Perimutter-
hecken sind gar nicht erschaffen, am Abend hinter
zuCkenden Lippen versteckt zu schimmern. Ueber
dem Atefier Von Marie Böhm sCheint auch der
iHimmef zu heiter; die wundervolle Photographin
kann nicht genug Vorhänge über die Sonne ziehen,
die maCht immerfort ein freundfiches! Gesicht. Marie
Böhm ist die Eigentümerin des kunstphotographi-
sChen Atefiers Becker und Maass. Man kann siteh
ohne Gefahr vor Entstelfung vor ihren Apparat
begeben. Marie Böhin weiß im fiChtigen Augen-
blick den ßlidc Vom Auge zu nelnnen. „Der
nichtslsagendste, ausdrucksfoseste Mensch hat einen
Augenbfick, den muß man eben festhalten.“ Ihre
fieben, blauen Augen strahlen, als sie das antwortet.
Ich verstecke mich unter einem Tisch hinter längen
Laubgewätehsen, um aus meiner Froschperspektive
einige Aufnahmen zu beobaChten. Daß das nicht
angehe, meint Fräufein Böhm — schon naht das
Brautpaar, ic'h rufe ihr aus meiner Lage zerstreut
zu, sie sofl sagen — im Fall — ich bin Arzt und
interessiere mich für neuartige Operationen. Diese
IdeenVerwirrung stammt von meinem Vater her, er
verwechselte immer das Zahnziehen mit dem Photo-
graphierenläsisen. Beides hat so was mit dem
Heraushofen zu tun — und —- „der eine Augen-
bfiCk“. Marie Böhm aber hat keine Zange in
der Hand. Bräutigamundbfautumschlüngen sitzen
die beiden auf der Bank und drehen ihr den
Rücken zu; ihre üesichter bficken sich auf einmal
nach etwasi um. Ob sie micli quaken hören! —
„Danke!“ Zweite Aufnahme. — Für die Photo-
graphien imüßte es' auch eir.e Weft geben aus ge-
diegenem Silberoxyd irn Krinolin. Das' Album ist
aus cier Mode gekommen, darin s'ich das photo-
graphierte OnkeltantengeSchfecht zum Aufblättern
befand; es stirbt nicht aus. In Schafen liegen all
die Pietäten, Frauen, die siCh auCh schon Löckchen
drehten, Nun sind unsere KfeidersäCke zugebünden,
Auf den slpätverwandten Bildern Stehen Öie Röcke
weit in Runden. Ihre Augen aufgetan in
Todesängst ,— den Augenblick zu greifen, heute
hasteht ihn die Photographie wie einen Schmetter-
fing Vöm zwanglosen Sichgehenlassen. Und ge-
rade Imeine liebe Marie Bölim ist eine soi große
Photographin — sie photographiert auch ohne
Apparat gerade mitten in der Sonne mit gesChfosse-
nen Augen, wie der Mafer malt ohne Pinsel iin
Spazierengehen, im AnbfiCk, im Nachsinnen. Wenn
ich jhr gegenüber sitze, wartet sie auf die Falte
zwisChen Imeinen Brauen.
Else Lasker-Schüler
Richard Voss in Montenegro
Im Augustheft der Deutschen Rundschau gibt
Richard Voß in einer Reihe Von Erfebnissen den
„mächtigen“ Eindruck wieder, den Montenegro bei
rascher Durchfahrt auf seine empfängliche Seele
gemacht hat. Er drängt die Reihe von Erfebnissen
zwar nur in einem Artikef zusammen, aber der ist
dafür auch tötend längweilig. Als Voß von Korfu
nordwärts fuhr, geriet er im Frühjahr 1910 in „ein
homerisdies Königreich“.
„Nun kam ich, nun säh ich.“
Und es siegte die poetische Phantasie übter
die NüChternheit geographischer Bezeichnungen,
und Voß erlebte einen GeBäng Homers. Er „er-
febte in dem Zeitalter der drahtlosen Telegraphie,
der Sezession und Bernhard Shaws“ ein Epos.
Kein Name all der Großen der Geschichte, die
einmaf auf montenegrinistehem Boden standen, von
Cäsär bis zu Amalasuntha, „des großen Theodorichs
unSeliger Tochter', ist dem Dichter fremd, aber
er kennt keine stofzere Straße als die, welche nach
Cettinje führt. Sie ist in gewissem Sinne eine Via
triumphafis, „a u f i h r z i e h t d i e K u 11 u r d i e s e
unwirtlichen Höhen empor“.
Voß fährt an Bastionen vorüber. Der Doppef-
adter hält scharfe WaCht, die Cettinjer, die mit
Voß im Auto sitzen, haben einen Adferblick, und
bald schweben sie alle hoteh über der Tiefe, als
hätten sie „in brausendem Ffuge Adlerschwingen
emporgeführt“. Plötzlich wird Voß von einem Mit-
reisenden angerufen.
„Was 1 ist?“
„Montenegro!“
ES hanldeft sich nur um die Passierung der
Grenze. Doch der Montenegriner erzähfte nun auf
heimatfichem Boden Richard Voß Von den weisten
Gesetzen, die Peter der Zweite ihnen gab. „Du
darfst niteht stehlen. Stiehlst Du dreimal, so steht
Todesstrafe darauf.“
Voß fand die Gesletze vol'l Ueberzeugung „weise
wie König Salbmo“, und auf seine Frage : „Habt
ihr in Montenegro noch die Bfutrachte“, antwortete
der edfe Reisegefährte: „Herr, jenes Geböt steht
im Herzen unsteres Volkes geschrieben. E,in solchtes
föscht kein Gesetz aus.“ Die Gesetze siind — nach'
RiChard Voß — weise wie König Safömo, aber der
239