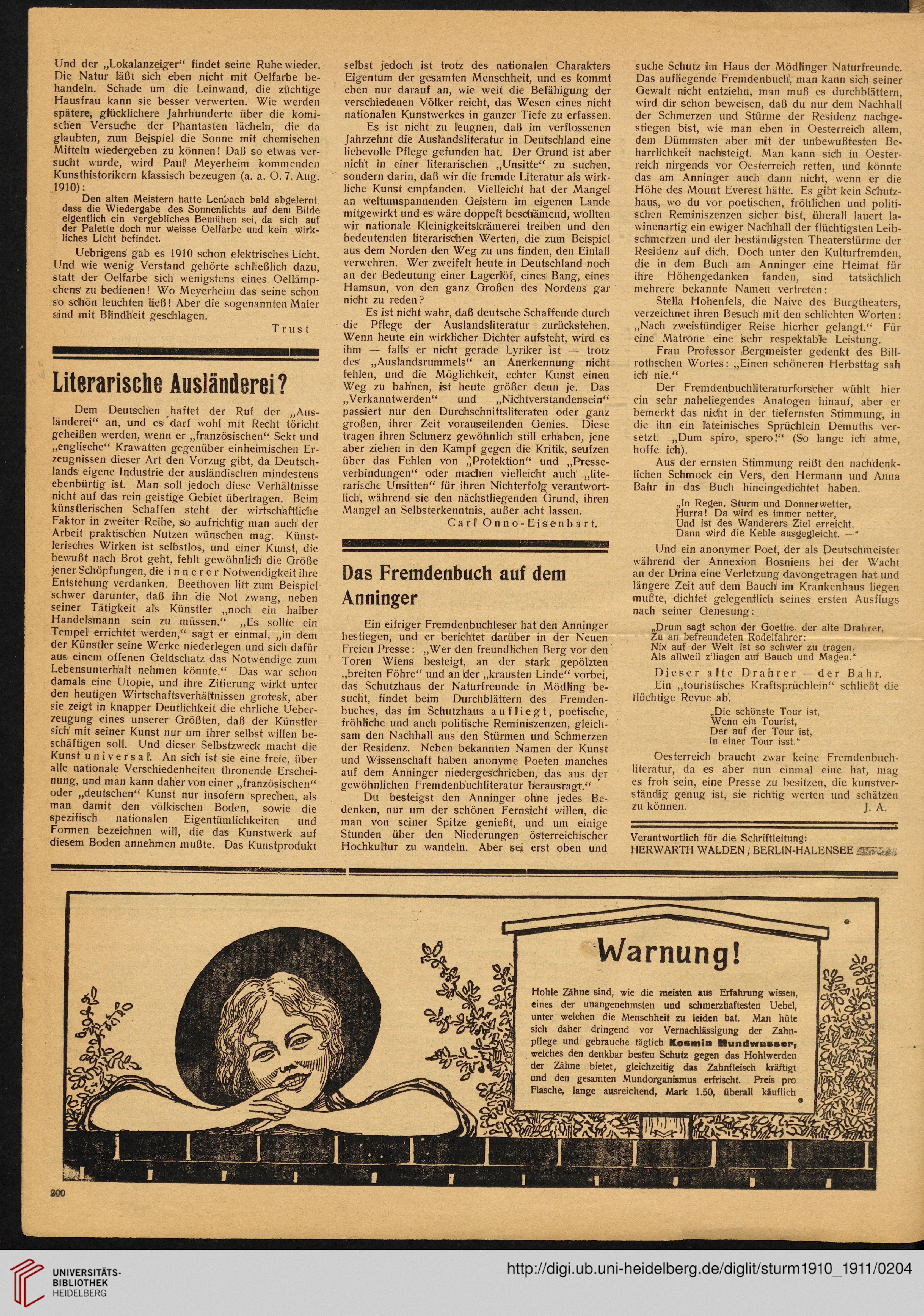Der Sturm: Monatsschrift für Kultur und die Künste — 1.1910-1911
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.31770#0204
DOI Heft:
Nr. 25 (August 1910)
DOI Artikel:Walden, Herwarth: Das Ende
DOI Artikel:Onno-Eisenbart, Carl: Literarische Ausländerei?
DOI Artikel:Adler, Joseph: Das Fremdenbuch auf dem Anninger
DOI Artikel:Werbung
DOI Seite / Zitierlink: https://doi.org/10.11588/diglit.31770#0204
Und der „Lokalanzeiger“ findet seine Ruhe wieder.
Die Natur läßt sich eben nicht mit Oelfarbe be-
handeln. Schade um die Leinwand, die züchtige
Hausfrau kann sie besser verwerten. Wie werden
spätere, glücklichere Jahrhunderte über die komi-
schen Versuche der Phantasten lächeln, die da
glaubten, zum Beispiel die Sonne mit chemischen
Mitteln wiedergeben zu können! Daß so etwas ver-
sucht wurde, wird Paul Meyerheim kommenden
Kunsthistorikern klassisch bezeugen (a. a. 0.7. Aug.
1910):
Den alten Meistern hatte Lenbach bald abgelernt
dass die Wiedergabe des Sonnenlichts auf deni Bilde
eigentlich ein vergebliches Bemiihen sei, da sich auf
der Palette doch nur Weisse Oelfarbe und kein Wirk-
liches Licht befindet.
Uebrigens gab es 1910 schon elektrisches Licht.
Und wie wenig Verstand gehörte schließlich dazu,
statt der Oelfarbe sich wenigstens eines Oellämp-
chens zu bedienen! Wo Meyerheim das seine schon
so scihön leuchten ließ! Aber die sogenannten Maler
sind mit Blindheit geschlagen.
T r us t
Literarische Ansländerei ?
Dem Deutschen haftet der Ruf der „Aus-
länderei“ an, und es darf wohl mit Recht töricht
geheißen werden, wenn er „französischen“ Sekt und
„englische“ Krawatten gegenüber einheimischen Er-
zeugnissen dieser Art den Vorzug gibt, da Deutsch-
lands eigene Industrie der ausländischen mindestens
ebenbürtig ist. Man soll jedoch diese Verhältnisse
nicht auf das rein geistige Oebiet übertragen. Beim
künstlerischen Schaffen steht der wirtsdhaftliche
Faktor in zweiter Reihe, so aufrichtig man auch der
Arbeit praktischen Nutzen wünsChen mag. Künst-
leristhes Wirken ist selbstlos, und einer Kunst, die
bewußt nach Brot geht, fehlt gewöhnlich die Oröße
jener Schöpfungen, die i n n e r e r Notwendigkeit ihre
Entstehung verdanken. Beethoven litt zum Beispiel
schwer darunter, daß ihn die Not zwang, neben
seiner Tätigkeit als Künstler „noch ein halber
Handelsmann sein zu müssen.“ „Es sollte ein
Tempel errichtet werden,“ sagt er einmal, „in dem
der Künstler seine Werke niederlegen und sich dafür
aus einem offenen Oeldschatz das Notwendige zum
Lebensunterhalt nehmen könnte.“ Das war schon
damals eine Utopie, und ihre Zitierung wirkt unter
den heutigen Wirtschaftsverhältnissen grotesk, aber
sie zeigt in knapper Deutlichkeit die ehrliche Ueber-
zeugung eines unserer Orößten, daß der Künstler
sich mit seiner Kunst nur um ihrer selbst willen be-
schäftigen soll. Und dieser Selbstzweck inacht die
Kunst u n i v e r s a f. An sich ist sie eine freie, über
allc nationale Verschiedenheiten thronende Erschei-
nung, und man kann daher von einer „französischen“
oder „deutschen“ Kunst nur insofern sprecher., als
man damit den völkischen Boden, sowie die
spezifisch nationalen Eigentümlichkeiten und
Formen bezeichnen will, die das Kunstwerk auf
diesem Boden annehmen inußte. Das Kuustprodukt
selbst jedoch ist trotz des nationalen Charakters
Eigentum der gesämten Menschheit, und es kommt
eben nur darauf an, wie weit die Befähigung der
verschiedenen Völker reicht, das Wesen eines nicht
nationalen Kunstwerkes in ganzer Tiefe zu erfassen.
Es ist nicht zu l'eugnen, daß im verflossenen
Jahrzehnt die Auslandsliteratur in Deutschland eine
liebevolle Pflege gefunden hat. Der Orund ist aber
nicht in einer literarischen „Unsitte“ zu suchen,
sondern darin, daß wir die fremde Literatur als wirk-
liche Kunst empfanden. Vielleicht hat der Mangel
an weltumspannenden Geistern im eigenen Lande
mitgewirkt und es wäre doppelt beschämend, wollten
wir nationale Kleinigkeitskrämerei treiben und den
bedeutenden literarisChen Werten, die zum Beispiel
aus dem Norden den Weg zu uns finden, den Einläß
verwehren. Wer zweifelt heute in Deutschland noch
an der Bedeutung einer Lagerlöf, eines Bang, eines
Hamsun, von den ganz Großen des Nordens gar
nicht zu reden?
Es ist niCht wahr, daß deutsche Schaffende durch
die Pflege der Auslandsliteratur zurückstehen.
Wenn heute ein wirklicher Dichter aufsteht, wird es
ihm — falls er nicht gerade Lyriker ist — trotz
des „Auslandsrummels“ an Anerkennung nicht
fehlen, und die Möglichkeit, echter Kuns't einen
Weg zu bahnen, ist heute größer denn je. Das
„Verkanntwerden“ und „Nichtverstandensein“
passiert nur den Durchschnittsliteraten oder ganz
großen, ihrer Zeit vorauseilenden Qenies. Diese
tragen ihren Schmerz gewöhnliCh still erhaben, jene
aber ziehen in den Kampf gegen die Kritik, seufzen
iiber das Fehlen von ,',Protektion“ und „Presse-
verbindungen“ oder machen vielleicht auch „lite-
rarische Unsitten“ für ihren Nichterfolg verantwort-
lich, während sie den nächstliegenden Qrund, ihren
Mangel an Selbsterkenntnis, außer acht lassen.
CarI Onno-Eisenbärt.
Das Fremdenbuch auf dem
Anninger
Ein eifriger Fremdenbuchleser hat den Anninger
bestiegen, und er berichtet darüber in der Neuen
Freien Presse: „Wer den freundlichen Berg vor den
Toren Wiens besteigt, an der stark gepölzten
„breiten Föhre“ und an der „krausten Linde“ vorbei,
das Schutzhaus der Naturfreunde in Mödling be-
sucht, findet beim Durchblättern des Fremden-
buches, das im Schutzhaus a u f 1 i e g t, poetische,
fröhliche und auch politische Reminiszenzen, gleich-
sam den Nachhall aus den Stürmen und Schmerzen
der Residenz. Neben bekannten Namen der Kunst
und Wissenschaft haben anonyme Poeten manches
auf dem Anninger niedergeschrieben, das aus der
gewöhnlichen Fremdenbuchliteratur herausragt.“
Du besteigst den Anninger ohne jedes Be-
denken, nur um der schönen Fernsicht willen, die
man von seiner Spitze genießt, und um einige
Stunden über den Niederungen österreichischer
Hochkultur zu wandeln. Aber sei erst oben und
suthe Schutz im Haus der Mödlinger Naturfreunde.
Das aufliegende Fremdenbuch, man kann sich seiner
Qewalt nicht entziehn, man muß es durchblättern,
wird dir schbn beweisen, daß du nur dem Nachhall
der Schmerzen und Stürme der Residenz nachge-
stiegen bist, wie man eben in Oesterreich allem,
dem Dümmsten aber mit der unbewußtesten Be-
harrlichkeit nachsteigt. Man kann siCh in Oester-
reich nirgends vor Oesterreich retten, und könnte
das am Anninger auch dann nicht, wenn er die
Höhe des Mount Everest hätte. Es gibt kein Schutz-
haus, wo du vor poetischen, fröhlichen und politi-
schen Reminiszenzen sicher bist, überall lauert la-
winenartig ein ewiger Nachhall der flüchtigsten Leib-
schmerzen und der beständigsten Theaterstürme der
Residenz auf diCh. Doch unter den Kulturfremden,
die in dem Buch am Anninger eine Heimat für
ihre Höhengedanken fanden, sind tatsächlich
niehrere bekannte Namen vertreten:
Stella Hohenfels, die Naive des Burgtheaters,
verzeichnet ihren Besuch mit den schlichten Worten:
„Nacli zweistündiger Reise hierher gelängt.“ Für
eine Matrone eine sehr respektable Leistung.
Frau Professor Bergmeister gedenkt des Bill-
rothschen Wortes: „Einen schöneren Herbsttag sah
ich nie.“
Der Fremdenbuchliteraturforscher wühlt hier
ein sehr naheliegendes Analogen hinauf, aber er
bemcrkt das nioht in der tiefernsten Stimmung, in
die ihn ein läteinisches Sprüchlein Demuths ver-
setzt. „Dum spiro, spero!“ (So lange ich atme,
hoffe ich).
Aus der ernsten Stimmung reißt den nachdenk-
lichen Schmock ein Vers, den Hermann und Anna
Bahr in das Buch hineingedichtet haben.
„In Regen, Sturm und DonnerWetter,
Hurra! Da wird es immer netter,
Und ist des Wanderers Ziel erreicht,
Dann Wird die Kehle ausgegleicht. —“
Und ein anonymer Poet, der als Deutschmeister
während der Annexion Bosniens bei der Wacht
an der Drina eine Verletzung davongetragen hat und
längere Zeit auf dem Bauch im Krankenhaus liegen
niußte, dichtet gelegentlich seines ersten Ausflugs
nach seiner Oenesung:
„Drum sagt schon der Goethe, der alte Drahrer,
Zu an befreundeten Rodelfahrer:
Nix auf der Welt ist so schwer zu tragen,
Als allweil z’liagen auf Bauch und Magen.“
D i e s e r a 11 e Drahrer — d e r B a h r.
Ein „touristisches Kraftsprüchlein“ schließt die
flüchtige Revue ab.
„Die schönste Tour ist,
Wenn ein Tourist,
Der auf der Tour ist,
In einer Tour isst.“
Oesterreich braucht zwar keine Fremdenbuch-
literatur, da es aber nun einmal eine hat, mag
es froh sein, eine Presse zu besitzen, die kunstver-
ständig genug ist, sie riChtig werten und schätzen
zu können. J. A.
VerantWortlich fiir die Schriftleitung:
HERWARTH WALDEN; BERLIN-HALENSEE ffigfwiLi
Warnung!
Hohle Zähne sind, wie die meisten aus Erfahrung wissen,
eines der unangenehmsten und schmerzhaftesten Uebel,
unter welchen die Menschheit zu leiden hat. Man hüte
sich daher dringend vor Vemachlässigung der Zahn-
pflege und gebrauche täglich Kosmin lülundwatser,
welches den denkbar besten Schutz gegen das Hohlwerden
der Zähne bietet, gleichzeitig das Zahnfleisch kräftigt
und den gesamten Mundorganismus erfrischt. Preis pro
Flasche, lange ausreichend, Mark 1.50, überall käuflich
890
Die Natur läßt sich eben nicht mit Oelfarbe be-
handeln. Schade um die Leinwand, die züchtige
Hausfrau kann sie besser verwerten. Wie werden
spätere, glücklichere Jahrhunderte über die komi-
schen Versuche der Phantasten lächeln, die da
glaubten, zum Beispiel die Sonne mit chemischen
Mitteln wiedergeben zu können! Daß so etwas ver-
sucht wurde, wird Paul Meyerheim kommenden
Kunsthistorikern klassisch bezeugen (a. a. 0.7. Aug.
1910):
Den alten Meistern hatte Lenbach bald abgelernt
dass die Wiedergabe des Sonnenlichts auf deni Bilde
eigentlich ein vergebliches Bemiihen sei, da sich auf
der Palette doch nur Weisse Oelfarbe und kein Wirk-
liches Licht befindet.
Uebrigens gab es 1910 schon elektrisches Licht.
Und wie wenig Verstand gehörte schließlich dazu,
statt der Oelfarbe sich wenigstens eines Oellämp-
chens zu bedienen! Wo Meyerheim das seine schon
so scihön leuchten ließ! Aber die sogenannten Maler
sind mit Blindheit geschlagen.
T r us t
Literarische Ansländerei ?
Dem Deutschen haftet der Ruf der „Aus-
länderei“ an, und es darf wohl mit Recht töricht
geheißen werden, wenn er „französischen“ Sekt und
„englische“ Krawatten gegenüber einheimischen Er-
zeugnissen dieser Art den Vorzug gibt, da Deutsch-
lands eigene Industrie der ausländischen mindestens
ebenbürtig ist. Man soll jedoch diese Verhältnisse
nicht auf das rein geistige Oebiet übertragen. Beim
künstlerischen Schaffen steht der wirtsdhaftliche
Faktor in zweiter Reihe, so aufrichtig man auch der
Arbeit praktischen Nutzen wünsChen mag. Künst-
leristhes Wirken ist selbstlos, und einer Kunst, die
bewußt nach Brot geht, fehlt gewöhnlich die Oröße
jener Schöpfungen, die i n n e r e r Notwendigkeit ihre
Entstehung verdanken. Beethoven litt zum Beispiel
schwer darunter, daß ihn die Not zwang, neben
seiner Tätigkeit als Künstler „noch ein halber
Handelsmann sein zu müssen.“ „Es sollte ein
Tempel errichtet werden,“ sagt er einmal, „in dem
der Künstler seine Werke niederlegen und sich dafür
aus einem offenen Oeldschatz das Notwendige zum
Lebensunterhalt nehmen könnte.“ Das war schon
damals eine Utopie, und ihre Zitierung wirkt unter
den heutigen Wirtschaftsverhältnissen grotesk, aber
sie zeigt in knapper Deutlichkeit die ehrliche Ueber-
zeugung eines unserer Orößten, daß der Künstler
sich mit seiner Kunst nur um ihrer selbst willen be-
schäftigen soll. Und dieser Selbstzweck inacht die
Kunst u n i v e r s a f. An sich ist sie eine freie, über
allc nationale Verschiedenheiten thronende Erschei-
nung, und man kann daher von einer „französischen“
oder „deutschen“ Kunst nur insofern sprecher., als
man damit den völkischen Boden, sowie die
spezifisch nationalen Eigentümlichkeiten und
Formen bezeichnen will, die das Kunstwerk auf
diesem Boden annehmen inußte. Das Kuustprodukt
selbst jedoch ist trotz des nationalen Charakters
Eigentum der gesämten Menschheit, und es kommt
eben nur darauf an, wie weit die Befähigung der
verschiedenen Völker reicht, das Wesen eines nicht
nationalen Kunstwerkes in ganzer Tiefe zu erfassen.
Es ist nicht zu l'eugnen, daß im verflossenen
Jahrzehnt die Auslandsliteratur in Deutschland eine
liebevolle Pflege gefunden hat. Der Orund ist aber
nicht in einer literarischen „Unsitte“ zu suchen,
sondern darin, daß wir die fremde Literatur als wirk-
liche Kunst empfanden. Vielleicht hat der Mangel
an weltumspannenden Geistern im eigenen Lande
mitgewirkt und es wäre doppelt beschämend, wollten
wir nationale Kleinigkeitskrämerei treiben und den
bedeutenden literarisChen Werten, die zum Beispiel
aus dem Norden den Weg zu uns finden, den Einläß
verwehren. Wer zweifelt heute in Deutschland noch
an der Bedeutung einer Lagerlöf, eines Bang, eines
Hamsun, von den ganz Großen des Nordens gar
nicht zu reden?
Es ist niCht wahr, daß deutsche Schaffende durch
die Pflege der Auslandsliteratur zurückstehen.
Wenn heute ein wirklicher Dichter aufsteht, wird es
ihm — falls er nicht gerade Lyriker ist — trotz
des „Auslandsrummels“ an Anerkennung nicht
fehlen, und die Möglichkeit, echter Kuns't einen
Weg zu bahnen, ist heute größer denn je. Das
„Verkanntwerden“ und „Nichtverstandensein“
passiert nur den Durchschnittsliteraten oder ganz
großen, ihrer Zeit vorauseilenden Qenies. Diese
tragen ihren Schmerz gewöhnliCh still erhaben, jene
aber ziehen in den Kampf gegen die Kritik, seufzen
iiber das Fehlen von ,',Protektion“ und „Presse-
verbindungen“ oder machen vielleicht auch „lite-
rarische Unsitten“ für ihren Nichterfolg verantwort-
lich, während sie den nächstliegenden Qrund, ihren
Mangel an Selbsterkenntnis, außer acht lassen.
CarI Onno-Eisenbärt.
Das Fremdenbuch auf dem
Anninger
Ein eifriger Fremdenbuchleser hat den Anninger
bestiegen, und er berichtet darüber in der Neuen
Freien Presse: „Wer den freundlichen Berg vor den
Toren Wiens besteigt, an der stark gepölzten
„breiten Föhre“ und an der „krausten Linde“ vorbei,
das Schutzhaus der Naturfreunde in Mödling be-
sucht, findet beim Durchblättern des Fremden-
buches, das im Schutzhaus a u f 1 i e g t, poetische,
fröhliche und auch politische Reminiszenzen, gleich-
sam den Nachhall aus den Stürmen und Schmerzen
der Residenz. Neben bekannten Namen der Kunst
und Wissenschaft haben anonyme Poeten manches
auf dem Anninger niedergeschrieben, das aus der
gewöhnlichen Fremdenbuchliteratur herausragt.“
Du besteigst den Anninger ohne jedes Be-
denken, nur um der schönen Fernsicht willen, die
man von seiner Spitze genießt, und um einige
Stunden über den Niederungen österreichischer
Hochkultur zu wandeln. Aber sei erst oben und
suthe Schutz im Haus der Mödlinger Naturfreunde.
Das aufliegende Fremdenbuch, man kann sich seiner
Qewalt nicht entziehn, man muß es durchblättern,
wird dir schbn beweisen, daß du nur dem Nachhall
der Schmerzen und Stürme der Residenz nachge-
stiegen bist, wie man eben in Oesterreich allem,
dem Dümmsten aber mit der unbewußtesten Be-
harrlichkeit nachsteigt. Man kann siCh in Oester-
reich nirgends vor Oesterreich retten, und könnte
das am Anninger auch dann nicht, wenn er die
Höhe des Mount Everest hätte. Es gibt kein Schutz-
haus, wo du vor poetischen, fröhlichen und politi-
schen Reminiszenzen sicher bist, überall lauert la-
winenartig ein ewiger Nachhall der flüchtigsten Leib-
schmerzen und der beständigsten Theaterstürme der
Residenz auf diCh. Doch unter den Kulturfremden,
die in dem Buch am Anninger eine Heimat für
ihre Höhengedanken fanden, sind tatsächlich
niehrere bekannte Namen vertreten:
Stella Hohenfels, die Naive des Burgtheaters,
verzeichnet ihren Besuch mit den schlichten Worten:
„Nacli zweistündiger Reise hierher gelängt.“ Für
eine Matrone eine sehr respektable Leistung.
Frau Professor Bergmeister gedenkt des Bill-
rothschen Wortes: „Einen schöneren Herbsttag sah
ich nie.“
Der Fremdenbuchliteraturforscher wühlt hier
ein sehr naheliegendes Analogen hinauf, aber er
bemcrkt das nioht in der tiefernsten Stimmung, in
die ihn ein läteinisches Sprüchlein Demuths ver-
setzt. „Dum spiro, spero!“ (So lange ich atme,
hoffe ich).
Aus der ernsten Stimmung reißt den nachdenk-
lichen Schmock ein Vers, den Hermann und Anna
Bahr in das Buch hineingedichtet haben.
„In Regen, Sturm und DonnerWetter,
Hurra! Da wird es immer netter,
Und ist des Wanderers Ziel erreicht,
Dann Wird die Kehle ausgegleicht. —“
Und ein anonymer Poet, der als Deutschmeister
während der Annexion Bosniens bei der Wacht
an der Drina eine Verletzung davongetragen hat und
längere Zeit auf dem Bauch im Krankenhaus liegen
niußte, dichtet gelegentlich seines ersten Ausflugs
nach seiner Oenesung:
„Drum sagt schon der Goethe, der alte Drahrer,
Zu an befreundeten Rodelfahrer:
Nix auf der Welt ist so schwer zu tragen,
Als allweil z’liagen auf Bauch und Magen.“
D i e s e r a 11 e Drahrer — d e r B a h r.
Ein „touristisches Kraftsprüchlein“ schließt die
flüchtige Revue ab.
„Die schönste Tour ist,
Wenn ein Tourist,
Der auf der Tour ist,
In einer Tour isst.“
Oesterreich braucht zwar keine Fremdenbuch-
literatur, da es aber nun einmal eine hat, mag
es froh sein, eine Presse zu besitzen, die kunstver-
ständig genug ist, sie riChtig werten und schätzen
zu können. J. A.
VerantWortlich fiir die Schriftleitung:
HERWARTH WALDEN; BERLIN-HALENSEE ffigfwiLi
Warnung!
Hohle Zähne sind, wie die meisten aus Erfahrung wissen,
eines der unangenehmsten und schmerzhaftesten Uebel,
unter welchen die Menschheit zu leiden hat. Man hüte
sich daher dringend vor Vemachlässigung der Zahn-
pflege und gebrauche täglich Kosmin lülundwatser,
welches den denkbar besten Schutz gegen das Hohlwerden
der Zähne bietet, gleichzeitig das Zahnfleisch kräftigt
und den gesamten Mundorganismus erfrischt. Preis pro
Flasche, lange ausreichend, Mark 1.50, überall käuflich
890