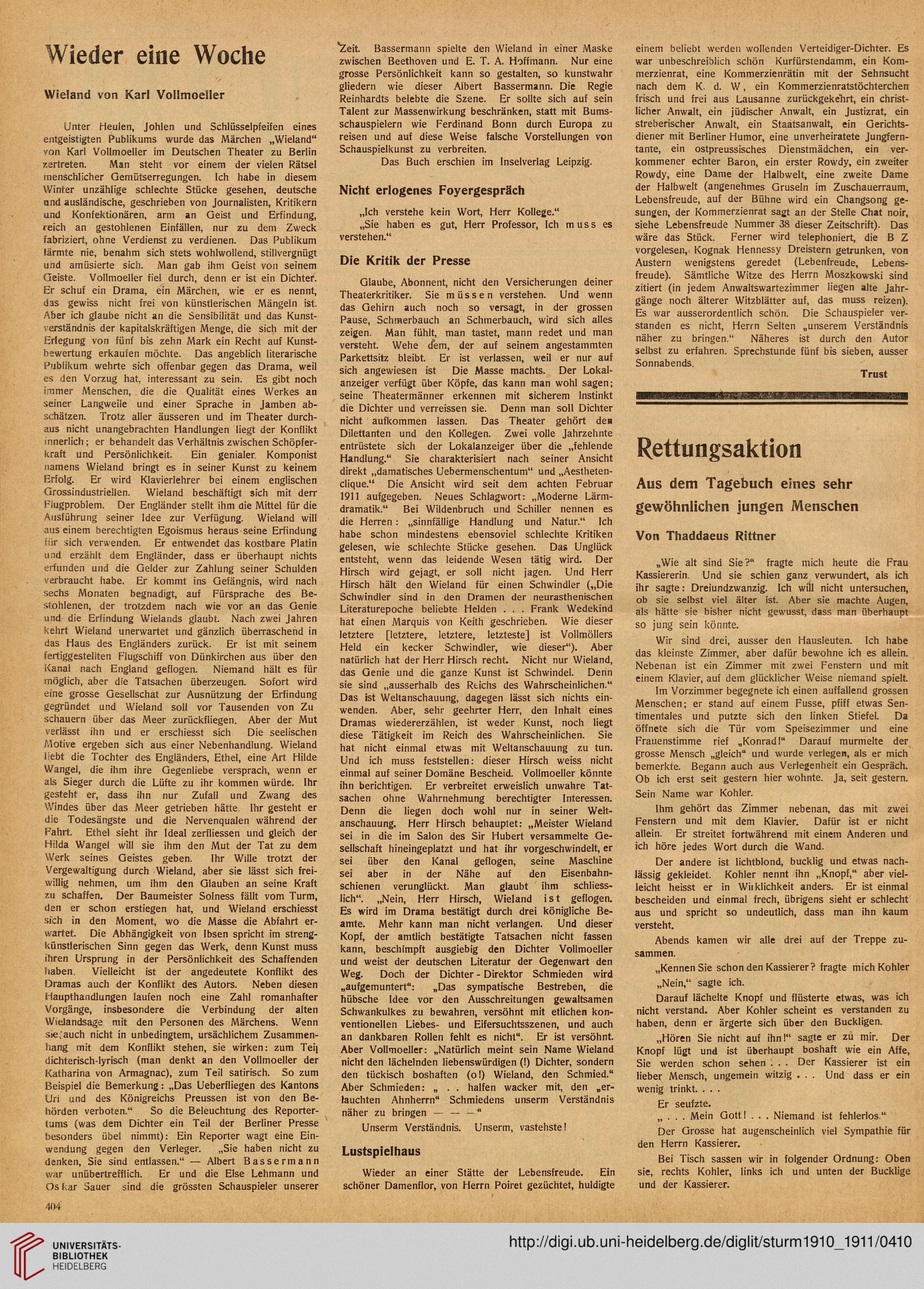Der Sturm: Monatsschrift für Kultur und die Künste — 1.1910-1911
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.31770#0410
DOI issue:
Nr. 51 (Februar 1911)
DOI article:Walden, Herwarth: Wieder eine Woche
DOI article:Rittner, Tadeusz: Rettungsaktion: Aus dem Tagebuch eines sehr gewöhnlichen jungen Menschen
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.31770#0410
Wieder eine Woche
Wieland von Karl Vollmoeller
Unter Heulen, Johlen und Schlüsselpfeifen eines
entgeistigten Publikums wurde das Märchen „Wieland“
von Karl Vollmoeller im Deutschen Theater zu Berlin
zertreten. Man steht vor einem der vielen Rätsel
menschlicher Gemütserregungen. Ich habe in diesem
Winter unzählige schlechte Stücke gesehen, deutsche
and ausländische, geschrieben von Journalisten, Kritikern
und Konfektionären, arm an Geist und Erfindung,
reich an gestohlenen Einfällen, nur zu dem Zweck
fabriziert, ohne Verdienst zu verdienen. Das Publikum
lärmte nie, benahm sich stets wohlwollend, stillvergnügt
und amüsierte sich. Man gab ihm Geist von seinem
Geiste. Vollmoeller fiel durch, denn er ist ein Dichter.
Er schuf ein Drama, ein Märchen, wie er es nennt,
das gewiss nicht frei von künstlerischen Mängeln ist.
Aber ich glaube nicht an die Sensibilität und das Kunst-
verständnis der kapitalskräftigen Menge, die sich mit der
Eriegung von fünf bis zehn Mark ein Recht auf Kunst-
bewertung erkaufen möchte. Das angeblich literarische
Publikum wehrte sich offenbar gegen das Drama, weil
es den Vorzug hat. interessant zu sein. Es gibt noch
immer Menschen, die die Qualität eines Werkes an
seiner Langweiie und einer Sprache in Jamben ab-
schätzen. Trotz aller äusseren und im Theater durch-
aus nicht unangebrachten Handlungen liegt der Konflikt
innerlich; er behandelt das Verhältnis zwischen Schöpfer-
kraft und Persönlichkeit. Ein genialer. Komponist
namens Wieland bringt es in seiner Kunst zu keinem
Erfolg. Er wird Klavierlehrer bei einem englischen
Grossindustriellen. Wieland beschäftigt sich mit derr
Fiugproblem. Der Engländer stellt ihm aie Mittel für die
Ausführung seiner Idee zur Verfügung. Wieland will
aus einem berechtigten Egoismus heraus seine Erfindung
fiir sich verwenden. Er entwendet das kostbare Platin
und erzählt dem Engländer, dass er überhaupt nichts
erfunden und die Gelder zur Zahlung seiner Schulden
verbraucht habe. Er kommt ins Gefängnis, wird nach
sechs Monaten begnadigt, auf Fürsprache des Be-
stohlenen, der trotzdem nach wie vor an das Genie
und die Erfindung Wielands glaubt. Nach zwei Jahren
kehrt Wieland unerwartet und gänzlich überraschend in
das Haus des Engländers zurück. Er ist mit seinem
fertiggestellten Flugschiff von Dünkirchen aus über den
Kanal nach England geflogen. Niemand hält es für
möglich, aber die Tatsachen überzeugen. Sofort wird
eine grosse Gesellschat zur Ausnützung der Erfindung
gegründet und Wieland soll vor Tausenden von Zu
schauern über das Meer zurückfliegen. Aber der Mut
verlässt ihn und er erschiesst sich Die seelischen
Motive ergeben sich aus einer Nebenhandlung. Wieland
liebt die Tochter des Engländers, Ethel, eine Art Hilde
Wangei, die ihm ihre Gegenliebe versprach, wenn er
als Sieger durch die Lüfte zu ihr kommen würde. Ihr
gesteht er, dass ihn nur Zufall und Zwang des
Windes über das Meer getrieben hätte. Ihr gesteht er
die Todesängste und die Nervenqualen während der
Fahrt. Ethel sieht ihr Ideal zerfliessen und gleich der
Hilda Wangel will sie ihm den Mut der Tat zu dem
Werk seines Geistes geben. Ihr Wille trotzt der
Vergewaltigung durch Wieland, aber sie lässt sich frei-
willig nehmen, um ihm den Glauben an seine Kraft
zu schaffen. Der Baumeister Solness fällt vom Turm,
den er schon erstiegen hat, und Wieland erschiesst
sich in den Moment, wo die Masse die Abfahrt er-
v/artet. Die Abhängigkeit von Ibsen spricht im streng-
künstlerischen Sinn gegen das Werk, denn Kunst muss
ihren Ursprung in der Persönlichkeit des Schaffenden
haben Vielleicht ist der angedeutete Konflikt des
Dramas auch der Konflikt des Autors. Neben diesen
Haupthandlungen laufen noch eine Zahl romanhafter
Vorgänge, insbesondere die Verbindung der alten
Wielandsage mit den Personen des Märchens. Wenn
sie;auch nicht in unbedingtem, ursächlichem Zusammen-
hang mit dem Konflikt stehen, sie wirken: zum T'eij
dichterisch-lyrisch (man denkt an den Vollmoeller der
Katharina von Armagnac), zum Teil satirisch. So zum
Beispiel die Bemerkung: „Das Ueberfliegen des Kantons
Uri und des Königreichs Preussen ist von den Be-
hörden verboten.“ So die Beleuchtung des Reporter-
tums (was dem Dichter ein Teil der Berliner Presse
besonders übel nimmt): Ein Reporter wagt eine Ein-
wendung gegen den Verleger. „Sie haben nicht zu
denken, Sie sind entlassen.“ — Albert Bassermann
war unübertrefflich. Er und die Else Lehmann und
Os kar Sauer sind die grössten Schauspieler unserer
*Zeit. Bassermann spielte den Wieland in einer Maske
zwischen Beethoven und E. T. A. Hoffmann. Nur eine
grosse Persönlichkeit kann so gestalten, so kunstwahr
gliedern wie dieser Albert Bassermann. Die Regie
Reinhardts belebte die Szene. Er sollte sich auf sein
Talent zur Massenwirkung beschränken, statt mit Bums-
schauspielern wie Ferdinand Bonn durch Europa zu
reisen und auf diese Weise falsche Vorstellungen von
Schauspielkunst zu verbreiten.
Das Buch erschien im Inselverlag Leipzig.
Nicht erlogenes Foyergespräch
„Ich verstehe kein Wort, Herr Kollege.“
„Sie haben es gut, Herr Professor, Ich muss es
verstehen.“
Die Kritik der Presse
Glaube, Abonnent, nicht den Versicherungen deiner
Theaterkritiker. Sie müssen verstehen. Und wenn
das Gehirn auch noch so versagt, in der grossen
Pause, Schmerbauch an Schmerbauch, wird sich alles
zeigen. Man fühlt, man tastet, mann redet und man
versteht. Wehe dem, der auf seinem angestammten
Parkettsitz bleibt. Er ist verlassen, weil er nur auf
sich angewiesen ist Die Masse machts. Der Lokal-
anzeiger verfügt über Köpfe, das kann man wohl sagen;
seine Theatermänner erkennen mit sicherem lnstinkt
die Dichter und verreissen sie. Denn man soll Dichter
nicht aufkommen lassen. Das Theater gehört dea
Dilettanten und den Kollegen. Zwei volle Jahrzehnte
entrüstete sich der Lokalanzeiger über die „fehlende
Handlung.“ Sie charakterisiert nach seiner Ansicht
direkt „damatisches Uebermenschentum“ und „Aestheten-
clique.“ Die Ansicht wird seit dem achten Februar
1911 aufgegeben. Neues Schlagwort: „Moderne Lärm-
dramatik.“ Bei Wildenbruch und Schiller nennen es
die Herren: „sinnfällige Handlung und Natur.“ Ich
habe schon mindestens ebensoviel schlechte Kritiken
gelesen, wie schlechte Stücke gesehen. Das Unglück
entsteht, wenn das leidende Wesen tätig wird. Der
Hirsch wird gejagt, er soll nicht jagen. Und Herr
Hirsch hält den Wieland für einen Schwindler („Die
Schwindler sind in den Dramen der neurasthenischen
Literaturepoche beliebte Helden . . . Frank Wedekind
hat einen Marquis von Keith geschrieben. Wie dieser
letztere [letztere, letztere, Ietzteste] ist Vollmöllers
Held ein kecker Schwindler, wie dieser“). Aber
natürlich hat der Herr Hirsch recht. Nicht nur Wieland,
das Genie und die ganze Kunst ist Schwindel. Denn
sie sind „ausserhalb des Reichs des Wahrscheinlichen.“
Das ist Weltanschauung, dagegen lässt sich nichts ein-
wenden. Aber, sehr geehrter Herr, den Inhalt eines
Dramas wiedererzählen, ist weder Kunst, noch liegt
diese Tätigkeit im Reich des Wahrscheinlichen. Sie
hat nicht einmal etwas mit Weltanschauung zu tun.
Und ich muss feststellen: dieser Hirsch weiss nicht
einmal auf seiner Domäne Bescheid. Vollmoeiler könnte
ihn berichtigen. Er verbreitet erweislich unwahre Tat-
sachen ohne Wahrnehmung berechtigter Interessen.
Denn die liegen doch wohl nur in seiner Welt-
anschauung. Herr Hirsch behauptet: „Meister Wieland
sei in die im Salon des Sir Hubert versammelte Ge-
sellschaft hineingeplatzt und hat ihr vorgeschwindelt, er
sei über den Kanal geflogen, seine Maschine
sei aber in der Nähe auf den Eisenbahn-
schienen verunglückt. Man glaubt ihm schliess-
lich“. „Nein, Herr Hirsch, Wieland ist geflogen.
Es wird im Drama bestätigt durch drei königliche Be-
amte. Mehr kann man nicht verlangen. Und dieser
Kopf, der amtlich bestätigte Tatsachen nicht fassen
kann, beschimpft ausgiebig den Dichter Vollmoeller
und weist der deutschen Literatur der Gegenwart den
Weg. Doch der Dichter - Direktor Schmieden wird
„aufgemuntert“: „Das sympatische Bestreben, die
hübsche Idee vor den Ausschreitungen gewaltsamen
Schwankulkes zu bewahren, versöhnt mit etlichen kon-
ventionellen Liebes- und Eifersuchtsszenen, und auch
an dankbaren Rollen fehlt es nicht“. Er ist versöhnt.
Aber Vollmoeller: „Natürlich meint sein Name Wieland
nicht den lächelnden liebenswürdigen (!) Dichter, sondern
den tückisch boshaften (ol) Wieland, den Schmied.“
Aber Schmieden: „ . . halfen wacker mit, den „er-
lauchten Ahnherrn“ Schmiedens unserm Verständnis
näher zu bringen — — — “
Unserm Verständnis. Unserm, vastehste!
Lustspielhaus
Wieder an einer Stätte der Lebensfreude. Ein
schöner Damenflor, von Herrn Poiret gezüchtet, huldigte
einem beliebt werdeu wollenden Verteidiger-Dichter. Es
war unbeschreiblich schön Kurfürstendamm, ein Kom-
merzienrat, eine Kommerzienrätin mit der Sehnsucht
nach dem K. d. W, ein Kommerzienratstöchterchen
frisch und frei aus Lausanne zurückgekeJirt, ein christ-
licher Anwalt, ein jüdischer Anwalt, ein Justizrat, ein
streberischer Anwalt, ein Staatsanwalt, ein Gerichts-
diener mit Berliner Humor, eine unverheiratete Jungfern-
tante, ein ostpreussisches Dienstmädchen, ein ver-
kommener echter Baron, ein erster Rowdy, ein zweiter
Rowdy, eine Dame der Halbwelt, eine zweite Dame
der Halbwelt (angenehmes Gruseln im Zuschauerraum,
Lebensfreude, auf der Bühne wird ein Changsong ge-
sungen, der Kommerzienrat sagt an der Stelle Chat noir,
siehe Lebensfreude Nummer 38 dieser Zeitschrift). Das
wäre das Stück. Ferner wird telephoniert, die B Z
vorgelesen, Kognak Hennessy Dreistern getrunken, von
Austern wenigstens geredet (Lebenfreude, Lebens-
freude). Sämtliche Witze des Herrn Moszkowski sind
zitiert (in jedem Anwaltswartezimmer liegen alte Jahr-
gänge noch älterer Witzblätter auf, das muss reizen).
Es war ausserordentlich schön. Die Schauspieler ver-
standen es nicht, Herrn Selten „unserem Verständnis
näher zu bringen.“ Näheres ist durch den Autor
selbst zu erfahren, Sprechstunde fünf bis sieben, ausser
Sonnabends.
Trust
Rettungsaktion
Aus dem Tagebuch eines sehr
gewöhnlichen jungen Menschen
Von Thaddaeus Rittner
„Wie alt sind Sie?“ fragte mich heute die Frau
Kassiererin. Und sie schien ganz verwundert, als ich
ihr sagte: Dreiundzwanzig. Ich will nicht untersuchen,
ob sie selbst viel älter ist. Aber sie machte Augen,
als hätte sie bisher nicht gewusst, dass man überhaupt
so jung sein könnte.
Wir sind drei, ausser den Hausleuten. Ich habe
das kleinste Zimmer, aber dafür bewohne ich es allein.
Nebenan ist ein Zimmer mit zwei Fenstern und mit
einem Klavier, auf dem glücklicher Weise niemand spielt.
Im Vorzimmer begegnete ich einen auffallend grossen
Menschen; er stand auf einem Fusse, pfiff etwas Sen-
timentales und putzte sich den linken Stiefel. Da
öffnete sich die Tür vom Speisezimmer und eine
Frauenstimme rief „Konrad!“ Darauf murmelte der
grosse Mensch „gleich“ und wurde verlegen, als er mich
bemerkte. Begann auch aus Verlegenheit ein Gespräch.
Ob ich erst seit gestern hier wohnte. Ja, seit gestern.
Sein Name war Kohler.
lhm gehört das Zimmer nebenan, das mit zwei
Fenstern und mit dem Klavier. Dafür ist er nicht
allein. Er streitet fortwährend mit einem Anderen und
ich höre jedes Wort durch die Wand.
Der andere ist lichtblond, bucklig und etwas nach-
lässig gekleidet. Kohler nennt ihn „Knopf,“ aber viel-
leicht heisst er in Wiiklichkeit anders. Er ist einmal
bescheiden und einmal frech, übrigens sieht er schlecht
aus und spricht so undeutlich, dass man ihn kaum
versteht.
Abends kamen wir alle drei auf der Treppe zu-
sammen.
„KennenSie schon den Kassierer? fragte mich Kohler
„Nein,“ sagte ich.
Darauf lächelte Knopf und flüsterte etwas, was ich
nicht verstand. Aber Kohler scheint es verstanden zu
haben, denn er ärgerte sich über den Buckligen.
„Hören Sie nicht auf ihn!“ sagte er zü mir. Der
Knopf lügt und ist überhaupt boshaft wie ein Affe,
Sie werden schon sehen . . . Der Kassierer ist ein
lieber Mensch, ungemein witzig . . . Und dass er ein
wenig trinkt. . . .
Er seufzte.
„ . . . Mein Gott! . . . Niemand ist fehlerlos.“
Der Grosse hat augenscheiniich viel Sympathie für
den Herrn Kassierer.
Bei Tisch sassen wir in folgender Ordnung: Oben
sie, rechts Kohler, links ich und unten der Bucklige
und der Kassierer.
Wieland von Karl Vollmoeller
Unter Heulen, Johlen und Schlüsselpfeifen eines
entgeistigten Publikums wurde das Märchen „Wieland“
von Karl Vollmoeller im Deutschen Theater zu Berlin
zertreten. Man steht vor einem der vielen Rätsel
menschlicher Gemütserregungen. Ich habe in diesem
Winter unzählige schlechte Stücke gesehen, deutsche
and ausländische, geschrieben von Journalisten, Kritikern
und Konfektionären, arm an Geist und Erfindung,
reich an gestohlenen Einfällen, nur zu dem Zweck
fabriziert, ohne Verdienst zu verdienen. Das Publikum
lärmte nie, benahm sich stets wohlwollend, stillvergnügt
und amüsierte sich. Man gab ihm Geist von seinem
Geiste. Vollmoeller fiel durch, denn er ist ein Dichter.
Er schuf ein Drama, ein Märchen, wie er es nennt,
das gewiss nicht frei von künstlerischen Mängeln ist.
Aber ich glaube nicht an die Sensibilität und das Kunst-
verständnis der kapitalskräftigen Menge, die sich mit der
Eriegung von fünf bis zehn Mark ein Recht auf Kunst-
bewertung erkaufen möchte. Das angeblich literarische
Publikum wehrte sich offenbar gegen das Drama, weil
es den Vorzug hat. interessant zu sein. Es gibt noch
immer Menschen, die die Qualität eines Werkes an
seiner Langweiie und einer Sprache in Jamben ab-
schätzen. Trotz aller äusseren und im Theater durch-
aus nicht unangebrachten Handlungen liegt der Konflikt
innerlich; er behandelt das Verhältnis zwischen Schöpfer-
kraft und Persönlichkeit. Ein genialer. Komponist
namens Wieland bringt es in seiner Kunst zu keinem
Erfolg. Er wird Klavierlehrer bei einem englischen
Grossindustriellen. Wieland beschäftigt sich mit derr
Fiugproblem. Der Engländer stellt ihm aie Mittel für die
Ausführung seiner Idee zur Verfügung. Wieland will
aus einem berechtigten Egoismus heraus seine Erfindung
fiir sich verwenden. Er entwendet das kostbare Platin
und erzählt dem Engländer, dass er überhaupt nichts
erfunden und die Gelder zur Zahlung seiner Schulden
verbraucht habe. Er kommt ins Gefängnis, wird nach
sechs Monaten begnadigt, auf Fürsprache des Be-
stohlenen, der trotzdem nach wie vor an das Genie
und die Erfindung Wielands glaubt. Nach zwei Jahren
kehrt Wieland unerwartet und gänzlich überraschend in
das Haus des Engländers zurück. Er ist mit seinem
fertiggestellten Flugschiff von Dünkirchen aus über den
Kanal nach England geflogen. Niemand hält es für
möglich, aber die Tatsachen überzeugen. Sofort wird
eine grosse Gesellschat zur Ausnützung der Erfindung
gegründet und Wieland soll vor Tausenden von Zu
schauern über das Meer zurückfliegen. Aber der Mut
verlässt ihn und er erschiesst sich Die seelischen
Motive ergeben sich aus einer Nebenhandlung. Wieland
liebt die Tochter des Engländers, Ethel, eine Art Hilde
Wangei, die ihm ihre Gegenliebe versprach, wenn er
als Sieger durch die Lüfte zu ihr kommen würde. Ihr
gesteht er, dass ihn nur Zufall und Zwang des
Windes über das Meer getrieben hätte. Ihr gesteht er
die Todesängste und die Nervenqualen während der
Fahrt. Ethel sieht ihr Ideal zerfliessen und gleich der
Hilda Wangel will sie ihm den Mut der Tat zu dem
Werk seines Geistes geben. Ihr Wille trotzt der
Vergewaltigung durch Wieland, aber sie lässt sich frei-
willig nehmen, um ihm den Glauben an seine Kraft
zu schaffen. Der Baumeister Solness fällt vom Turm,
den er schon erstiegen hat, und Wieland erschiesst
sich in den Moment, wo die Masse die Abfahrt er-
v/artet. Die Abhängigkeit von Ibsen spricht im streng-
künstlerischen Sinn gegen das Werk, denn Kunst muss
ihren Ursprung in der Persönlichkeit des Schaffenden
haben Vielleicht ist der angedeutete Konflikt des
Dramas auch der Konflikt des Autors. Neben diesen
Haupthandlungen laufen noch eine Zahl romanhafter
Vorgänge, insbesondere die Verbindung der alten
Wielandsage mit den Personen des Märchens. Wenn
sie;auch nicht in unbedingtem, ursächlichem Zusammen-
hang mit dem Konflikt stehen, sie wirken: zum T'eij
dichterisch-lyrisch (man denkt an den Vollmoeller der
Katharina von Armagnac), zum Teil satirisch. So zum
Beispiel die Bemerkung: „Das Ueberfliegen des Kantons
Uri und des Königreichs Preussen ist von den Be-
hörden verboten.“ So die Beleuchtung des Reporter-
tums (was dem Dichter ein Teil der Berliner Presse
besonders übel nimmt): Ein Reporter wagt eine Ein-
wendung gegen den Verleger. „Sie haben nicht zu
denken, Sie sind entlassen.“ — Albert Bassermann
war unübertrefflich. Er und die Else Lehmann und
Os kar Sauer sind die grössten Schauspieler unserer
*Zeit. Bassermann spielte den Wieland in einer Maske
zwischen Beethoven und E. T. A. Hoffmann. Nur eine
grosse Persönlichkeit kann so gestalten, so kunstwahr
gliedern wie dieser Albert Bassermann. Die Regie
Reinhardts belebte die Szene. Er sollte sich auf sein
Talent zur Massenwirkung beschränken, statt mit Bums-
schauspielern wie Ferdinand Bonn durch Europa zu
reisen und auf diese Weise falsche Vorstellungen von
Schauspielkunst zu verbreiten.
Das Buch erschien im Inselverlag Leipzig.
Nicht erlogenes Foyergespräch
„Ich verstehe kein Wort, Herr Kollege.“
„Sie haben es gut, Herr Professor, Ich muss es
verstehen.“
Die Kritik der Presse
Glaube, Abonnent, nicht den Versicherungen deiner
Theaterkritiker. Sie müssen verstehen. Und wenn
das Gehirn auch noch so versagt, in der grossen
Pause, Schmerbauch an Schmerbauch, wird sich alles
zeigen. Man fühlt, man tastet, mann redet und man
versteht. Wehe dem, der auf seinem angestammten
Parkettsitz bleibt. Er ist verlassen, weil er nur auf
sich angewiesen ist Die Masse machts. Der Lokal-
anzeiger verfügt über Köpfe, das kann man wohl sagen;
seine Theatermänner erkennen mit sicherem lnstinkt
die Dichter und verreissen sie. Denn man soll Dichter
nicht aufkommen lassen. Das Theater gehört dea
Dilettanten und den Kollegen. Zwei volle Jahrzehnte
entrüstete sich der Lokalanzeiger über die „fehlende
Handlung.“ Sie charakterisiert nach seiner Ansicht
direkt „damatisches Uebermenschentum“ und „Aestheten-
clique.“ Die Ansicht wird seit dem achten Februar
1911 aufgegeben. Neues Schlagwort: „Moderne Lärm-
dramatik.“ Bei Wildenbruch und Schiller nennen es
die Herren: „sinnfällige Handlung und Natur.“ Ich
habe schon mindestens ebensoviel schlechte Kritiken
gelesen, wie schlechte Stücke gesehen. Das Unglück
entsteht, wenn das leidende Wesen tätig wird. Der
Hirsch wird gejagt, er soll nicht jagen. Und Herr
Hirsch hält den Wieland für einen Schwindler („Die
Schwindler sind in den Dramen der neurasthenischen
Literaturepoche beliebte Helden . . . Frank Wedekind
hat einen Marquis von Keith geschrieben. Wie dieser
letztere [letztere, letztere, Ietzteste] ist Vollmöllers
Held ein kecker Schwindler, wie dieser“). Aber
natürlich hat der Herr Hirsch recht. Nicht nur Wieland,
das Genie und die ganze Kunst ist Schwindel. Denn
sie sind „ausserhalb des Reichs des Wahrscheinlichen.“
Das ist Weltanschauung, dagegen lässt sich nichts ein-
wenden. Aber, sehr geehrter Herr, den Inhalt eines
Dramas wiedererzählen, ist weder Kunst, noch liegt
diese Tätigkeit im Reich des Wahrscheinlichen. Sie
hat nicht einmal etwas mit Weltanschauung zu tun.
Und ich muss feststellen: dieser Hirsch weiss nicht
einmal auf seiner Domäne Bescheid. Vollmoeiler könnte
ihn berichtigen. Er verbreitet erweislich unwahre Tat-
sachen ohne Wahrnehmung berechtigter Interessen.
Denn die liegen doch wohl nur in seiner Welt-
anschauung. Herr Hirsch behauptet: „Meister Wieland
sei in die im Salon des Sir Hubert versammelte Ge-
sellschaft hineingeplatzt und hat ihr vorgeschwindelt, er
sei über den Kanal geflogen, seine Maschine
sei aber in der Nähe auf den Eisenbahn-
schienen verunglückt. Man glaubt ihm schliess-
lich“. „Nein, Herr Hirsch, Wieland ist geflogen.
Es wird im Drama bestätigt durch drei königliche Be-
amte. Mehr kann man nicht verlangen. Und dieser
Kopf, der amtlich bestätigte Tatsachen nicht fassen
kann, beschimpft ausgiebig den Dichter Vollmoeller
und weist der deutschen Literatur der Gegenwart den
Weg. Doch der Dichter - Direktor Schmieden wird
„aufgemuntert“: „Das sympatische Bestreben, die
hübsche Idee vor den Ausschreitungen gewaltsamen
Schwankulkes zu bewahren, versöhnt mit etlichen kon-
ventionellen Liebes- und Eifersuchtsszenen, und auch
an dankbaren Rollen fehlt es nicht“. Er ist versöhnt.
Aber Vollmoeller: „Natürlich meint sein Name Wieland
nicht den lächelnden liebenswürdigen (!) Dichter, sondern
den tückisch boshaften (ol) Wieland, den Schmied.“
Aber Schmieden: „ . . halfen wacker mit, den „er-
lauchten Ahnherrn“ Schmiedens unserm Verständnis
näher zu bringen — — — “
Unserm Verständnis. Unserm, vastehste!
Lustspielhaus
Wieder an einer Stätte der Lebensfreude. Ein
schöner Damenflor, von Herrn Poiret gezüchtet, huldigte
einem beliebt werdeu wollenden Verteidiger-Dichter. Es
war unbeschreiblich schön Kurfürstendamm, ein Kom-
merzienrat, eine Kommerzienrätin mit der Sehnsucht
nach dem K. d. W, ein Kommerzienratstöchterchen
frisch und frei aus Lausanne zurückgekeJirt, ein christ-
licher Anwalt, ein jüdischer Anwalt, ein Justizrat, ein
streberischer Anwalt, ein Staatsanwalt, ein Gerichts-
diener mit Berliner Humor, eine unverheiratete Jungfern-
tante, ein ostpreussisches Dienstmädchen, ein ver-
kommener echter Baron, ein erster Rowdy, ein zweiter
Rowdy, eine Dame der Halbwelt, eine zweite Dame
der Halbwelt (angenehmes Gruseln im Zuschauerraum,
Lebensfreude, auf der Bühne wird ein Changsong ge-
sungen, der Kommerzienrat sagt an der Stelle Chat noir,
siehe Lebensfreude Nummer 38 dieser Zeitschrift). Das
wäre das Stück. Ferner wird telephoniert, die B Z
vorgelesen, Kognak Hennessy Dreistern getrunken, von
Austern wenigstens geredet (Lebenfreude, Lebens-
freude). Sämtliche Witze des Herrn Moszkowski sind
zitiert (in jedem Anwaltswartezimmer liegen alte Jahr-
gänge noch älterer Witzblätter auf, das muss reizen).
Es war ausserordentlich schön. Die Schauspieler ver-
standen es nicht, Herrn Selten „unserem Verständnis
näher zu bringen.“ Näheres ist durch den Autor
selbst zu erfahren, Sprechstunde fünf bis sieben, ausser
Sonnabends.
Trust
Rettungsaktion
Aus dem Tagebuch eines sehr
gewöhnlichen jungen Menschen
Von Thaddaeus Rittner
„Wie alt sind Sie?“ fragte mich heute die Frau
Kassiererin. Und sie schien ganz verwundert, als ich
ihr sagte: Dreiundzwanzig. Ich will nicht untersuchen,
ob sie selbst viel älter ist. Aber sie machte Augen,
als hätte sie bisher nicht gewusst, dass man überhaupt
so jung sein könnte.
Wir sind drei, ausser den Hausleuten. Ich habe
das kleinste Zimmer, aber dafür bewohne ich es allein.
Nebenan ist ein Zimmer mit zwei Fenstern und mit
einem Klavier, auf dem glücklicher Weise niemand spielt.
Im Vorzimmer begegnete ich einen auffallend grossen
Menschen; er stand auf einem Fusse, pfiff etwas Sen-
timentales und putzte sich den linken Stiefel. Da
öffnete sich die Tür vom Speisezimmer und eine
Frauenstimme rief „Konrad!“ Darauf murmelte der
grosse Mensch „gleich“ und wurde verlegen, als er mich
bemerkte. Begann auch aus Verlegenheit ein Gespräch.
Ob ich erst seit gestern hier wohnte. Ja, seit gestern.
Sein Name war Kohler.
lhm gehört das Zimmer nebenan, das mit zwei
Fenstern und mit dem Klavier. Dafür ist er nicht
allein. Er streitet fortwährend mit einem Anderen und
ich höre jedes Wort durch die Wand.
Der andere ist lichtblond, bucklig und etwas nach-
lässig gekleidet. Kohler nennt ihn „Knopf,“ aber viel-
leicht heisst er in Wiiklichkeit anders. Er ist einmal
bescheiden und einmal frech, übrigens sieht er schlecht
aus und spricht so undeutlich, dass man ihn kaum
versteht.
Abends kamen wir alle drei auf der Treppe zu-
sammen.
„KennenSie schon den Kassierer? fragte mich Kohler
„Nein,“ sagte ich.
Darauf lächelte Knopf und flüsterte etwas, was ich
nicht verstand. Aber Kohler scheint es verstanden zu
haben, denn er ärgerte sich über den Buckligen.
„Hören Sie nicht auf ihn!“ sagte er zü mir. Der
Knopf lügt und ist überhaupt boshaft wie ein Affe,
Sie werden schon sehen . . . Der Kassierer ist ein
lieber Mensch, ungemein witzig . . . Und dass er ein
wenig trinkt. . . .
Er seufzte.
„ . . . Mein Gott! . . . Niemand ist fehlerlos.“
Der Grosse hat augenscheiniich viel Sympathie für
den Herrn Kassierer.
Bei Tisch sassen wir in folgender Ordnung: Oben
sie, rechts Kohler, links ich und unten der Bucklige
und der Kassierer.