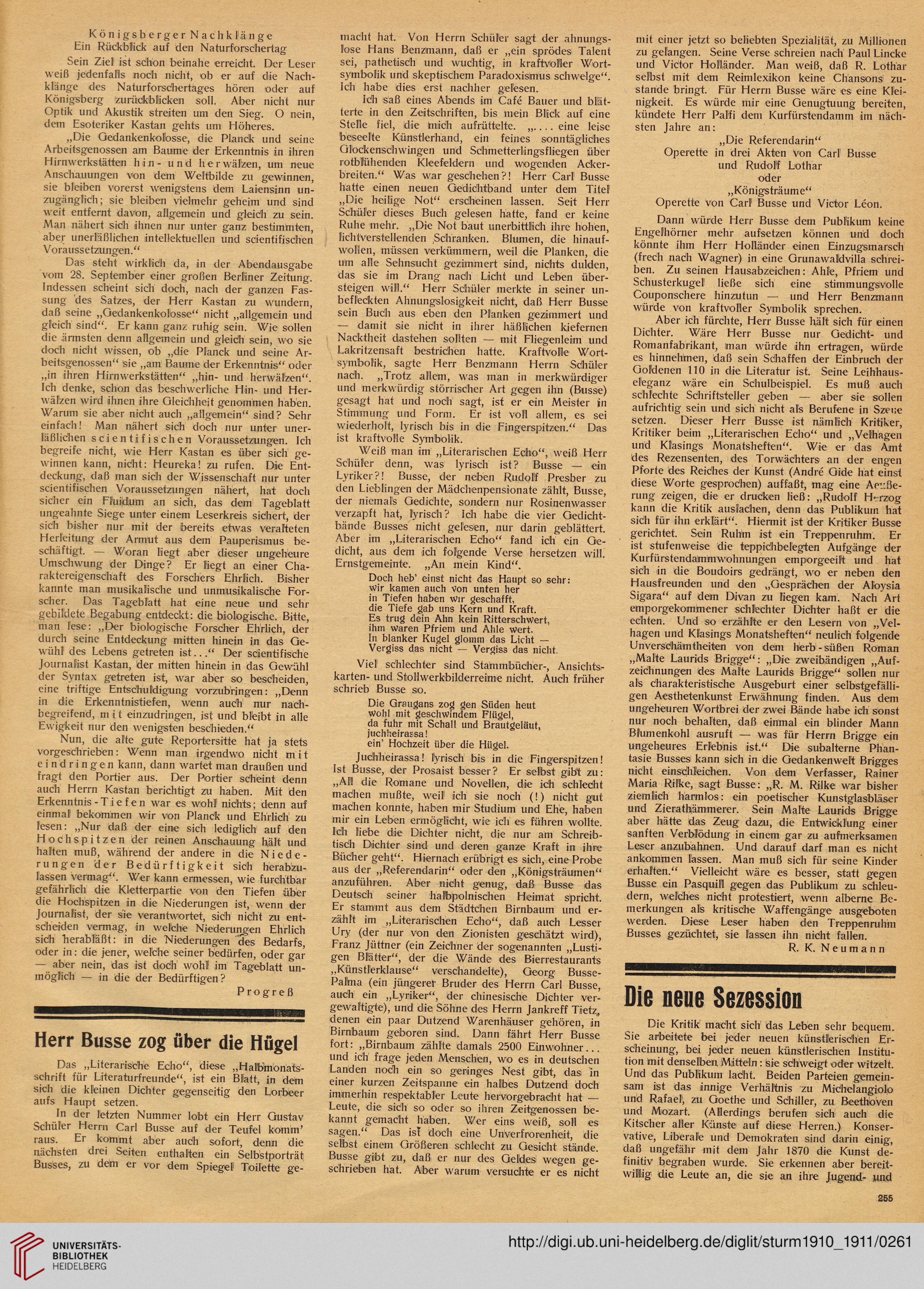K ö n i g s b e r g € r N a c h k l' ä n g e
Ein Rückblick auf den Naturforschertag
Sein Ziei ist sclion beinahe erreicht. Der Leser
weiß jedenfalts nocli micht, ob er auf die Nach-
klänge des Naturforschertages hören oder auf
Königsberg zurückblicken soll. Aber nicht nur
Optik und Akustik streiten um den Sieg. O nein,
dem Esoteriker Kastan gehts um Höheres.
„Die Gedankenkolbsse, die Planck und seine
Arbeitsgenossen am Raume der Erkenntnis in ihren
Hirnwerkstätten hin- und herwäHzen, um neue
AnsChauungen von dem Weltbilde zu gewinnen,
sie bleiben vorerst wenigstens dem Laiensinn un-
zugängfich; sie bleiben vielmehr geheim und sind
weit entfernt davton, aflgemein und gleidi zu sein.
Man nähert sidh ihnen nur unter ganz bestimmtem,
aber unerlläßlichen intellektuellen und scientifischen
V o rau ss e tzu ngein. ‘'‘
Das steht wirklich da, in der Abendausgabe
vom 28. September einer großen Berfiner Zeitung.
Indessen scheint sich doch, nach der ganzen Fas-
sung des Satzes, der Herr Kastan zu wundern,
daß seine „Gedankenkolbsse“ nicht „allgemein und
gleich sind“. Er kann ganz ruhig sein. Wie solten
die ärmsten denn allgemein und gleidh sein, wo sie
dodh nicht wissen, ob „die Planck und seine Ar-
beitsgemossen“ sie „am Baume der Erkenntnis“ oder
„in ihren Hirnwerkstätten“ „hin- und herwäfzen“.
Ich denke, schon das beschwerfiche Hin- und Her-
wäfzen wird ihnen ihre Gleichheit genommen haben.
Warum sie aber nicht auch „allgemein“ sind? Sehr
einfach! Man nähert sich doch nur unter uner-
fäßlichen sdientif ischen Voraussetzungen. Jch
begreife nicht, wie Herr Kastan es über sich ge-
winnen kann, nidht: Heureka! zu rufen. Die Ent-
deckung, daß man sidli der Wissenschaft nur unter
scientifischen Voraussetzungen nähert, hat doch
sicher ein Ffuijdum an sich, das dem Tageblatt
ungeahnte Siege unter einem Leserkreis sidhert, der
sidh bisher nur mit der bereits etwas verafteten
Herleitung der Armut aus dem Pauperismus be-
schäftigt. — Woran fiegt aber dieser ungeheure
Umsdhwung der Dinge? Er liegt an einer Cha-
raktereigensdhäft des Forschers Ehrfich. Bisher
kannte man musikafische und unmiusikalisdhe For-
scher. Das Tageblatt hat eine neue und sehr
gebildete Begabung entdeckt: die biologische. Bitte,
man lese: „Der biologische Forscher Ehrlich, der
durch seine Entdeckung mitten hinein in das Ge-
wühf des Lebens getreten ist...“ Der sdientifische
Journafist Kastan, der mitten hinein in das Gewühl
der Syntax getreten ist, war aber so besdheiden,
eine triftige Entsdhüldigung Vorzubringen: „Denn
in die Erkenntnistiefen, wenn audh nur nach-
begreifend, m i t einzudringen, ist und bleibt in alle
Ewigkeit nur den wenigsten besdhieden.“
Nun, die afte gute Reportersitte hat ja stets
vorgesdhrieben: Wenn man irgendwo nicht m i t
eindringen kann, dann wartet man draußen und
fragt den Portier aus. Der Pörtier scheint denn
audh Herrn Kastan berichtigt zu haben. Mit den
Erkenntnis - T i e f e n war es wohf nidhts; denn auf
einmaf bekommen wir von PlanCk und Ehrlich zu
lesen: „Nur daß der eine sich lediglich auf den
Hochspitzen der reinen Anschauung häft und
haften muß, während der andere in die N i e d e -
rungen der Bedürftigkeit sich herabzu-
lassen vermag“. Wer kann ermessen, wie furchtbar
gefährfich die Kletterpartie von den Tiefen über
die Hochspitzen in die Niederungen ist, wenn der
Journafist, der s'ie verantwortet, sich nicht zu ent-
sdheiden vermag, in weldhe Niederungen Ehrlich
siCh herabfäßt: in die Niederungen des Bedarfs,
oder in: die jener, wefChe seiner bedürfen, oder gar
— aber nein, das ist doch wohll im Tageblatt un-
mögfich — in die der Bedürftigen?
P r o g r e ß
Herr Busse zog über die Hügel
Das „Literarische Echo“, diese „Halbmonats-
schrift für Literaturfreunde“, ist ein Bliatt, in dem
sich die kkinen Dichter gegenseitig den Lorbeer
atifs Haupt setzen.
In der fetzten Nummer lobt ein Herr Gustav
Schüfer Herrn Carl Busse auf der Teufel kotnm’
raus. Er kommt aber auCh sofort, denn die
nächsten drei Seiten enthalten ein Selbstporträt
Busses, zu dem er vor dem Spiegef Toilette ge-
inacht hat. Von Herrn Schüfcr sagt der ahnungs-
fose Hans Benzimann, daß er „ein sprödes Talent
sei, pathetisch und wuchtig, in kraftvofler Wort-
symbofik und skeptischem Paradoxismus sChwelge“.
Ich habe dies erst nachher gefesen.
Ich säß eines Abends im Cafe Bauer und bljät-
terte in den Zeitschriften, bis mein BfiCk auf eine
Steffe fiel, die mich aufrüttelte. „_eine leise
beseefte Künstlerhand, ein feines sonntägtidhes
Gfockenschwingen und Sdhmetterlingsftiegen über
rotbfühenden Kleefeldern und wogenden Acker-
breiten.“ Was war geschehen?! Herr Carf Busse
hatte einen neuen Gedichtband unter dem Titef
„Die heitige Not“ erscheinen fassen. Seit Herr
Schüfer dieses BuCh gelesen hatte, fand er keine
Ruhe tnehr. „Die Not baut unerbittfich ihre hohen,
fichtVersteHenden Schranken. Blumen, die hinauf-
woflen, müssen verkümmern, weil die Planken, die
um alle Sehnsucht gezimmert sind, niChts dulden,
das sie iim Drang nadh Licht und Le'ben über-
steigen wifl.“ Herr Sdhüler merkte in seiner un-
beffeckten Ahnungslosigkeit niCht, daß Herr Busse
sein Budh aus eben den Plänken geziimmert und
— damit sie niCht in ihrer häßfichen kiefernen
Nacktheit dastehen soflten — mit Fliegenleim und
Lakritzensaft bestriChen hatte. Kraftvofle Wort-
symbofik, sagte Herr Benzmann Herrn Schüler
naCh. „Trotz aflem, was man in merkwürdiger
und merkwürdig störrisCher Art gegen ihn (Busse)
gesagt hat und noCh sagt, ist er ein Meister jn
Stimmung und Form. Er ist voll allem, es sei
wiederholt, lyrisch bis in die Fingerspitzen.“ Das
ist kraftvofle Symbblik.
Weiß man im „Literarischen Echo“, weiß Herr
Schülcr denn, was lyrisch ist? Busse — ein
Lyriker?! Busse, der neben Rudoff Presber zu
den Lieblingen der Mädchenpensionate zählt, Busse,
der niemafs Gedichte, sondern nur Rosinenwasser
Verzapft hat, fyrisch? Ich habe die vier Gedicht-
bände Busses nicht gelesen, nur darin geblättert.
Aber im „Literarischen ECho“ fand iCh ein Ge-
dicht, aus dem iCh fofgende Verse hersetzen wilk
Ernstgemeinte. „An mein Kind“.
Doch heb’ einst nicht das Haupt so sehr:
wir kamen auch von unten her
in Tiefen haben Wir geschafft,
die Tiefe gab uns Kern und Kraft.
Es trug dein Ahn kein Ritterschwert,
ihm waren Pfriem und Ahle wert.
In blanker Kugel glomm das Licht —
Vergiss das nicht — Vergiss das nicht.
Vief schlechter sind Stammbücher-, Ansichts-
karten- und Stollwerkbilderreime nicht. AuCh früher
schrieb Busse so.
Die Graugans zog gen Siiden heut
wohl mit geschwindem Flügel,
da fuhr mit Schall und Brautgeläut,
juchheirassa!
ein’ Hochzeit über die Hiigel.
Juühheirassa! lyrisch bis in die Fingerspitzen!
Ist Busse, der Prosaist besser? Er sefbst gibt zu:
„All die Romane und Novellen, die iCh schleCht
madhen mußte, weif iCh sie noch (!) nicht gut
maühen konnte, haben mir Studium und Ehe, haben
mir ein Leben ermögfiCht, wie iüh es führen wollte.
Ich fiebe die Dichter nicht, die nur am Schreib-
tisüh Dichter sind und deren ganze Kraft in ihre
Bücher geht“. Hiernach erübrigt es sich, eine Probe
aus der „Referendarin“ oder den „Königsträumen“
anzuführen. Aber nicht genug, daß Busse das
Deutsüh seiner halbpolnischen Heimat spricht.
Er stammt aus dem StädtChen Birnbaum und er-
zählt im „LiterarisChen Echo“, daß auch Lesser
Ury (der nur von den Zionisten geschätzt wird),
Franz Jüttner (ein ZeiChner der sogenannten „Lusti-
gen Bllätter“, der die Wände des Bierrestaurants
„Künstferklause“ versChandelte), Georg Busse-
Pal'ma (ein jüngeret Bruder des Herrn Carl Busse,
auüh ein „Lyriker“, der chinesische Dichter ver-
gewaftigte), und die Söhne des Herrn Jankreff Tietz,
denein ein paar Dutzend Warenhäuser gehören, in
Birnbaum geboren sind. Dann fährt Herr Busse
fort: „Birnbaum zählte damals 2500 Einwohner...
und iCh frage jeden Menschen, wo es in deutschen
Landen noch ein so geringes Nest gibt, das in
einer kurzen Zeitspanne ein halbes Dutzend doCh
immerhin respektabler Leute herVorgebraCht hat —
Leute, die sich so oder so ihren ZeitgenosSen be-
kannt gemacht haben. Wer eins weiß, soH es
sagen.“ Das ist doch eine Unverfrorenheit, die
sefbst einem Größeren schlecht zu Gesicht stände.
Busse gibt zu, daß er nur des Geldes wegen ge-
schrieben hat. Aber warum versuChte er es nicht
mit einer jetzt so beliebten Spezialität, zu Millionen
zu gefangen. Seine Verse schreien nach Paul Lincke
und Viüt'or HoHänder. Man weiß, daß R. Lothür
sefbst mit dem Reimlexikon keine Chansons 1 zu-
stande bringt. Für Herrn Busse wäre es eine Klei-
nigkeit. Es würde inir eine Genugtuung bereiten,
kündete Herr Palfi dem Kurfürstendamm im näch-
stcn Jahre an:
„Die Referendarin“
Operette in drei Akten Von Carl' Busse
und Rudoff Lothar
oder
„Königsträume“
Operette von Carf Busse und Victor Lcon.
Dann würde Iierr Busse dem Pubfikum keine
Engelhörner inehr aufsetzen können und doch
könnte ihm Herr Holländer einen Einzugsmarsch
(frech naCh Wagner) in eine Grunawaldvilla sChrei-
ben. Zu seinen Hausabzeichen: Ahle, Pfriem und
Schusterkugef ließe sich eine stimmungsVOlle
Couponschere hinzutun — und Herr Benzmann
würde von kraftvofler Symbolik sprechen.
Aber ich fürchte, Herr Busse hält sich für einen
Dichter. Wäre Herr Busse nur Gedicht- und
Romanfabrikant, iman würde ihn ertragen, würde
es hinnehmen, daß sein Sdhaffen der Einbruch der
Goldenen 110 in die Literatur ist. Seine Leihhaus-
eleganz wäre ein Schulbeispiel. Es muß aucli
schfechte Schriftsteller geben — aber sie sollen
aufrichtig sein und sich nicht als Berufene in Szetie
setzen. Dieser H-err Busse ist nämfich Kritiker,
Kritiker beim „Literarischen Echo“ und „Velhägen
und Kfasings Monatsheften“. Wie er das Amt
des Rezensenten, des Torwächters an der engeii
Pforte des Reiches der Kunst (Andre Gide hat einst
diese Worte gesproChen) auffaßt, mag eine Aer.ße-
rung zeigen, die er drucken ließ: „Rudolf H- rzog
kann die Kritik ausläChen, denn das Publikum hat
sic'h für ihn erkfärt“. Hiermit ist der Kritiker Busse
geriChtet. Sein Ruhm ist ein Treppenruhm. Er
ist stufenweise die teppiChbefegten Aufgänge der
Kurfürstendammwohnungen emporgeeilt und hat
sic'h in die Boudoirs gedrängt, wo er neben den
Hausfreunden und den „Gesprächen der Afoysia
Sigara“ auf de'm Divan zu fiegen kam. Nach Art
emporgekommener schfechter Didhter haßt er die
eühten. Und so erzählte er den Lesern von „Vel-
hagen und Kfasings Monatsheften“ neulich folgende
UnVersChämtheiten von deim herb-süßen Roman
„Malte Laurids Brigge“: „Die zweibändigen „Auf-
zeiChnungen des Mafte Laurids Brigge“ sollen nur
als charakteristische Ausgeburt einer selbstgefälli-
gen Aesthetenkunst Erwähnung finden. Aus dem
ungeheuren Wortbrei der zwei Rände habe ich sbnst
nur noch behaften, daß einmal ein blinder Mann
Blumenkohl ausruft — was für Herrn Brigge ein
ungeheures Erlebnis ist.“ Die subalterne Phan-
tasie Bussesi kann sich in die Gedankenweft Brigges
nicht einschfeichen. Von dem Verfasser, Rainer
Maria Rilke, sagt Busse: „R. M. Rilke war bisher
ziemliCh harmlos: ein poetischer Kunstglasbläser
und Zierathämmerer. Sein Malte Laurids Brigge
aber hätte das Zeug dazu, die Entwickfung einer
sanften Verbfödung in einem gar zu aufmerksamen
Leser anzubahnen. Und darauf darf man es nicht
ankommen lässen. Man muß sich für seine Kinder
erhaften.“ Vielleicht wäre es besser, statt gegen
Busse ein Pasquill gegen das Publikum zu sChleu-
dern, wefches niüht protestiert, wenn aiberne Be-
inerkungen als kritische Waffengänge ausgeboten
werden. Diese Leser haben den Treppenruhin
Busses gezüchtet, sie fassen ihn nicht fallen.
R. K. Neumann
Die nene Sezession
Die Kritik maüht sich' das Leben sehr bequem.
Sie arbeitete bei jcder neuen künstferisChen Er-
süheinung, bei jeder neuen künstlerischen Institu-
tion mit densefben Mitteln: Isie sChweigt oder witzelt.
Und das Pubfikum laüht. Beiden Partejen gemein-
sam ist das innige Verhältnis zu MiChelangiolp
und Rafaef, zti Goethe und Sdhiller, zu BeethöVen
und Mozart. (Aflerdings berufen sich auch die
Kitscher alfer Künste auf diese Herren.) Konser-
vative, Liberale und Demokraten sind darin einig,
daß ungefähr mit dem Jahr 1870 die Kunst de-
finitiv begraben wurde. Sie erkennen aber bereit-
willig diie Leute an, die sie an ihre Jugend- und
255
Ein Rückblick auf den Naturforschertag
Sein Ziei ist sclion beinahe erreicht. Der Leser
weiß jedenfalts nocli micht, ob er auf die Nach-
klänge des Naturforschertages hören oder auf
Königsberg zurückblicken soll. Aber nicht nur
Optik und Akustik streiten um den Sieg. O nein,
dem Esoteriker Kastan gehts um Höheres.
„Die Gedankenkolbsse, die Planck und seine
Arbeitsgenossen am Raume der Erkenntnis in ihren
Hirnwerkstätten hin- und herwäHzen, um neue
AnsChauungen von dem Weltbilde zu gewinnen,
sie bleiben vorerst wenigstens dem Laiensinn un-
zugängfich; sie bleiben vielmehr geheim und sind
weit entfernt davton, aflgemein und gleidi zu sein.
Man nähert sidh ihnen nur unter ganz bestimmtem,
aber unerlläßlichen intellektuellen und scientifischen
V o rau ss e tzu ngein. ‘'‘
Das steht wirklich da, in der Abendausgabe
vom 28. September einer großen Berfiner Zeitung.
Indessen scheint sich doch, nach der ganzen Fas-
sung des Satzes, der Herr Kastan zu wundern,
daß seine „Gedankenkolbsse“ nicht „allgemein und
gleich sind“. Er kann ganz ruhig sein. Wie solten
die ärmsten denn allgemein und gleidh sein, wo sie
dodh nicht wissen, ob „die Planck und seine Ar-
beitsgemossen“ sie „am Baume der Erkenntnis“ oder
„in ihren Hirnwerkstätten“ „hin- und herwäfzen“.
Ich denke, schon das beschwerfiche Hin- und Her-
wäfzen wird ihnen ihre Gleichheit genommen haben.
Warum sie aber nicht auch „allgemein“ sind? Sehr
einfach! Man nähert sich doch nur unter uner-
fäßlichen sdientif ischen Voraussetzungen. Jch
begreife nicht, wie Herr Kastan es über sich ge-
winnen kann, nidht: Heureka! zu rufen. Die Ent-
deckung, daß man sidli der Wissenschaft nur unter
scientifischen Voraussetzungen nähert, hat doch
sicher ein Ffuijdum an sich, das dem Tageblatt
ungeahnte Siege unter einem Leserkreis sidhert, der
sidh bisher nur mit der bereits etwas verafteten
Herleitung der Armut aus dem Pauperismus be-
schäftigt. — Woran fiegt aber dieser ungeheure
Umsdhwung der Dinge? Er liegt an einer Cha-
raktereigensdhäft des Forschers Ehrfich. Bisher
kannte man musikafische und unmiusikalisdhe For-
scher. Das Tageblatt hat eine neue und sehr
gebildete Begabung entdeckt: die biologische. Bitte,
man lese: „Der biologische Forscher Ehrlich, der
durch seine Entdeckung mitten hinein in das Ge-
wühf des Lebens getreten ist...“ Der sdientifische
Journafist Kastan, der mitten hinein in das Gewühl
der Syntax getreten ist, war aber so besdheiden,
eine triftige Entsdhüldigung Vorzubringen: „Denn
in die Erkenntnistiefen, wenn audh nur nach-
begreifend, m i t einzudringen, ist und bleibt in alle
Ewigkeit nur den wenigsten besdhieden.“
Nun, die afte gute Reportersitte hat ja stets
vorgesdhrieben: Wenn man irgendwo nicht m i t
eindringen kann, dann wartet man draußen und
fragt den Portier aus. Der Pörtier scheint denn
audh Herrn Kastan berichtigt zu haben. Mit den
Erkenntnis - T i e f e n war es wohf nidhts; denn auf
einmaf bekommen wir von PlanCk und Ehrlich zu
lesen: „Nur daß der eine sich lediglich auf den
Hochspitzen der reinen Anschauung häft und
haften muß, während der andere in die N i e d e -
rungen der Bedürftigkeit sich herabzu-
lassen vermag“. Wer kann ermessen, wie furchtbar
gefährfich die Kletterpartie von den Tiefen über
die Hochspitzen in die Niederungen ist, wenn der
Journafist, der s'ie verantwortet, sich nicht zu ent-
sdheiden vermag, in weldhe Niederungen Ehrlich
siCh herabfäßt: in die Niederungen des Bedarfs,
oder in: die jener, wefChe seiner bedürfen, oder gar
— aber nein, das ist doch wohll im Tageblatt un-
mögfich — in die der Bedürftigen?
P r o g r e ß
Herr Busse zog über die Hügel
Das „Literarische Echo“, diese „Halbmonats-
schrift für Literaturfreunde“, ist ein Bliatt, in dem
sich die kkinen Dichter gegenseitig den Lorbeer
atifs Haupt setzen.
In der fetzten Nummer lobt ein Herr Gustav
Schüfer Herrn Carl Busse auf der Teufel kotnm’
raus. Er kommt aber auCh sofort, denn die
nächsten drei Seiten enthalten ein Selbstporträt
Busses, zu dem er vor dem Spiegef Toilette ge-
inacht hat. Von Herrn Schüfcr sagt der ahnungs-
fose Hans Benzimann, daß er „ein sprödes Talent
sei, pathetisch und wuchtig, in kraftvofler Wort-
symbofik und skeptischem Paradoxismus sChwelge“.
Ich habe dies erst nachher gefesen.
Ich säß eines Abends im Cafe Bauer und bljät-
terte in den Zeitschriften, bis mein BfiCk auf eine
Steffe fiel, die mich aufrüttelte. „_eine leise
beseefte Künstlerhand, ein feines sonntägtidhes
Gfockenschwingen und Sdhmetterlingsftiegen über
rotbfühenden Kleefeldern und wogenden Acker-
breiten.“ Was war geschehen?! Herr Carf Busse
hatte einen neuen Gedichtband unter dem Titef
„Die heitige Not“ erscheinen fassen. Seit Herr
Schüfer dieses BuCh gelesen hatte, fand er keine
Ruhe tnehr. „Die Not baut unerbittfich ihre hohen,
fichtVersteHenden Schranken. Blumen, die hinauf-
woflen, müssen verkümmern, weil die Planken, die
um alle Sehnsucht gezimmert sind, niChts dulden,
das sie iim Drang nadh Licht und Le'ben über-
steigen wifl.“ Herr Sdhüler merkte in seiner un-
beffeckten Ahnungslosigkeit niCht, daß Herr Busse
sein Budh aus eben den Plänken geziimmert und
— damit sie niCht in ihrer häßfichen kiefernen
Nacktheit dastehen soflten — mit Fliegenleim und
Lakritzensaft bestriChen hatte. Kraftvofle Wort-
symbofik, sagte Herr Benzmann Herrn Schüler
naCh. „Trotz aflem, was man in merkwürdiger
und merkwürdig störrisCher Art gegen ihn (Busse)
gesagt hat und noCh sagt, ist er ein Meister jn
Stimmung und Form. Er ist voll allem, es sei
wiederholt, lyrisch bis in die Fingerspitzen.“ Das
ist kraftvofle Symbblik.
Weiß man im „Literarischen Echo“, weiß Herr
Schülcr denn, was lyrisch ist? Busse — ein
Lyriker?! Busse, der neben Rudoff Presber zu
den Lieblingen der Mädchenpensionate zählt, Busse,
der niemafs Gedichte, sondern nur Rosinenwasser
Verzapft hat, fyrisch? Ich habe die vier Gedicht-
bände Busses nicht gelesen, nur darin geblättert.
Aber im „Literarischen ECho“ fand iCh ein Ge-
dicht, aus dem iCh fofgende Verse hersetzen wilk
Ernstgemeinte. „An mein Kind“.
Doch heb’ einst nicht das Haupt so sehr:
wir kamen auch von unten her
in Tiefen haben Wir geschafft,
die Tiefe gab uns Kern und Kraft.
Es trug dein Ahn kein Ritterschwert,
ihm waren Pfriem und Ahle wert.
In blanker Kugel glomm das Licht —
Vergiss das nicht — Vergiss das nicht.
Vief schlechter sind Stammbücher-, Ansichts-
karten- und Stollwerkbilderreime nicht. AuCh früher
schrieb Busse so.
Die Graugans zog gen Siiden heut
wohl mit geschwindem Flügel,
da fuhr mit Schall und Brautgeläut,
juchheirassa!
ein’ Hochzeit über die Hiigel.
Juühheirassa! lyrisch bis in die Fingerspitzen!
Ist Busse, der Prosaist besser? Er sefbst gibt zu:
„All die Romane und Novellen, die iCh schleCht
madhen mußte, weif iCh sie noch (!) nicht gut
maühen konnte, haben mir Studium und Ehe, haben
mir ein Leben ermögfiCht, wie iüh es führen wollte.
Ich fiebe die Dichter nicht, die nur am Schreib-
tisüh Dichter sind und deren ganze Kraft in ihre
Bücher geht“. Hiernach erübrigt es sich, eine Probe
aus der „Referendarin“ oder den „Königsträumen“
anzuführen. Aber nicht genug, daß Busse das
Deutsüh seiner halbpolnischen Heimat spricht.
Er stammt aus dem StädtChen Birnbaum und er-
zählt im „LiterarisChen Echo“, daß auch Lesser
Ury (der nur von den Zionisten geschätzt wird),
Franz Jüttner (ein ZeiChner der sogenannten „Lusti-
gen Bllätter“, der die Wände des Bierrestaurants
„Künstferklause“ versChandelte), Georg Busse-
Pal'ma (ein jüngeret Bruder des Herrn Carl Busse,
auüh ein „Lyriker“, der chinesische Dichter ver-
gewaftigte), und die Söhne des Herrn Jankreff Tietz,
denein ein paar Dutzend Warenhäuser gehören, in
Birnbaum geboren sind. Dann fährt Herr Busse
fort: „Birnbaum zählte damals 2500 Einwohner...
und iCh frage jeden Menschen, wo es in deutschen
Landen noch ein so geringes Nest gibt, das in
einer kurzen Zeitspanne ein halbes Dutzend doCh
immerhin respektabler Leute herVorgebraCht hat —
Leute, die sich so oder so ihren ZeitgenosSen be-
kannt gemacht haben. Wer eins weiß, soH es
sagen.“ Das ist doch eine Unverfrorenheit, die
sefbst einem Größeren schlecht zu Gesicht stände.
Busse gibt zu, daß er nur des Geldes wegen ge-
schrieben hat. Aber warum versuChte er es nicht
mit einer jetzt so beliebten Spezialität, zu Millionen
zu gefangen. Seine Verse schreien nach Paul Lincke
und Viüt'or HoHänder. Man weiß, daß R. Lothür
sefbst mit dem Reimlexikon keine Chansons 1 zu-
stande bringt. Für Herrn Busse wäre es eine Klei-
nigkeit. Es würde inir eine Genugtuung bereiten,
kündete Herr Palfi dem Kurfürstendamm im näch-
stcn Jahre an:
„Die Referendarin“
Operette in drei Akten Von Carl' Busse
und Rudoff Lothar
oder
„Königsträume“
Operette von Carf Busse und Victor Lcon.
Dann würde Iierr Busse dem Pubfikum keine
Engelhörner inehr aufsetzen können und doch
könnte ihm Herr Holländer einen Einzugsmarsch
(frech naCh Wagner) in eine Grunawaldvilla sChrei-
ben. Zu seinen Hausabzeichen: Ahle, Pfriem und
Schusterkugef ließe sich eine stimmungsVOlle
Couponschere hinzutun — und Herr Benzmann
würde von kraftvofler Symbolik sprechen.
Aber ich fürchte, Herr Busse hält sich für einen
Dichter. Wäre Herr Busse nur Gedicht- und
Romanfabrikant, iman würde ihn ertragen, würde
es hinnehmen, daß sein Sdhaffen der Einbruch der
Goldenen 110 in die Literatur ist. Seine Leihhaus-
eleganz wäre ein Schulbeispiel. Es muß aucli
schfechte Schriftsteller geben — aber sie sollen
aufrichtig sein und sich nicht als Berufene in Szetie
setzen. Dieser H-err Busse ist nämfich Kritiker,
Kritiker beim „Literarischen Echo“ und „Velhägen
und Kfasings Monatsheften“. Wie er das Amt
des Rezensenten, des Torwächters an der engeii
Pforte des Reiches der Kunst (Andre Gide hat einst
diese Worte gesproChen) auffaßt, mag eine Aer.ße-
rung zeigen, die er drucken ließ: „Rudolf H- rzog
kann die Kritik ausläChen, denn das Publikum hat
sic'h für ihn erkfärt“. Hiermit ist der Kritiker Busse
geriChtet. Sein Ruhm ist ein Treppenruhm. Er
ist stufenweise die teppiChbefegten Aufgänge der
Kurfürstendammwohnungen emporgeeilt und hat
sic'h in die Boudoirs gedrängt, wo er neben den
Hausfreunden und den „Gesprächen der Afoysia
Sigara“ auf de'm Divan zu fiegen kam. Nach Art
emporgekommener schfechter Didhter haßt er die
eühten. Und so erzählte er den Lesern von „Vel-
hagen und Kfasings Monatsheften“ neulich folgende
UnVersChämtheiten von deim herb-süßen Roman
„Malte Laurids Brigge“: „Die zweibändigen „Auf-
zeiChnungen des Mafte Laurids Brigge“ sollen nur
als charakteristische Ausgeburt einer selbstgefälli-
gen Aesthetenkunst Erwähnung finden. Aus dem
ungeheuren Wortbrei der zwei Rände habe ich sbnst
nur noch behaften, daß einmal ein blinder Mann
Blumenkohl ausruft — was für Herrn Brigge ein
ungeheures Erlebnis ist.“ Die subalterne Phan-
tasie Bussesi kann sich in die Gedankenweft Brigges
nicht einschfeichen. Von dem Verfasser, Rainer
Maria Rilke, sagt Busse: „R. M. Rilke war bisher
ziemliCh harmlos: ein poetischer Kunstglasbläser
und Zierathämmerer. Sein Malte Laurids Brigge
aber hätte das Zeug dazu, die Entwickfung einer
sanften Verbfödung in einem gar zu aufmerksamen
Leser anzubahnen. Und darauf darf man es nicht
ankommen lässen. Man muß sich für seine Kinder
erhaften.“ Vielleicht wäre es besser, statt gegen
Busse ein Pasquill gegen das Publikum zu sChleu-
dern, wefches niüht protestiert, wenn aiberne Be-
inerkungen als kritische Waffengänge ausgeboten
werden. Diese Leser haben den Treppenruhin
Busses gezüchtet, sie fassen ihn nicht fallen.
R. K. Neumann
Die nene Sezession
Die Kritik maüht sich' das Leben sehr bequem.
Sie arbeitete bei jcder neuen künstferisChen Er-
süheinung, bei jeder neuen künstlerischen Institu-
tion mit densefben Mitteln: Isie sChweigt oder witzelt.
Und das Pubfikum laüht. Beiden Partejen gemein-
sam ist das innige Verhältnis zu MiChelangiolp
und Rafaef, zti Goethe und Sdhiller, zu BeethöVen
und Mozart. (Aflerdings berufen sich auch die
Kitscher alfer Künste auf diese Herren.) Konser-
vative, Liberale und Demokraten sind darin einig,
daß ungefähr mit dem Jahr 1870 die Kunst de-
finitiv begraben wurde. Sie erkennen aber bereit-
willig diie Leute an, die sie an ihre Jugend- und
255