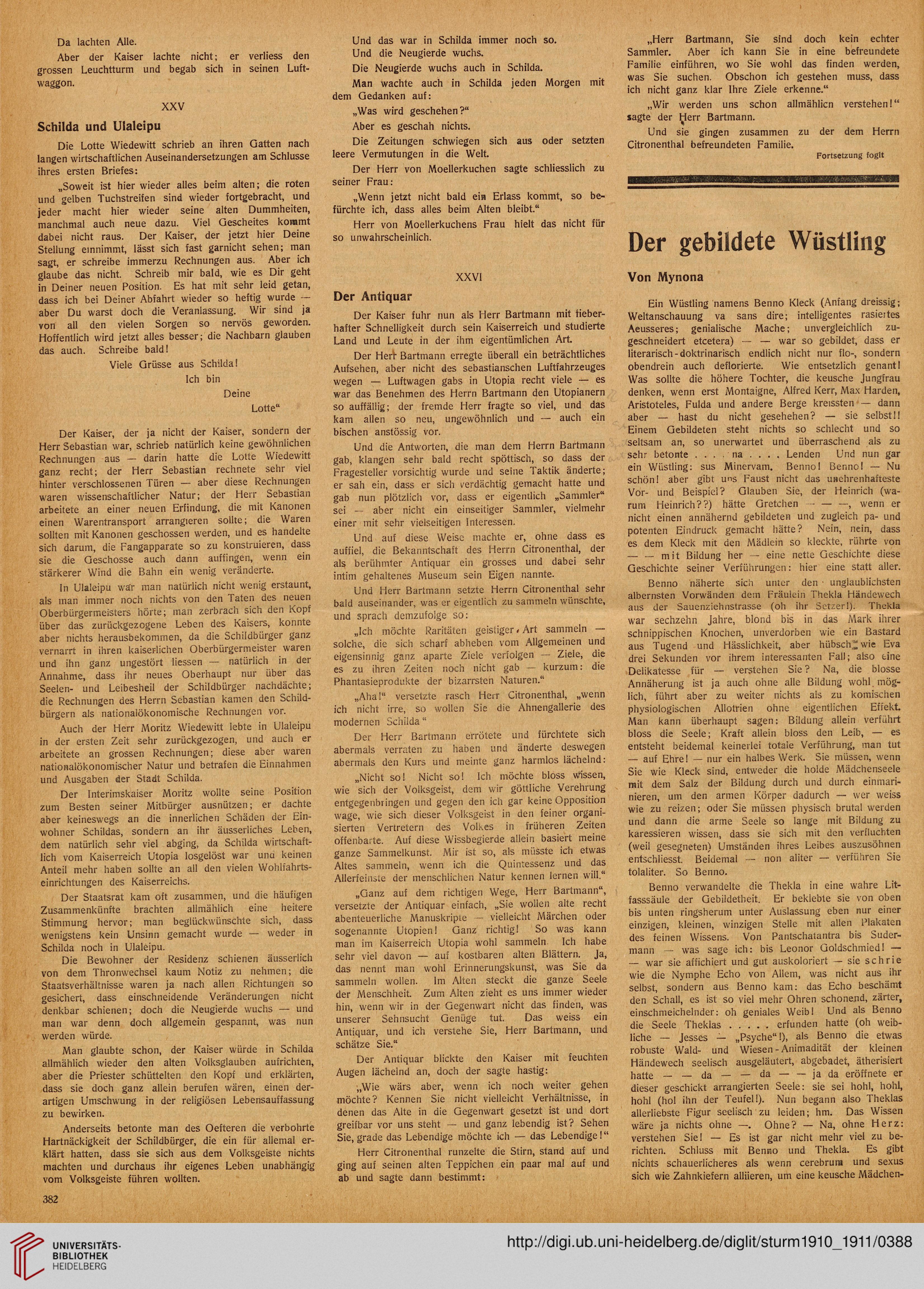Da lachten Alle.
Aber der Kaiser lachte nicht; er verliess den
grossen Leuchtturm und begab sich in seinen Luft-
waggon.
XXV
Schilda und Ulaleipu
Die Lotte Wiedewitt schrieb an ihren Gatten nach
langen wirtschaftlichen Auseinandersetzungen am Schlusse
ihres ersten Briefes:
„Soweit ist hier wieder alles beim alten; die roten
und gelben Tuchstreifen sind wieder fortgebracht, und
jeder macht hier wieder seine alten Dummheiten,
manchmal auch neue dazu. Viel Gescheites kommt
dabei nicht raus. Der Kaiser, der jetzt hier Deine
Stellung einnimmt, Iässt sich fast garnicht sehen; man
sagt, er schreibe immerzu Rechnungen aus. Aber ich
glaube das nicht. Schreib mir bald, wie es Dir geht
in Deiner neuen Position. Es hat mit sehr leid getan,
dass ich bei Deiner Abfahrt wieder so heftig wurde —
aber Du warst doch die Veranlassung. Wir sind ja
von all den vielen Sorgen so nervös geworden.
Hoffentlich wird jetzt alles besser; die Nachbarn glauben
das auch. Schreibe bald!
Viele Grüsse aus Schilda!
Ich bin
Deine
Lotte“
Der Kaiser, der ja nicht der Kaiser, sondern der
Herr Sebastian war, schrieb natürlich keine gewöhnlichen
Rechnungen aus — darin hatte die Lotte Wiedewitt
ganz recht; der Herr Sebastian rechnete sehr viel
hinter verschlossenen Türen — aber diese Rechnungen
waren wissenschaftlicher Natur; der Herr Sebastian
arbeitete an einer neuen Erfindung, die mit Kanonen
einen Warentransport arrangieren sollte; die Waren
sollten mit Kanonen geschossen werden, und es handelte
sich darum, die Fangapparate so zu konstruieren, dass
sie die Geschosse auch dann auffingen, wenn ein
stärkerer Wind die Bahn ein wenig veränderte.
In Ulaleipu wa'r man natüriich nicht wenig erstaunt,
als man immer noch nichts von den Taten des neuen
Oberbürgermeisters hörte; man zerbrach sich den Kopf
über das zurückgezogene Leben des Kaisers, konnte
aber nichts herausbekommen, da die Schildbürger ganz
vernarrt in ihren kaiserlichen Oberbürgermeister waren
und ihn ganz ungestört liessen — natürlich in der
Annahme, dass ihr neues Oberhaupt nur über das
Seelen- und Leibesheil der Schildbürger nachdächte;
die Rechnungen des Herrn Sebastian kamen den Schild-
bürgern als nationalökonomische Rechnungen vor.
Auch der Herr Moritz Wiedewitt lebte in Ulaleipu
in der ersten Zeit sehr zurückgezogen, und auch er
arbeitete an grossen Rechnungen; diese aber waren
nationalökonomischer Natur und betrafen die Einnahmen
und Ausgaben der Stadt Schilda.
Der Interimskaiser Moritz wollte seine Position
zum Besten seiner Mitbürger ausnützen; er dachte
aber keineswegs an die innerlichen Schäden der Ein-
wohner Schildas, sondern an ihr äusserliches Leben,
dem natürlich sehr viel abging, da Schilda wirtschaft-
lich vom Kaiserreich Utopia losgelöst war una keinen
Anteil mehr haben sollte an all den vielen Wohlfahrts-
einrichtungen des Kaiserreichs.
Der Staatsrat kam oft zusammen, und die häufigen
Zusammenkünfte brachten allmählich eine heitere
Stimmung hervor; man beglückwünschte sich, dass
wenigstens kein Unsinn gemacht wurde — weder in
Schilda noch in Ulaleipu.
Die Bewohner der Residenz schienen äusserlich
von dem Thronwechsel kaum Notiz zu nehmen; die
Staatsverhältnisse waren ja nach allen Richtungeh so
gesichert, dass einschneidende Veränderungen nicht
denkbar schienen; doch die Neugierde wuchs — und
man war denn doch allgemein gespannt, was nun
werden würde.
Man glaubte schon, der Kaiser würde in Schilda
allmählich wieder den alten Volksglauben aufrichten,
aber die Priester schüttelten den Kopf und erklärten,
dass sie doch ganz allein berufen wären, einen der-
artigen Umschwung in der religiösen Lebensauffassung
zu bewirken.
Anderseits betonte man des Oefteren die verbohrte
Hartnäckigkeit der Schildbürger, die ein für allemal er-
klärt hatten, dass sie sich aus dem Volksgeiste nichts
machten und durchaus ihr eigenes Leben unabhängig
vom Volksgeiste führen wollten.
Und das war in Schilda immer noch so.
Und die Neugierde wuchs.
Die Neugierde wuchs auch in Schilda.
Man wachte auch in Schilda jeden Morgen mit
dem Gedanken auf:
„Was wird geschehen?“
Aber es geschah nichts.
Die Zeitungen schwiegen sich aus oder setzten
leere Vermutungen in die Welt.
Der Herr von Moellerkuchen sagte schliesslich zu
seiner Frau:
„Wenn jetzt nicht bald ein Erlass kommt, so be-
fürchte ich, dass alles beim Alten bleibt.“
Herr von Moellerkuchens Frau hielt das nicht für
so unwahrscheinlich.
XXVI
Der Antiquar
Der Kaiser fuhr nun als Herr Bartmann mit fieber-
hafter Schnelligkeit durch sein Kaiserreich und studierte
Land und Leute in der ihm eigentümlichen Art.
Der Herf Bartmann erregte überall ein beträchtliches
Aufsehen, aber nicht des sebastianschen Luftfahrzeuges
wegen — Luftwagen gabs in Utopia recht viele — es
war das Benehmen des Herrn Bartmann den Utopianern
so auffällig; der fremde Herr fragte so viel, und das
kam allen so neu, ungewöhnlich und — auch ein
bischen anstössig vor.
Und die Antworten, die man dem Herrn Bartmann
gab, klangen sehr bald recht spöttisch, so dass der
Fragestelier vorsichtig wurde und seine Taktik änderte;
er sah ein, dass er sich verdächtig gemacht hatte und
gab nun plötzlich vor, dass er eigentlich „Sammler“
sei — aber nicht ein einseitiger Sammler, vielmehr
einer mit sehr vielseitigen Interessen.
Und auf diese Weise machte er, ohne dass es
auffiel, die Bekanntschaft des Herrn Citronenthal, der
als berühmter Antiquar ein grosses und dabei sehr
intim gehaltenes Museuin sein Eigen nannte.
Und Herr Bartmann setzte Herrn Citronenthal sehr
bald auseinander, was er eigentlich zu sammeln wünschte,
und sprach demzufolge so;
„Ich möchte Raritäten geistiger < Art sammeln —
solche, die sich scharf abheben vom Allgemeinen und
eigensinnig ganz aparte Ziele verfoigen — Ziele, die
es zu ihren Zeiten noch nicht gab — kurzum: die
Phantasieprodukte der bizarrsten Naturen.“
„Aha!“ versetzte rasch Herr Citronenthal, „wenn
ich nicht irre, so wollen Sie die Ahnengallerie des
modernen Schilda“
Der Herr Bartmann errötete und fürchtete sich
abermals verraten zu haben und änderte deswegen
abermals den Kurs und meinte ganz harmlos lächelnd:
„Nicht so! Nicht so! Ich möchte bloss wissen,
wie sich der Voiksgeist, dem wir göttliche Verehrung
entgegenbringen und gegen den ich gar keine Opposition
wage, wie sich dieser Volksgeist in den feiner organi-
sierten Vertretern des Volkes in früheren Zeiten
offenbarte. Auf diese Wissbegierde allein basiert meine
ganze Sammelkunst. Mir ist so, als müsste ich etwas
Altes sammeln, wenn ich die Quintessenz und das
Allerfeinste der menschlichen Natur kennen lernen will,“
„Ganz auf dem richtigen Wege, Herr Bartmann“,
versetzte der Antiquar einfach, „Sie wolien alte recht
abenteuerliche Manuskripte — vielleicht Märchen oder
sogenannte Utopien! Ganz richtigl So was kann
man im Kaiserreich Utopia wohl sammeln Ich habe
sehr viel davon — auf kostbaren alten Blättern. Ja,
das nennt man wohl Erinnerungskunst, was Sie da
sammeln wollen. Im Alten steckt die ganze Seele
der Menschheit. Zum Alten zieht es uns immer wieder
hin, wenn wir in der Gegenwart nicht das finden, was
unserer Sehnsucht Genüge tut. Das weiss ein
Antiquar, und ich verstehe Sie, Herr Bartmann, und
schätze Sie.“
Der Antiquar blickte den Kaiser mit feuchten
Augen lächelnd an, doch der sagte hastig:
„Wie wärs aber, wenn ich noch weiter gehen
möchte? Kennen Sie nicht vielleicht Verhältnisse, in
denen das Alte in die Gegenwart gesetzt ist und dort
greifbar vor uns steht — und ganz lebendig ist? Sehen
Sie, grade das Lebendige möchte ich — das Lebendigel“
Herr Citronenthal runzelte die Stirn, stand auf und
ging auf seinen alten Teppichen ein paar mal auf und
ab und sagte dann bestimmt:
„Herr ßartmann, Sie sind doch kein echter
Sammler. Aber ich kann Sie in eine befreundete
Familie einführen, wo Sie wohl das finden werden,
was Sie suchen. Obschon ich gestehen muss, dass
ich nicht ganz klar Ihre Ziele erkenne.“
„Wir werden uns schon allmählicn verstehen!“
sagte der ^err Bartmann.
Und sie gingen zusammen zu der dem Herrn
Citronenthal befreundeten Familie.
Fortsetzung foglt
Der gebildete Wüstling
Von Mynona
Ein Wüstling namens Benno Kleck (Anfang dreissig;
Weltanschauung va sans dire; intelligentes rasieites
Aeusseres; genialische Mache; unvergleichlich zu-
geschneidert etcetera) — — war so gebildet, dass er
literarisch-doktrinarisch endlich nicht nur flo-, sondern
obendrein auch deflorierte. Wie entsetzlich genant!
Was sollte die höhere Tochter, die keusche Jungfrau
denken, wenn erst Montaigne, Alfred Kerr, Max Harden,
Aristoteles, Fulda und andere Berge kreissten — dann
aber — hast du nicht gesehehen? — sie selbstü
Einem Gebildeten steht nichts so schlecht und so
seltsam an, so unerwartet und überraschend als zu
sehr betonte ... na . . . . Lenden Und nun gar
ein Wüstling: sus Minervam. Bennol Bennol — Nu
schön! aber gibt uns Faust nicht das uaehrenhafieste
Vor- und Beispiel? Glauben Sie, der Heinrich (wa-
rum Heinrich??) hätte Gretchen - — —wenn er
nicht einen annähernd gebildeten und zugleich pa- und
potenten Eiiidruck gemacht hätte? Nein, nein, dass
es dem Kleck mit den Mädlein so kleckte, rührte von
— — mit Bildung her — eine nette Geschichte diese
Geschichte seiner Verführungen: hier eine statt ailer.
Benno näherte sich unter den • unglaublichsten
albernsten Vorwänden dem Fräulein Thekla Händewech
aus der Sauenziehnstrasse (oh ihr Setzerl). Thekla
war sechzehn Jahre, blond bis in das Mark ihrer
schnippischen Knochen, unverdorben wie ein Bastard
aus Tugend und Hässlichkeit, aber hübsch“wie Eva
drei Sekunden vor ihrem interessanten Fail; also eine
Delikatesse für — verstehen Sie ? Na, die blosse
Annäherung ist ja auch ohne alle Bildung wohl.mög-
lich, führt aber zu weiter nächts als zu komischen
physiologischen Allotrien ohne eigentlichen Effekt.
Man kann überhaupt sagen: Bildung allein verführt
bloss die Seele; Kraft allein bloss den Leib, — es
entsteht beidemal keinerlei totale Verführung, man tut
— auf Ehrel — nur ein halbes Werk. Sie müssen, wenn
Sie wie Kleck sind, entweder die holde Mädchenseele
mit dem Salz der Bildung durch und durch einmari-
nieren, um den armen Körper dadurch — wer weiss
wie zu reizen; oder Sie müssen physisch brutal werden
und dann die arme Seele so lange mit Bildung' zu
karessieren wissen, dass sie sich mit den verflucbten
(weil gesegneten) Umständen ihres Leibes auszusöhnen
entschliesst. Beidemal — non aliter — verführen Sie
tolaliter. So Benno.
Benno verwandelte die Thekla in eine wahre Lit-
fasssäule der Gebildetheit. Er beklebte sie von oben
bis unten ringsherum unter Auslassung eben nur einer
einzigen, kleinen, winzigen Stelle mit allen Plakaten
des feinen Wissens. Von Pantschatantra bis Suder-
mann —■ was sage ich: bis Leonor Goldschmied! —•
— war sie affichiert und gut auskoloriert — sie schrie
wie die Nymphe Echo von Allem, was nicht aus ihr
selbst, sondern aus Benno kam: das Echo beschämt
den Schall, es ist so viel mehr Ohren schonend, zärter,
einschmeichelnder: oh geniales Weibl Und als Benno
die Seele Theklas.erfunden hatte (oh weib-
liche — Jesses — „Psyche“ I), als Benno die etwas
robuste Wald- und Wiesen - Animadität der kleinen
Händewech seelisch ausgeläutert, abgebadet, ätherisiert
hatte — — da — — da — — ja da eröffnete er
dieser geschickt arrangierten Seele: sie sei hohl, hohl,
hohl (hol ihn der Teufell). Nun begann aiso Theklas
ailerliebste Figur seelisch zu leiden; hm. Das Wissen
wäre ja nichts ohne —. Ohne? — Na, ohne Herz:
verstehen Siel — Es ist gar nicht mehr viel zu be-
richten. Schluss mit Benno und Thekla. Es gibt
nichts schauerlicheres als wenn cerebrura und sexus
sich wie Zahnkiefern alliieren, um eine keusche Mädchen-
382
Aber der Kaiser lachte nicht; er verliess den
grossen Leuchtturm und begab sich in seinen Luft-
waggon.
XXV
Schilda und Ulaleipu
Die Lotte Wiedewitt schrieb an ihren Gatten nach
langen wirtschaftlichen Auseinandersetzungen am Schlusse
ihres ersten Briefes:
„Soweit ist hier wieder alles beim alten; die roten
und gelben Tuchstreifen sind wieder fortgebracht, und
jeder macht hier wieder seine alten Dummheiten,
manchmal auch neue dazu. Viel Gescheites kommt
dabei nicht raus. Der Kaiser, der jetzt hier Deine
Stellung einnimmt, Iässt sich fast garnicht sehen; man
sagt, er schreibe immerzu Rechnungen aus. Aber ich
glaube das nicht. Schreib mir bald, wie es Dir geht
in Deiner neuen Position. Es hat mit sehr leid getan,
dass ich bei Deiner Abfahrt wieder so heftig wurde —
aber Du warst doch die Veranlassung. Wir sind ja
von all den vielen Sorgen so nervös geworden.
Hoffentlich wird jetzt alles besser; die Nachbarn glauben
das auch. Schreibe bald!
Viele Grüsse aus Schilda!
Ich bin
Deine
Lotte“
Der Kaiser, der ja nicht der Kaiser, sondern der
Herr Sebastian war, schrieb natürlich keine gewöhnlichen
Rechnungen aus — darin hatte die Lotte Wiedewitt
ganz recht; der Herr Sebastian rechnete sehr viel
hinter verschlossenen Türen — aber diese Rechnungen
waren wissenschaftlicher Natur; der Herr Sebastian
arbeitete an einer neuen Erfindung, die mit Kanonen
einen Warentransport arrangieren sollte; die Waren
sollten mit Kanonen geschossen werden, und es handelte
sich darum, die Fangapparate so zu konstruieren, dass
sie die Geschosse auch dann auffingen, wenn ein
stärkerer Wind die Bahn ein wenig veränderte.
In Ulaleipu wa'r man natüriich nicht wenig erstaunt,
als man immer noch nichts von den Taten des neuen
Oberbürgermeisters hörte; man zerbrach sich den Kopf
über das zurückgezogene Leben des Kaisers, konnte
aber nichts herausbekommen, da die Schildbürger ganz
vernarrt in ihren kaiserlichen Oberbürgermeister waren
und ihn ganz ungestört liessen — natürlich in der
Annahme, dass ihr neues Oberhaupt nur über das
Seelen- und Leibesheil der Schildbürger nachdächte;
die Rechnungen des Herrn Sebastian kamen den Schild-
bürgern als nationalökonomische Rechnungen vor.
Auch der Herr Moritz Wiedewitt lebte in Ulaleipu
in der ersten Zeit sehr zurückgezogen, und auch er
arbeitete an grossen Rechnungen; diese aber waren
nationalökonomischer Natur und betrafen die Einnahmen
und Ausgaben der Stadt Schilda.
Der Interimskaiser Moritz wollte seine Position
zum Besten seiner Mitbürger ausnützen; er dachte
aber keineswegs an die innerlichen Schäden der Ein-
wohner Schildas, sondern an ihr äusserliches Leben,
dem natürlich sehr viel abging, da Schilda wirtschaft-
lich vom Kaiserreich Utopia losgelöst war una keinen
Anteil mehr haben sollte an all den vielen Wohlfahrts-
einrichtungen des Kaiserreichs.
Der Staatsrat kam oft zusammen, und die häufigen
Zusammenkünfte brachten allmählich eine heitere
Stimmung hervor; man beglückwünschte sich, dass
wenigstens kein Unsinn gemacht wurde — weder in
Schilda noch in Ulaleipu.
Die Bewohner der Residenz schienen äusserlich
von dem Thronwechsel kaum Notiz zu nehmen; die
Staatsverhältnisse waren ja nach allen Richtungeh so
gesichert, dass einschneidende Veränderungen nicht
denkbar schienen; doch die Neugierde wuchs — und
man war denn doch allgemein gespannt, was nun
werden würde.
Man glaubte schon, der Kaiser würde in Schilda
allmählich wieder den alten Volksglauben aufrichten,
aber die Priester schüttelten den Kopf und erklärten,
dass sie doch ganz allein berufen wären, einen der-
artigen Umschwung in der religiösen Lebensauffassung
zu bewirken.
Anderseits betonte man des Oefteren die verbohrte
Hartnäckigkeit der Schildbürger, die ein für allemal er-
klärt hatten, dass sie sich aus dem Volksgeiste nichts
machten und durchaus ihr eigenes Leben unabhängig
vom Volksgeiste führen wollten.
Und das war in Schilda immer noch so.
Und die Neugierde wuchs.
Die Neugierde wuchs auch in Schilda.
Man wachte auch in Schilda jeden Morgen mit
dem Gedanken auf:
„Was wird geschehen?“
Aber es geschah nichts.
Die Zeitungen schwiegen sich aus oder setzten
leere Vermutungen in die Welt.
Der Herr von Moellerkuchen sagte schliesslich zu
seiner Frau:
„Wenn jetzt nicht bald ein Erlass kommt, so be-
fürchte ich, dass alles beim Alten bleibt.“
Herr von Moellerkuchens Frau hielt das nicht für
so unwahrscheinlich.
XXVI
Der Antiquar
Der Kaiser fuhr nun als Herr Bartmann mit fieber-
hafter Schnelligkeit durch sein Kaiserreich und studierte
Land und Leute in der ihm eigentümlichen Art.
Der Herf Bartmann erregte überall ein beträchtliches
Aufsehen, aber nicht des sebastianschen Luftfahrzeuges
wegen — Luftwagen gabs in Utopia recht viele — es
war das Benehmen des Herrn Bartmann den Utopianern
so auffällig; der fremde Herr fragte so viel, und das
kam allen so neu, ungewöhnlich und — auch ein
bischen anstössig vor.
Und die Antworten, die man dem Herrn Bartmann
gab, klangen sehr bald recht spöttisch, so dass der
Fragestelier vorsichtig wurde und seine Taktik änderte;
er sah ein, dass er sich verdächtig gemacht hatte und
gab nun plötzlich vor, dass er eigentlich „Sammler“
sei — aber nicht ein einseitiger Sammler, vielmehr
einer mit sehr vielseitigen Interessen.
Und auf diese Weise machte er, ohne dass es
auffiel, die Bekanntschaft des Herrn Citronenthal, der
als berühmter Antiquar ein grosses und dabei sehr
intim gehaltenes Museuin sein Eigen nannte.
Und Herr Bartmann setzte Herrn Citronenthal sehr
bald auseinander, was er eigentlich zu sammeln wünschte,
und sprach demzufolge so;
„Ich möchte Raritäten geistiger < Art sammeln —
solche, die sich scharf abheben vom Allgemeinen und
eigensinnig ganz aparte Ziele verfoigen — Ziele, die
es zu ihren Zeiten noch nicht gab — kurzum: die
Phantasieprodukte der bizarrsten Naturen.“
„Aha!“ versetzte rasch Herr Citronenthal, „wenn
ich nicht irre, so wollen Sie die Ahnengallerie des
modernen Schilda“
Der Herr Bartmann errötete und fürchtete sich
abermals verraten zu haben und änderte deswegen
abermals den Kurs und meinte ganz harmlos lächelnd:
„Nicht so! Nicht so! Ich möchte bloss wissen,
wie sich der Voiksgeist, dem wir göttliche Verehrung
entgegenbringen und gegen den ich gar keine Opposition
wage, wie sich dieser Volksgeist in den feiner organi-
sierten Vertretern des Volkes in früheren Zeiten
offenbarte. Auf diese Wissbegierde allein basiert meine
ganze Sammelkunst. Mir ist so, als müsste ich etwas
Altes sammeln, wenn ich die Quintessenz und das
Allerfeinste der menschlichen Natur kennen lernen will,“
„Ganz auf dem richtigen Wege, Herr Bartmann“,
versetzte der Antiquar einfach, „Sie wolien alte recht
abenteuerliche Manuskripte — vielleicht Märchen oder
sogenannte Utopien! Ganz richtigl So was kann
man im Kaiserreich Utopia wohl sammeln Ich habe
sehr viel davon — auf kostbaren alten Blättern. Ja,
das nennt man wohl Erinnerungskunst, was Sie da
sammeln wollen. Im Alten steckt die ganze Seele
der Menschheit. Zum Alten zieht es uns immer wieder
hin, wenn wir in der Gegenwart nicht das finden, was
unserer Sehnsucht Genüge tut. Das weiss ein
Antiquar, und ich verstehe Sie, Herr Bartmann, und
schätze Sie.“
Der Antiquar blickte den Kaiser mit feuchten
Augen lächelnd an, doch der sagte hastig:
„Wie wärs aber, wenn ich noch weiter gehen
möchte? Kennen Sie nicht vielleicht Verhältnisse, in
denen das Alte in die Gegenwart gesetzt ist und dort
greifbar vor uns steht — und ganz lebendig ist? Sehen
Sie, grade das Lebendige möchte ich — das Lebendigel“
Herr Citronenthal runzelte die Stirn, stand auf und
ging auf seinen alten Teppichen ein paar mal auf und
ab und sagte dann bestimmt:
„Herr ßartmann, Sie sind doch kein echter
Sammler. Aber ich kann Sie in eine befreundete
Familie einführen, wo Sie wohl das finden werden,
was Sie suchen. Obschon ich gestehen muss, dass
ich nicht ganz klar Ihre Ziele erkenne.“
„Wir werden uns schon allmählicn verstehen!“
sagte der ^err Bartmann.
Und sie gingen zusammen zu der dem Herrn
Citronenthal befreundeten Familie.
Fortsetzung foglt
Der gebildete Wüstling
Von Mynona
Ein Wüstling namens Benno Kleck (Anfang dreissig;
Weltanschauung va sans dire; intelligentes rasieites
Aeusseres; genialische Mache; unvergleichlich zu-
geschneidert etcetera) — — war so gebildet, dass er
literarisch-doktrinarisch endlich nicht nur flo-, sondern
obendrein auch deflorierte. Wie entsetzlich genant!
Was sollte die höhere Tochter, die keusche Jungfrau
denken, wenn erst Montaigne, Alfred Kerr, Max Harden,
Aristoteles, Fulda und andere Berge kreissten — dann
aber — hast du nicht gesehehen? — sie selbstü
Einem Gebildeten steht nichts so schlecht und so
seltsam an, so unerwartet und überraschend als zu
sehr betonte ... na . . . . Lenden Und nun gar
ein Wüstling: sus Minervam. Bennol Bennol — Nu
schön! aber gibt uns Faust nicht das uaehrenhafieste
Vor- und Beispiel? Glauben Sie, der Heinrich (wa-
rum Heinrich??) hätte Gretchen - — —wenn er
nicht einen annähernd gebildeten und zugleich pa- und
potenten Eiiidruck gemacht hätte? Nein, nein, dass
es dem Kleck mit den Mädlein so kleckte, rührte von
— — mit Bildung her — eine nette Geschichte diese
Geschichte seiner Verführungen: hier eine statt ailer.
Benno näherte sich unter den • unglaublichsten
albernsten Vorwänden dem Fräulein Thekla Händewech
aus der Sauenziehnstrasse (oh ihr Setzerl). Thekla
war sechzehn Jahre, blond bis in das Mark ihrer
schnippischen Knochen, unverdorben wie ein Bastard
aus Tugend und Hässlichkeit, aber hübsch“wie Eva
drei Sekunden vor ihrem interessanten Fail; also eine
Delikatesse für — verstehen Sie ? Na, die blosse
Annäherung ist ja auch ohne alle Bildung wohl.mög-
lich, führt aber zu weiter nächts als zu komischen
physiologischen Allotrien ohne eigentlichen Effekt.
Man kann überhaupt sagen: Bildung allein verführt
bloss die Seele; Kraft allein bloss den Leib, — es
entsteht beidemal keinerlei totale Verführung, man tut
— auf Ehrel — nur ein halbes Werk. Sie müssen, wenn
Sie wie Kleck sind, entweder die holde Mädchenseele
mit dem Salz der Bildung durch und durch einmari-
nieren, um den armen Körper dadurch — wer weiss
wie zu reizen; oder Sie müssen physisch brutal werden
und dann die arme Seele so lange mit Bildung' zu
karessieren wissen, dass sie sich mit den verflucbten
(weil gesegneten) Umständen ihres Leibes auszusöhnen
entschliesst. Beidemal — non aliter — verführen Sie
tolaliter. So Benno.
Benno verwandelte die Thekla in eine wahre Lit-
fasssäule der Gebildetheit. Er beklebte sie von oben
bis unten ringsherum unter Auslassung eben nur einer
einzigen, kleinen, winzigen Stelle mit allen Plakaten
des feinen Wissens. Von Pantschatantra bis Suder-
mann —■ was sage ich: bis Leonor Goldschmied! —•
— war sie affichiert und gut auskoloriert — sie schrie
wie die Nymphe Echo von Allem, was nicht aus ihr
selbst, sondern aus Benno kam: das Echo beschämt
den Schall, es ist so viel mehr Ohren schonend, zärter,
einschmeichelnder: oh geniales Weibl Und als Benno
die Seele Theklas.erfunden hatte (oh weib-
liche — Jesses — „Psyche“ I), als Benno die etwas
robuste Wald- und Wiesen - Animadität der kleinen
Händewech seelisch ausgeläutert, abgebadet, ätherisiert
hatte — — da — — da — — ja da eröffnete er
dieser geschickt arrangierten Seele: sie sei hohl, hohl,
hohl (hol ihn der Teufell). Nun begann aiso Theklas
ailerliebste Figur seelisch zu leiden; hm. Das Wissen
wäre ja nichts ohne —. Ohne? — Na, ohne Herz:
verstehen Siel — Es ist gar nicht mehr viel zu be-
richten. Schluss mit Benno und Thekla. Es gibt
nichts schauerlicheres als wenn cerebrura und sexus
sich wie Zahnkiefern alliieren, um eine keusche Mädchen-
382